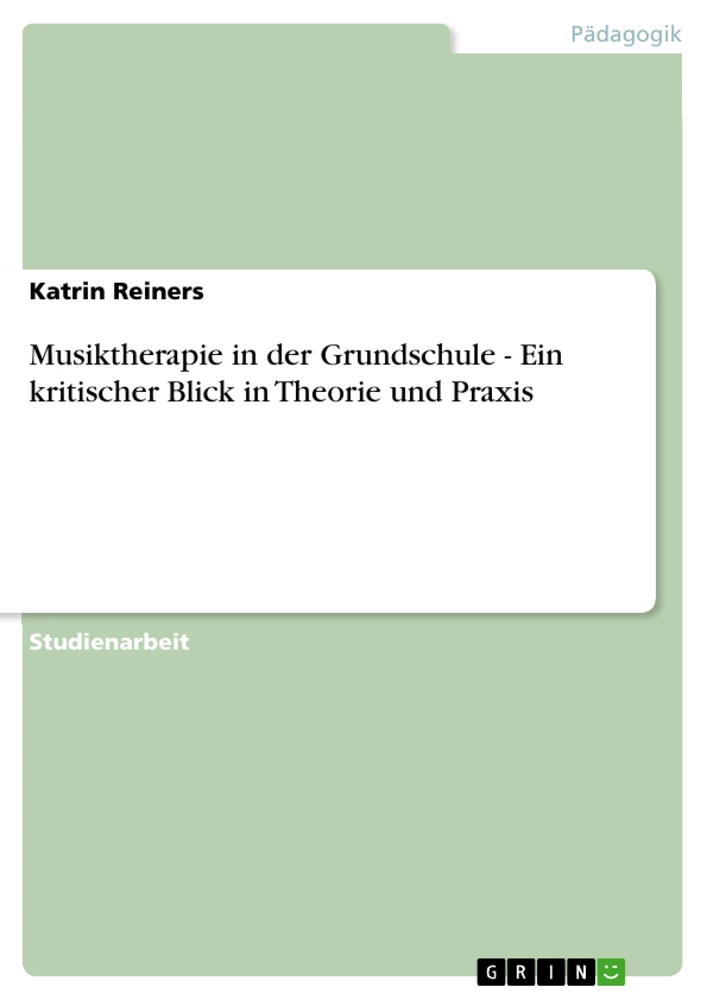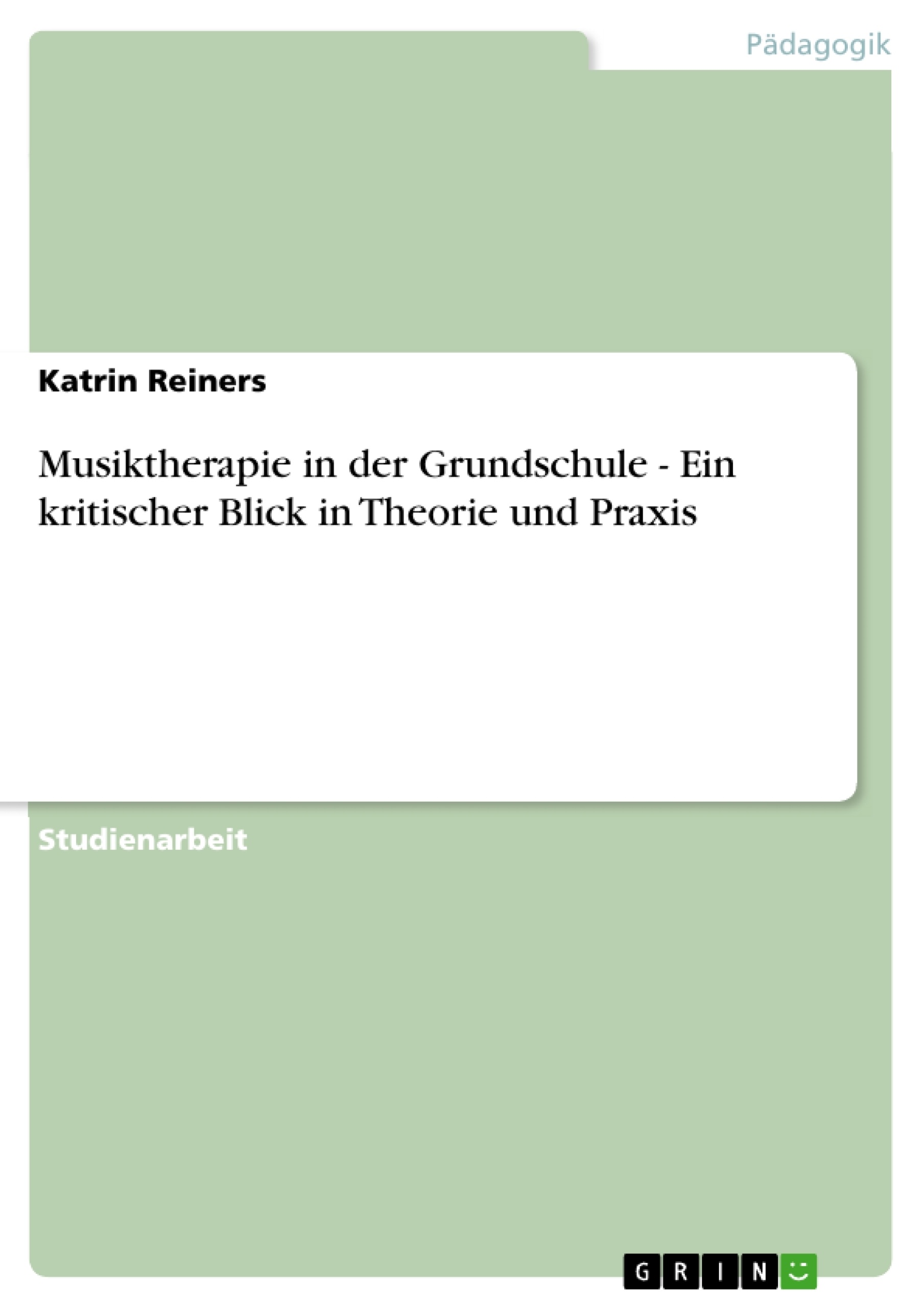Schule hat die Aufgabe, die Kinder gesellschaftsfähig zu machen. Doch sollte sich diese Institution nicht auch den gesellschaftlichen Veränderungen und der Lebenswelt ihrer Klientel anpassen? Mit den steigenden Ansprüchen und Erwartungen an die junge Generation steigt statistisch auch der Anteil an verhaltensauffälligen und psychisch kranken Kindern, sodass nunmehr die Forderung musiktherapeutischen Einsatzes in der Grundschule laut wird. Sollte also eine therapeutische Behandlung aller Kinder (Musiktherapie im Klassenverband) mit dieser Tatsache einhergehen?
In der Ausarbeitung wurde der Versuch unternommen Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Schnittstellen der Musikpädagogik und –therapie aufzuzeigen. Weiterhin wurde hinterfragt, woher die erachtete Notwendigkeit der Musiktherapie in der Schule rührt, und welche Vor- und Nachteile des musiktherapeutischen Tätigwerdens in der Institution Schule dargelegt werden können. Hat der Lehrer die Kompetenzen und die Kraft gleichzeitig Therapeut und Pädagoge zu sein? Kann ein Pädagoge der Doppelfunktion standhalten?
„Würden sie ihrem Kind Hustenstiller verabreichen, obwohl es keinerlei Anzeichen einer Erkrankung aufzeigt?“
Diese Fragestellung soll zum Nachdenken anregen. Warum sollten gesunde Kinder therapiert werden?
Inhaltsverzeichnis
- Die „musikalisch-pädagogisch-therapeutische Arbeit“ – die Notwendigkeit einer Neudefinition?
- Musiktherapie und Musikpädagogik- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Auf der Suche nach Schnittstellen in Pädagogik und Therapie
- Was Schule alles leisten soll
- Warum nun Musiktherapie in der Grundschule? Von kranken Schülern und überforderten Lehrern
- Die Frage nach einem geeigneten Therapeuten- Kann ein Pädagoge therapeutisch tätig werden?
- Musiktherapie in der Grundschule- eine Bereicherung für die Pädagogik?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung setzt sich zum Ziel, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Schnittstellen von Musikpädagogik und Musiktherapie aufzuzeigen. Sie beleuchtet die erachtete Notwendigkeit von Musiktherapie in der Grundschule und analysiert Vor- und Nachteile des musiktherapeutischen Tätigwerdens in der Institution Schule. Die Ausarbeitung fragt nach den Kompetenzen und der Kraft des Lehrers, gleichzeitig Therapeut und Pädagoge zu sein und untersucht, ob ein Pädagoge der Doppelfunktion standhalten kann.
- Definition und Abgrenzung von Musiktherapie und Musikpädagogik
- Schnittstellen zwischen Pädagogik und Therapie
- Bedeutung und Notwendigkeit von Musiktherapie in der Grundschule
- Kompetenzen und Anforderungen an den Lehrer als Therapeuten
- Ethische und pädagogische Aspekte des musiktherapeutischen Einsatzes in der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung von Musiktherapie und Musikpädagogik. Es werden verschiedene Ansätze zur Unterscheidung der beiden Disziplinen vorgestellt und kritisch betrachtet. Im zweiten Kapitel wird die Rolle der Schule in der heutigen Gesellschaft beleuchtet, und es wird die Frage nach der Notwendigkeit von Musiktherapie in der Grundschule aufgeworfen. Das dritte Kapitel beleuchtet die Chancen und Herausforderungen, die mit der Integration von Musiktherapie in die Pädagogik verbunden sind.
Schlüsselwörter
Musiktherapie, Musikpädagogik, Grundschule, Pädagogik, Therapie, Schnittstellen, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Kompetenzen, Doppelfunktion, Lehrer, Therapeut, Verhaltensauffälligkeiten, psychische Erkrankungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Musikpädagogik und Musiktherapie?
Musikpädagogik zielt auf die Vermittlung musikalischer Fähigkeiten ab, während Musiktherapie Musik als Mittel zur Heilung oder Linderung psychischer und physischer Probleme nutzt.
Warum wird Musiktherapie in Grundschulen gefordert?
Aufgrund steigender Zahlen von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Belastungen bei Kindern suchen Schulen nach Wegen zur psychosozialen Unterstützung.
Kann ein Lehrer gleichzeitig Therapeut sein?
Dies ist kritisch zu sehen, da die Rollen von bewertendem Pädagogen und schützendem Therapeuten oft im Konflikt stehen und unterschiedliche Kompetenzen erfordern.
Welche Vorteile bietet Musiktherapie im Klassenverband?
Sie kann das soziale Miteinander fördern und präventiv wirken, wirft aber die Frage auf, ob „gesunde“ Kinder therapiert werden müssen.
Welche ethischen Aspekte müssen beachtet werden?
Wichtig sind der Schutz der Intimsphäre der Kinder und die Vermeidung einer Stigmatisierung durch therapeutische Maßnahmen im schulischen Kontext.
- Citar trabajo
- Katrin Reiners (Autor), 2010, Musiktherapie in der Grundschule - Ein kritischer Blick in Theorie und Praxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188533