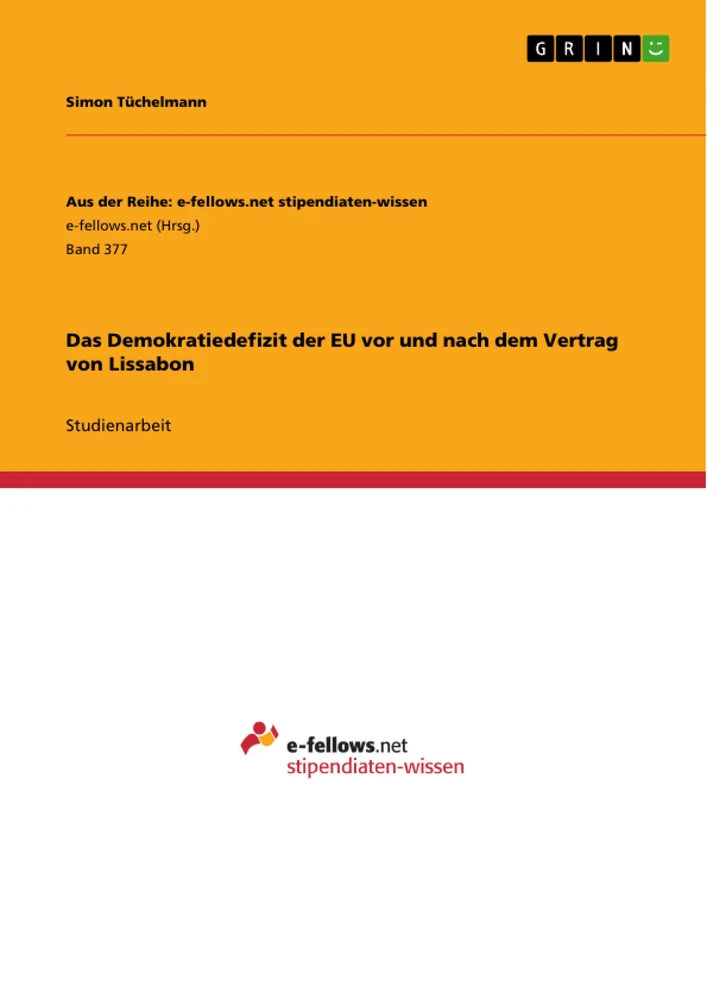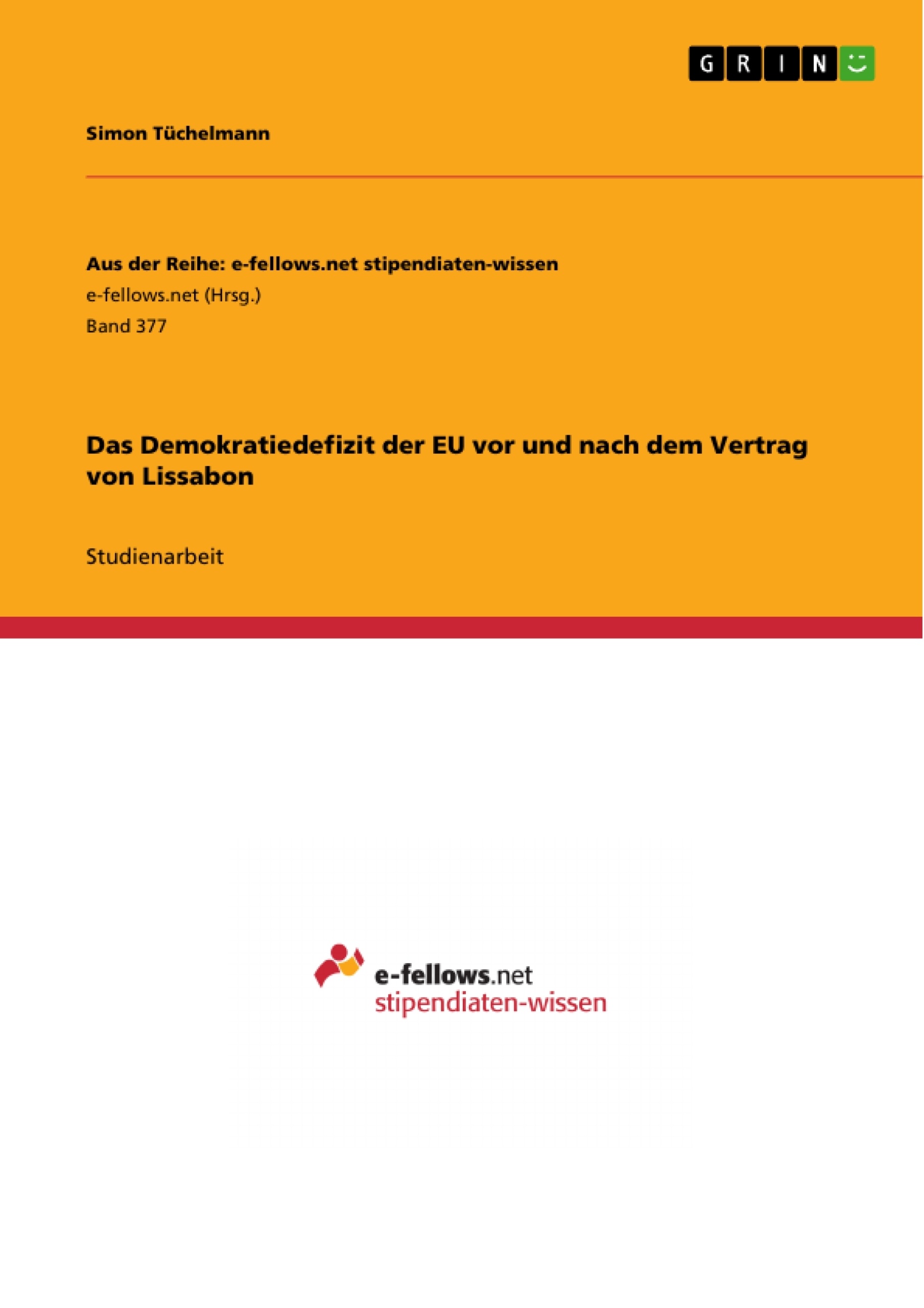„Muss man nicht fragen: Ist die Kompetenz, die jemand gewinnt, ein Gewinn für die Freiheit? Ist der Gedanke des Immer-Mehr in der Tendenz nicht freiheitsgefährdend?” Diese Frage stellte Di Fabio, Verfassungsrichter, während der Verhandlung im BverfG zum Lissabon-Vertrag dem damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble und drückte damit die Sorgen vieler Europaskeptiker aus. Die Europäische Union (EU) leide an einem Demokratiedefizit, sie verstärke die Tendenz zur Dominanz der Exekutive, das „Spiel über Bande” entmachte das Parlament und sie hebe die Gewaltenteilung, also einen Grundsatz des Grundgesetzes, auf, so die Vorwürfe der Kritiker. Bundespräsident a.D. Roman Herzog behauptete schließlich, man müsse sich die Frage stellen, ob die Bundesrepublik Deutschland noch eine parlamentarische Demokratie sei.Ungeachtet dieser Vorwürfe und einiger „herber” Rückschläge 5 nimmt die Dynamik der Integration der EU weiter zu. Der Vertrag von Lissabon wurde Ende 2009 von allen Mitgliedsstaaten ratifiziert und trat somit am 1. Dezember 2009 in Kraft. Von den Regierungen wurde er als Meilenstein der Verstärkung der Demokratie und der Effizienz in der EU gefeiert, allerdings bleiben viele Vorbehalte und Kritikpunkte ungeklärt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Darstellung des Demokratiedefizits
- Institutionelle Kritik
- Strukturelle Kritik
- Legitimationsarten einer Demokratie
- Input-orientierte Legitimation
- Output-orientierte Legitimation
- Was bringt der Vertrag von Lissabon?
- Positive Veränderungen
- Offene Kritikpunkte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Demokratiedefizit der Europäischen Union (EU) vor und nach dem Vertrag von Lissabon. Sie untersucht, ob die Ausweitung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments (EP) durch den Vertrag von Lissabon das Demokratiedefizit beheben kann. Hierfür werden die verschiedenen Legitimationsarten einer Demokratie betrachtet und die geforderte Parlamentarisierung auf der Grundlage des Lissabon-Vertrags beurteilt.
- Das Demokratiedefizit der EU
- Institutionelle und strukturelle Kritik an der EU
- Input- und outputorientierte Legitimation von Demokratie
- Die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf das Demokratiedefizit
- Die Rolle des Europäischen Parlaments
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Demokratiedefizits der EU ein und stellt die zentrale Frage der Hausarbeit, ob die Ausweitung der Kompetenzen des EP durch den Vertrag von Lissabon das Demokratiedefizit beheben kann. Das zweite Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf das Demokratiedefizit. Es werden die institutionelle Kritik, die sich gegen die institutionelle Ausgestaltung der EU richtet, und die strukturelle Kritik, die das Fehlen einer europaweiten Debattenkultur thematisiert, dargestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Legitimationsarten einer Demokratie, indem es die Input- und Output-Legitimation erläutert. Im vierten Kapitel wird der Vertrag von Lissabon und seine Auswirkungen auf das Demokratiedefizit analysiert, indem die positiven Veränderungen und offenen Kritikpunkte vorgestellt werden. Das Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Demokratiedefizit, Europäische Union, Vertrag von Lissabon, Europäisches Parlament, Legitimation, Input-Legitimation, Output-Legitimation, Gewaltenteilung, Institutionelle Kritik, Strukturelle Kritik, Debattenkultur, Europaweite Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Demokratiedefizit der EU?
Kritiker bemängeln eine Dominanz der Exekutive, eine Schwächung der nationalen Parlamente und das Fehlen einer europaweiten Debattenkultur.
Hat der Vertrag von Lissabon das Demokratiedefizit behoben?
Der Vertrag stärkte zwar die Kompetenzen des Europäischen Parlaments, doch viele strukturelle Kritikpunkte bleiben laut der Arbeit weiterhin ungeklärt.
Was ist der Unterschied zwischen Input- und Output-Legitimation?
Input-Legitimation bezieht sich auf die Beteiligung der Bürger (Wahlen), während Output-Legitimation die Effizienz und Ergebnisse der Politik (Nutzen für die Bürger) betrachtet.
Welche Rolle spielt das Europäische Parlament nach Lissabon?
Das Parlament erhielt durch den Vertrag mehr Mitentscheidungsrechte, was als Meilenstein zur Verstärkung der Demokratie gefeiert wurde.
Warum kritisierte Roman Herzog die EU-Entwicklung?
Herzog stellte die Frage, ob Deutschland noch eine parlamentarische Demokratie sei, wenn immer mehr Kompetenzen an die EU ohne ausreichende parlamentarische Kontrolle übertragen werden.
- Citar trabajo
- Simon Tüchelmann (Autor), 2010, Das Demokratiedefizit der EU vor und nach dem Vertrag von Lissabon, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188777