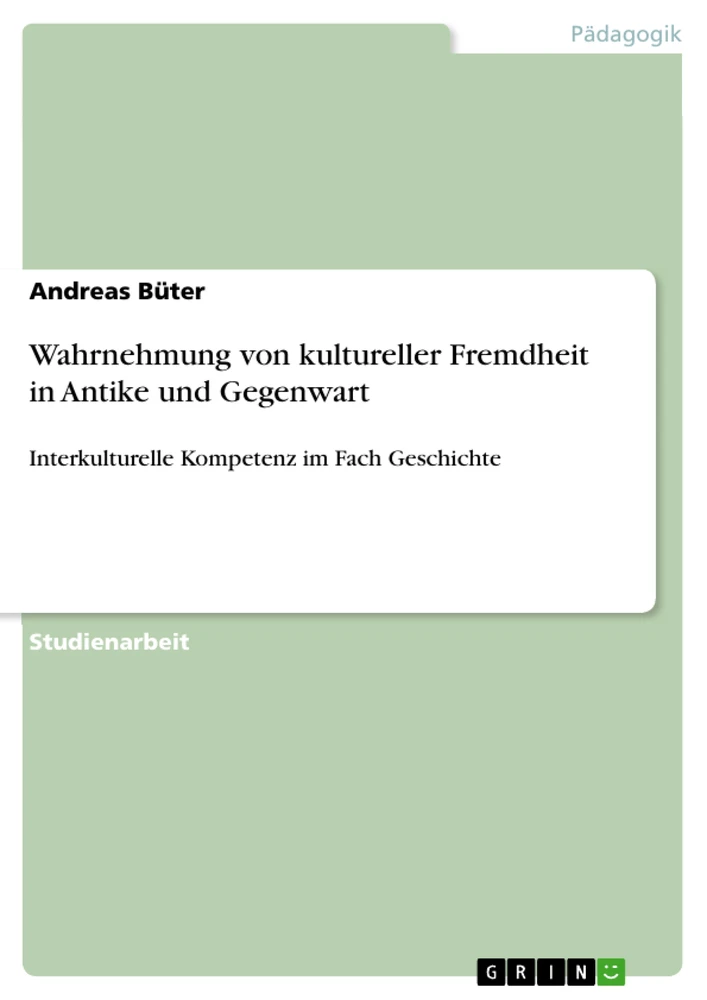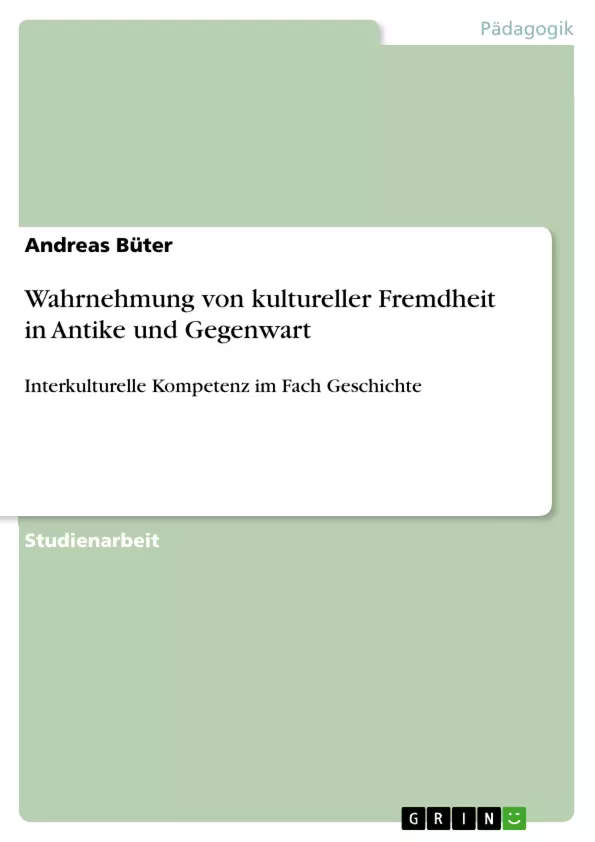Fremdenfeindlichkeit Fremdheit Rassismus Zentrismus Ethnozentrismus Angst Ängste Ursachen Ursprung Herkunft Tradition Geschichte Xenophobie Kultur Fremdenangst Überfremdung Fremdwahrnehmung Wissenschaftliche Grundlagen Forschung Schule Schüler
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um ein didaktisches Planungskonzept der interkulturellen Pädagogik im Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II. Es stellt eine vor dem Hintergrund der entsprechenden Richtlinien und Lehrpläne sich ergebende Möglichkeit dar, wie antike Schriftquellen mit ethnographischer Ausrichtung für die Förderung multiperspektivischer Handlungskompetenz von Schülerinnen und Schülern nutzbar gemacht werden können.
Die thematische Grundlage des Konzeptes besteht in der lehrplanverankerten Leitproblematik „Das Eigene und das Fremde“. Es beinhaltet bereits in seinen komprimiert formulierten Problembeschreibungen einen deutlichen Verweis auf das Potential der epochenübergreifenden Auswirkung von politischen Instrumentalisierungen der historischen Völkerbeschreibungen, welches von diesen frühen „Wurzeln“ der europäischen Geschichtsschreibung im Zeitfeld 4 ausgeht.
Diesbezüglich wird die antike (griechische) Geschichtsschreibung als gesellschaftliche „Weichenstellung“ bis in unsere heutige Gesellschaft und ihre interkulturellen Wahrnehmungseigenschaften dargestellt.
Mit der hier angeführten beispielhaften Auswahl der zu untersuchen-en Text-/ Filmquellen wird der historische Bearbeitungsgegenstand in einer von mehreren Möglichkeiten eingegrenzt, ohne diesbezüglich einen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben
Der konzeptionelle Schwerpunkt liegt dabei in dem Ziel einer Erkenntniserweiterung zur Erarbeitung kritischer Geschichtsbetrachtungen. Dabei überwiegen die (geplanten) weiterführenden und sich jeweils neu ergebenden Fragestellungen gegenüber den (vordergründig eindeutigen) Antworten auf die dargestellten kulturhistorischen Probleme.
Insgesamt soll mit diesem Planungskonzept eine konzeptionelle Anregung zur Förderung objektiver Kritikfähigkeit geschaffen werden. Diese soll es ermöglichen, die seit der Antike tradierten Grundlagen von Gesellschafts- und Gruppenidentifikation zu erkennen und zu hinterfragen. Das Ziel ist somit der Erkenntnisgewinn bezüglich des persönlichen Kulturverständnisses und ein höheres Toleranzpotential gegenüber anderen Gesellschaften und Kulturen .
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Grundmotivation zur Bearbeitung interkultureller Problematik im Geschichtsunterricht
- 1. Konzeptioneller Hintergrund
- 2. Gesellschaftspsychologie der Fremdwahrnehmung
- 3. Fremdheitsdarstellung im Kontext der Antike
- 3.1 Weltanschauliche Grundlagen der frühen Kulturbeschreibungen
- 3.2 Die griechische Kultur als europäische Ur-Identifikation
- III. Didaktisch-konzeptionelle Entfaltung
- 1. Das Geschichtswerk des Herodot als quellenanalytischer Ausgangspunkt
- 1.1 Anlehnung an den Fachlehrplan
- 1.2 Grundvoraussetzungen für historische Urteilsbildung
- 1.3 Diskussionsmethodik
- 2. Analyse bedeutsamer Quellenauszüge mit epochenübergreifendem Aktualitätsbezug
- 3. Erkenntnisanwendung durch Analyse eines aktuellen Medien-Beispiels
- 3.1 Vergleich von Originalquelle, Filmhandlung und Reaktionen der Öffentlichkeit
- 3.2 Entwicklung kritisch-reflektierender Fragestellungen
- 1. Das Geschichtswerk des Herodot als quellenanalytischer Ausgangspunkt
- IV. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit stellt ein didaktisches Planungskonzept für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II dar. Es soll aufzeigen, wie antike Schriftquellen mit ethnographischer Ausrichtung genutzt werden können, um die multiperspektivische Handlungskompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern. Das Konzept basiert auf der Leitproblematik "Das Eigene und das Fremde" und analysiert die Auswirkungen von politischen Instrumentalisierungen historischer Völkerbeschreibungen. Dabei wird die antike (griechische) Geschichtsschreibung als gesellschaftliche "Weichenstellung" bis in die heutige Zeit und ihre interkulturellen Wahrnehmungseigenschaften dargestellt. Der Fokus liegt auf der Erweiterung des Wissens über kritische Geschichtsbetrachtungen und der Förderung einer objektiven Kritikfähigkeit, um die seit der Antike tradierten Grundlagen von Gesellschafts- und Gruppenidentifikation zu erkennen und zu hinterfragen. Ziel ist der Erkenntnisgewinn bezüglich des persönlichen Kulturverständnisses und ein höheres Toleranzpotential gegenüber anderen Gesellschaften und Kulturen.
- Die Bedeutung von interkultureller Kompetenz im Geschichtsunterricht
- Die Analyse von Fremdheitsdarstellungen in antiken Texten
- Die Rolle des Ethnozentrismus in der Fremdwahrnehmung
- Die Entwicklung kritischer Geschichtsbetrachtungen
- Die Förderung von Toleranz und interkulturellem Verständnis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt ein didaktisches Konzept für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II vor, welches die Thematik "Das Eigene und das Fremde" im Kontext antiker Schriftquellen behandelt.
- Grundmotivation: Die Arbeit erläutert die Relevanz der interkulturellen Problematik im Geschichtsunterricht und stellt die Bedeutung von Ethnozentrismus als Verhaltensmuster der Fremdwahrnehmung heraus.
- Fremdheitsdarstellung in der Antike: Dieser Abschnitt befasst sich mit den weltanschaulichen Grundlagen früher Kulturbeschreibungen und untersucht die Bedeutung der griechischen Kultur als europäische Ur-Identifikation.
- Didaktisch-konzeptionelle Entfaltung: Dieses Kapitel präsentiert das Geschichtswerk des Herodot als quellenanalytischen Ausgangspunkt für die Förderung kritischer Geschichtsbetrachtungen. Es behandelt die Analyse von Quellenauszügen mit epochenübergreifendem Aktualitätsbezug und die Erkenntnisanwendung durch die Analyse eines aktuellen Medienbeispiels.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Geschichtsunterricht, Fremdwahrnehmung, Ethnozentrismus, Antike, Kulturbeschreibung, Herodot, Quellenanalyse, kritisches Denken, Toleranz, Gesellschaftsidentität.
- Quote paper
- Studienrat Andreas Büter (Author), 2007, Wahrnehmung von kultureller Fremdheit in Antike und Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188801