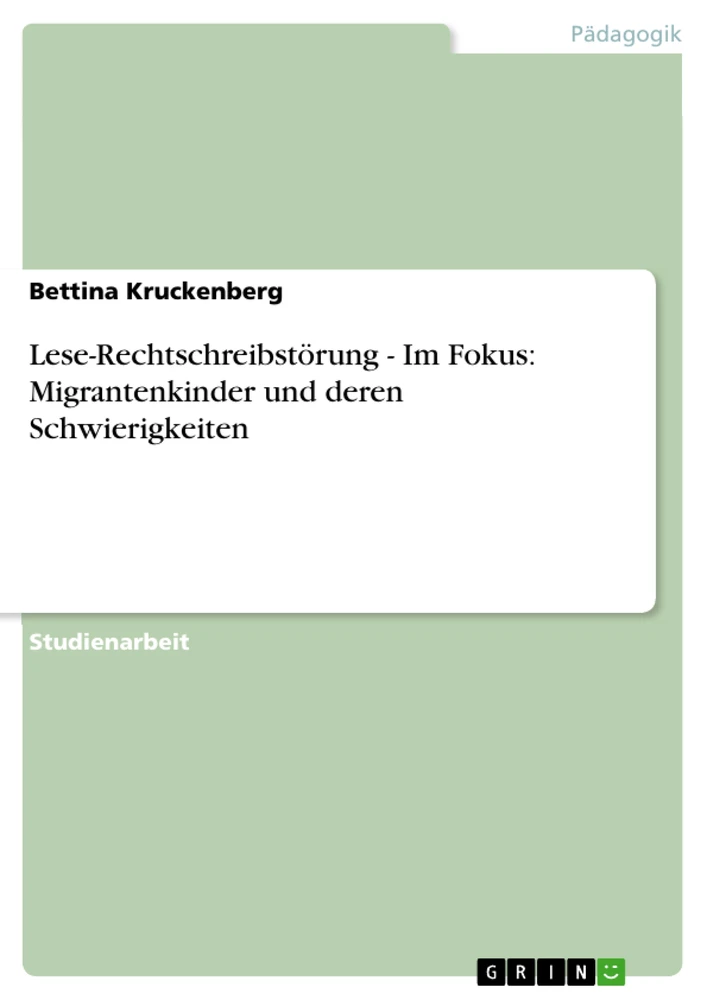1. Einleitung
„Lesen ist für den Geist das, was Gymnastik für den Körper ist.“
Zu Problemen kommt es in der Schullaufbahn und dem weiteren Lebensweg immer dann, wenn diese geistige Gymnastik nicht ausreichend funktioniert und somit eine Lese-und Rechtschreibstörung vorhanden ist. Im deutschen Bildungssystem gibt es zum momentanen Stand große Schwierigkeiten, da die Leistungen der Schüler sich entweder auffällig am oberen oder am unteren Leistungsniveau orientieren. Problematischer sind hierbei mehr die schlechteren Leistungen, unter denen häufig viele Kinder mit einer Lese-und Rechtschreibstörung zu finden sind. So ist es nicht verwunderlich, dass Deutschland im internationalen Vergleich beim Lesen und Schreiben auf den hinteren Rängen zurückbleibt. Zusätzlich ist es bei diesen schlechten Leistungen auffällig, dass es immer häufiger Kinder mit Migrationshintergrund sind, die an einer Lese- und Rechtschreibstörung leiden, da diese am Rande des Gesellschaft sozialisiert und nicht vollständig integriert werden.2
Zum aktuellen Zeitpunkt ist in Deutschland bei etwa „4% aller Kinder mit einer Lese- Rechtschreibstörung zu rechnen. Dabei sind Jungen etwa dreimal häufiger als Mädchen betroffen.“3 Trotz dieser konkreten Zahl bleibt es schwierig, die Häufigkeit einer LRS4 genau anzugeben, da die Grenze zum Normalbereich fließend ist. Die Ursachen liegen nicht erst in der eigentlichen Schullaufbahn, in der die Schwierigkeiten auftreten, sondern bereits viel früher, denn nur noch knapp jedes zweite Kind mit Migrationshintergrund besucht eine Institution frühkindlicher Bildung.5 Für die Kinder mit Migrationshintergrund, die eine Lese- und Rechtschreibstörung aufweisen und keine spezifische und individuelle Förderung erhalten, ist es nahezu unmöglich, eine gehobene Schullaufbahn zu absolvieren oder einen qualifizierenden Bildungsabschluss zu erzielen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition Lese- und Rechtschreibstörung
- 3. Die allgemeinen Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung
- 3.1. Die Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung bei Migrantenkindern
- 4. Die Entwicklung von Lesen und Schreiben bei Migrantenkindern
- 4.1. Das phonetische Problem beim Lese- und Schreiberwerb
- 4.2. Das Wortschatzproblem beim Lese-Schreiberwerb
- 4.3. Das Grammatikproblem beim Lese-Schreiberweb
- 4.4. Das Motivationsproblem beim Lese-Schreiberwerb
- 5. Die Diagnose von Lese-Rechtschreibstörungen
- 5.1. Diagnostische Arbeit an Schulen bei Kindern mit Migrationshintergrund
- 6. Die Förderung von Lese-Rechtschreibstörungen bei Kindern mit Migrationshintergrund
- 6.1. Die Förderung der phonetischen Bewusstheit der Migrantenkinder
- 6.2. Die Förderung des phonetischen Schreibens der Migrantenkinder
- 6.3. Die Förderung des Wortbildlernens der Migrantenkindern
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Herausforderungen, die Migrantenkinder beim Erlernen von Lesen und Schreiben im deutschen Bildungssystem begegnen, mit besonderem Fokus auf Lese-Rechtschreibstörungen (LRS). Ziel ist es, die Ursachen einer LRS bei Migrantenkindern zu verstehen und geeignete Fördermöglichkeiten aufzuzeigen.
- Ursachen für LRS bei Migrantenkindern
- Entwicklung von Lesen und Schreiben bei Migrantenkindern
- Diagnose von LRS bei Migrantenkindern
- Förderung von Lese- und Rechtschreibkompetenz bei Migrantenkindern
- Bedeutung frühkindlicher Bildung für die Entwicklung von Lese- und Rechtschreibkompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Lesen und Schreiben und die Herausforderungen, die Kinder mit LRS im deutschen Bildungssystem erleben. Im Fokus steht die Situation von Migrantenkindern mit LRS, die oft zusätzliche Schwierigkeiten erfahren.
- Kapitel 2: Begriffsdefinition Lese- und Rechtschreibstörung: Dieses Kapitel erklärt den Begriff der LRS und stellt sie als eine spezifische Lernstörung dar, die sich auf das Erlernen von Lesen und Schreiben konzentriert. Dabei wird betont, dass LRS nicht auf eine mangelnde Intelligenz zurückzuführen ist.
- Kapitel 3: Die allgemeinen Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung: Dieser Abschnitt befasst sich mit den allgemeinen Ursachen einer LRS. Es werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die zu Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben führen können.
- Kapitel 4: Die Entwicklung von Lesen und Schreiben bei Migrantenkindern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Lesen und Schreiben bei Migrantenkindern. Es werden spezielle Herausforderungen wie phonetische Probleme, Wortschatzdefizite, grammatische Schwierigkeiten und Motivationsdefizite aufgezeigt.
- Kapitel 5: Die Diagnose von Lese-Rechtschreibstörungen: Der Abschnitt widmet sich der Diagnose von LRS bei Kindern mit Migrationshintergrund. Es werden wichtige Aspekte der diagnostischen Arbeit an Schulen beleuchtet und besondere Herausforderungen bei der Diagnose von LRS bei Migrantenkindern hervorgehoben.
- Kapitel 6: Die Förderung von Lese-Rechtschreibstörungen bei Kindern mit Migrationshintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet die Förderung von LRS bei Kindern mit Migrationshintergrund. Es werden verschiedene Fördermaßnahmen, wie z.B. die Förderung der phonetischen Bewusstheit, des phonetischen Schreibens und des Wortbildlernens vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Lese-Rechtschreibstörung, Migrantenkinder, Bildungssystem, Förderung, Diagnose, phonetische Bewusstheit, Wortbildlernen, frühkindliche Bildung und Integration.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Migrantenkinder häufiger von LRS betroffen?
Oft liegt dies an mangelnder frühkindlicher Förderung, Sprachbarrieren und einer unzureichenden Integration in das deutsche Bildungssystem.
Was ist das "phonetische Problem" beim Leseerwerb?
Migrantenkinder haben oft Schwierigkeiten, deutsche Laute korrekt zu unterscheiden und den entsprechenden Buchstaben zuzuordnen (phonologische Bewusstheit).
Wie äußert sich das Wortschatzproblem bei LRS?
Ein geringer Wortschatz erschwert das Sinnerfassen von Texten, was die Motivation mindert und den Lese- und Schreiblernprozess verlangsamt.
Wie wird LRS bei Kindern mit Migrationshintergrund diagnostiziert?
Die Diagnose erfordert eine sorgfältige Abgrenzung zwischen sprachlichen Defiziten aufgrund der Zweitsprache und einer tatsächlichen Lese-Rechtschreibstörung.
Welche Fördermöglichkeiten gibt es?
Wichtig sind die gezielte Förderung der phonetischen Bewusstheit, Wortbildtraining und eine individuelle Unterstützung, die bereits im Kindergarten beginnen sollte.
- Quote paper
- Bettina Kruckenberg (Author), 2010, Lese-Rechtschreibstörung - Im Fokus: Migrantenkinder und deren Schwierigkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189165