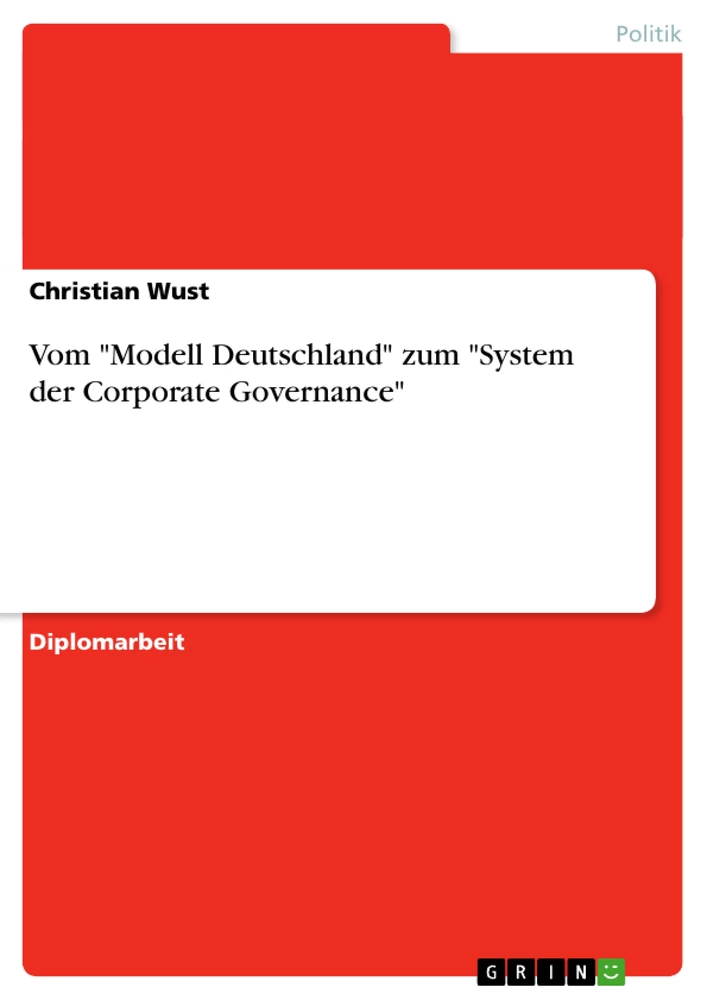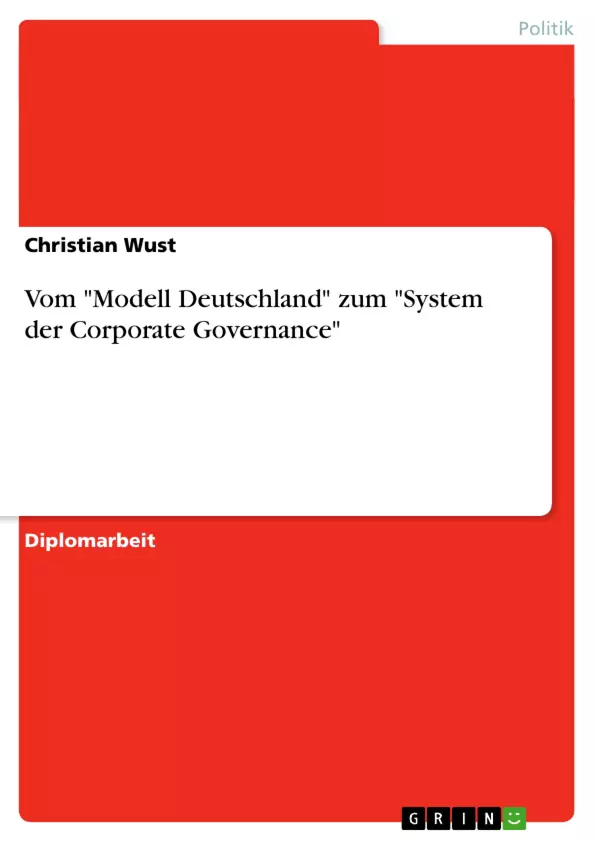Politik und Wirtschaft sind heute die zwei bedeutendsten Bereiche eines modernen Staates. Eine reale Interdependenz dieser beiden Bereiche ist hierbei unbestritten. Die Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland ist Grundlage und Voraussetzung, sie stellt aber auch Bedingungen für das Zusammenspiel von Staat und Wirtschaft. Dieser Zusammenhang zwischen staatlicher Struktur und ökonomischem Prozeß ist traditionell sehr konsensbetont. Auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben agieren die Akteure beider Bereiche in einer Weise, daß sich ein „Modell“ herausgebildet hat: Das „Modell Deutschland“.
Dieses läßt sich aufgrund eines historischen und eines funktionalen Ansatzes definieren. Historisch wurde der Begriff „Modell Deutschland“ im Bundestagswahlkampf 1976 durch die SPD unter Bundeskanzler Helmut Schmidt geprägt. Das „Modell Deutschland“ sollte dabei für die relativ erfolgreiche Stabilitäts- und Anpassungspolitik der Bundesrepublik nach der ersten Ölkrise 1973/74 stehen und eine vorbildliche, beschäftigungswirksame Modernisierungspolitik demonstrieren. „It matched a characteristically hardheaded vision with his [Schmidts] (CTW) own policy expertise as
a professional economist who had trained under [...] Karl Schiller“ 1 . Das Modell sollte dabei indirekt auf dem „Wirtschaftswunder“ aufbauen, welches vorher fast 20 Jahre angedauert hatte.
Funktional stellt das Modell den Überbegriff für eine Reihe von einzelnen Faktoren dar, die das Wirtschaftsgeschehen und das Verhältnis von Staat und Wirtschaft charakterisieren. Dazu gehört die Institution der Mitbestimmung als einmaliges und demokratisches Element, die starke Stellung der Banken, aber auch die Gewerkschaften. Eine mindestens genauso hohe Wertigkeit haben bestimmte Qualitäten, die dem deutschen Modell zugerechnet werden: „[L]ong-termism in investment; high capital stock per employee; product excellence and reliability; an emphasis on skill-upgrading; a collaborative approach to innovation; a capacity to retain competitiveness by [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Allgemeine Einführung in die Themenstellung (Historischer und Funktionaler Ansatz)
- Fragestellung, Zielsetzung und Vorgehensweise
- „Modell Deutschland“: Theoretische Grundlagen und Charakteristika
- Formaler Aufbau von Kapitalgesellschaften
- Mitbestimmung
- Anteilsbesitzverflechtungen und die Rolle der Banken
- Planungs- und Entscheidungsstil von Unternehmensführung
- Zwischenergebnis
- Interdependenzen zwischen Politik und Wirtschaft: Veränderungsdruck durch wirtschaftliche Internationalisierung
- Charakterisierung von wirtschaftlicher Internationalisierung
- Mitbestimmung: Veränderungen im Mitbestimmungsgesetz und das neue Betriebsverfassungsgesetz
- Banken: Von der Hausbank zum globalen Unternehmen
- Machtpotential Anteilsbesitz: Nationale Verantwortung und internationaler Anspruch
- Unternehmensführung: Wandel von der Stakeholder- zur Shareholder-Orientierung
- Zwischenergebnis und Hinführung zu Problemfeldern
- Darstellung aktueller Fälle und Lösungsansätze
- Fusion Mannesmann AG und Vodafone Airtouch
- Krise der Philipp Holzmann AG
- Zusammenfassung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Fallbeispiele
- „Corporate Governance“: Transparenz und Kontrolle
- Allgemeine begriffliche und theoretische Grundlagen von Corporate Governance
- Maßnahmen zur Verbesserung der Corporate Governance
- Empfehlungen des Centre for European Policy Studies (CEPS)
- Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG)
- OECD-Prinzipien für Corporate Governance
- Herzog-Tietmeyer-Kommission
- Berliner Initiativkreis German Code of Corporate Governance (GCCG)
- Grundsatzkommission Corporate Governance (German Panel on CG)
- Regierungskommission I „Corporate Governance“
- Regierungskommission II „Corporate Governance“
- Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG)
- Zusammenfassung und Bewertung der Maßnahmen
- Zusammenfassung und Ausblick – Das System der Corporate Governance
- Interpretation und Zusammenfassung der Ergebnisse
- Weiterführende Fragestellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung des Verhältnisses zwischen Staat und Wirtschaft in Deutschland. Sie untersucht, wie das traditionelle „Modell Deutschland“ durch die zunehmende wirtschaftliche Internationalisierung in ein „System der Corporate Governance“ überführt wird.
- Wandel des „Modell Deutschland“ durch wirtschaftliche Internationalisierung
- Veränderungen in der deutschen Corporate Governance
- Einfluss von Globalisierung auf die Unternehmensführung
- Rolle des Staates in der neuen Wirtschaftsordnung
- Analyse aktueller Fallbeispiele (z.B. Fusion Mannesmann/Vodafone)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Themenstellung, die den historischen und funktionalen Ansatz des „Modell Deutschland“ sowie die Fragestellung, Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit beleuchtet. Kapitel 2 befasst sich mit den theoretischen Grundlagen und Charakteristika des „Modell Deutschland“, indem es den formalen Aufbau von Kapitalgesellschaften, die Mitbestimmung, Anteilsbesitzverflechtungen und die Rolle der Banken sowie den Planungs- und Entscheidungsstil der Unternehmensführung analysiert.
Kapitel 3 beleuchtet die Interdependenzen zwischen Politik und Wirtschaft im Kontext der wirtschaftlichen Internationalisierung. Hier werden Veränderungen im Mitbestimmungsgesetz, die Entwicklung der Bankenlandschaft, das Machtpotential des Anteilsbesitzes und der Wandel von der Stakeholder- zur Shareholder-Orientierung in der Unternehmensführung untersucht.
Kapitel 4 stellt aktuelle Fälle wie die Fusion Mannesmann AG und Vodafone Airtouch sowie die Krise der Philipp Holzmann AG vor und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Fallbeispiele auf. Kapitel 5 widmet sich dem „System der Corporate Governance“, wobei die allgemeinen begrifflichen und theoretischen Grundlagen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Corporate Governance, wie z.B. Empfehlungen des CEPS, KonTraG, OECD-Prinzipien und die Arbeit der Herzog-Tietmeyer-Kommission, betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der deutschen Wirtschaftspolitik und den Auswirkungen der Globalisierung auf das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen „Modell Deutschland“, „Corporate Governance“, „Mitbestimmung“, „Internationalisierung“, „Shareholder Value“, „Stakeholder“, „Transparenz“, „Kontrolle“ und „TransPuG“.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Modell Deutschland"?
Es bezeichnet ein konsensbetontes System der sozialen Marktwirtschaft, geprägt durch Mitbestimmung, starke Banken und langfristige Investitionen.
Warum wandelt sich das Modell hin zur "Corporate Governance"?
Die wirtschaftliche Internationalisierung und Globalisierung zwingen deutsche Unternehmen zu mehr Transparenz und einer stärkeren Shareholder-Orientierung.
Was ist der Unterschied zwischen Stakeholder- und Shareholder-Orientierung?
Stakeholder-Orientierung berücksichtigt alle Interessengruppen (Mitarbeiter, Staat), während Shareholder-Orientierung den Fokus auf den Aktienwert und die Anteilseigner legt.
Was regelt das KonTraG?
Das "Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich" (KonTraG) zielt darauf ab, die Überwachung von Aktiengesellschaften zu verbessern und Risiken frühzeitig zu erkennen.
Wie beeinflusste die Fusion Mannesmann/Vodafone die deutsche Wirtschaft?
Dieser Fall gilt als Wendepunkt, der den Einfluss internationaler Kapitalmärkte auf traditionsreiche deutsche Unternehmen und den Wandel der Unternehmenskultur verdeutlichte.
- Citar trabajo
- Christian Wust (Autor), 2003, Vom "Modell Deutschland" zum "System der Corporate Governance", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18927