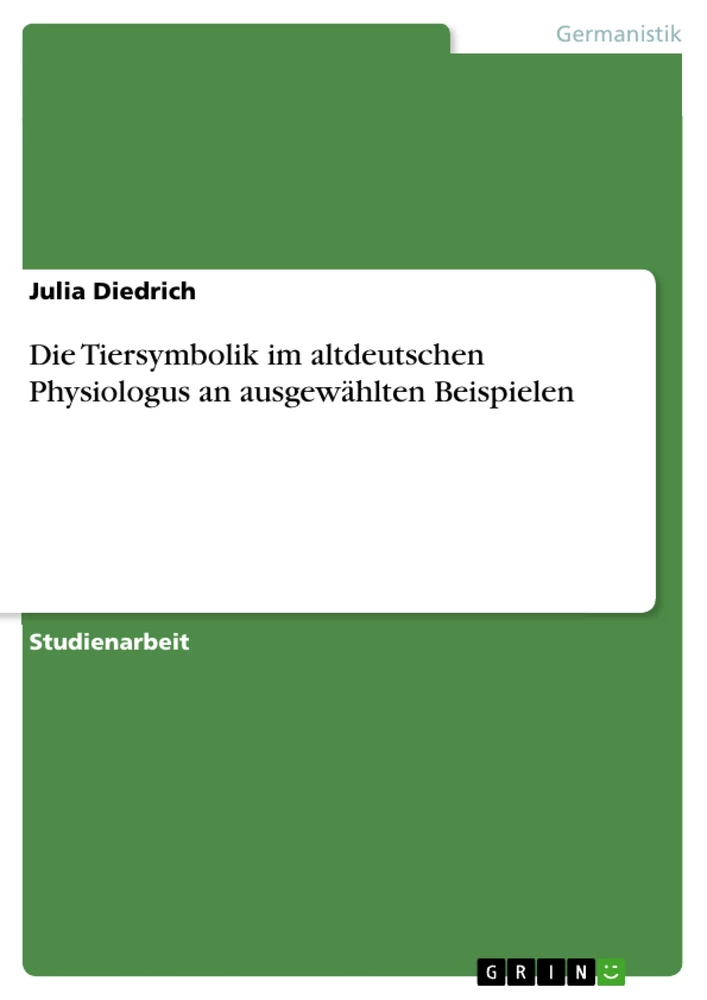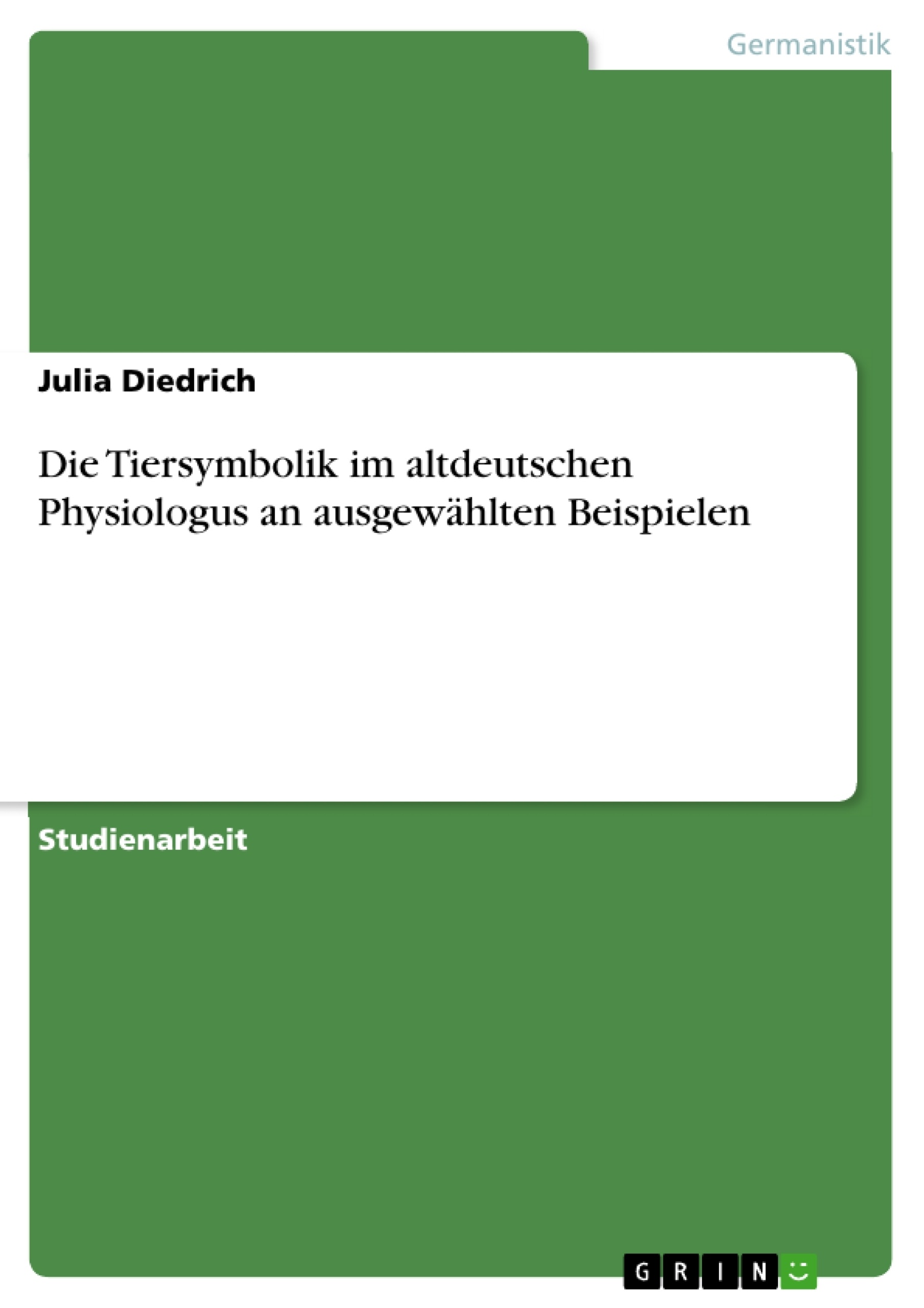Im Rahmen des Hauptseminars „Mittelalterliche Hermeneutik“ beschäftigten wir uns im Sommersemester 2008 mit dem Physiologus. „Der Ph[ysiologus] ist ein Zeugnis frühchr[istlicher]- m[ittel]a[lterlicher] Spiritualität, welche die geschaffene Natur als Kosmos von Zeichen verstand, durch die Gott zum Menschen spricht.“ Dieser Satz fasst jenes Werk zusammen, das im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht. Durch seine Wirkungsgeschichte, jahrhundertelange Weitergabe und reichhaltigen Handschriften hat diese Schrift eine Sonderstellung in der Geschichte der Literatur. Im Mittelalter hatte der Physiologus neben der Bibel einen sehr hohen Stellenwert und galt lange als Vorbild bei der geistlich-moralischen Exegese und Naturlehre. Die kleinen Geschichten wurden als „Berichte realer Naturgegebenheiten“ betrachtet und schon in der Spätantike wurden sie durch Augustin „als ‚unwahr‘ im naturwiss[enschaftlichem] Sinn erkannt“. Dies schränkte jedoch nicht Geltung des Physiologus ein. So behielt er lange seine Vormachtstellung als „‘Buch der Natur‘, in dem der Mensch die Offenbarung Gottes ‚lesen‘ kann“.
Die Bezeichnung Physiologus stammt von dem griechischen Wort , was Naturforscher oder Naturkundiger bedeutet. Was es aber genau bedeutet und wie dieses Werk beschaffen ist, soll in der folgenden Arbeit untersucht werden. Dafür wird zunächst über allgemeine Charakteristiken und die Entstehungsgeschichte des Physiologus informiert. Danach liegt der Fokus auf dem altdeutschen Physiologus, aber insbesondere auf der Millstätter Reimfassung, wie sie von Friedrich Maurer herausgegeben wurde. Diese ist auch Ausgangspunkt für die spätere Analyse der Tiere in dieser Arbeit. Jedoch sollen in einem weiteren Kapitel vorher noch die Grundlagen der Schriftsinne der mittelalterlichen Hermeneutik beleuchtet werden.
Den Abschluss bildet das fünfte Kapitel, das eine kurze Zusammenfassung dieser Arbeit geben wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Physiologus
- 2.1. Allgemeine Informationen und Entstehungsgeschichte
- 2.2. Der altdeutsche Physiologus
- 3. Der Vierfache Schriftsinn
- 3.1. Charakteristik und Funktionsweise der Schriftsinne
- 3.2. Bedeutung der Schriftsinne für den Physiologus
- 4. Tiersymbolik im altdeutschen Physiologus
- 4.1. Allgemeine Bemerkungen
- 4.2. „Lewe“ – Der Löwe
- 4.3. „Einhurn“ - Das Einhorn
- 4.4. „Helphant“ - Der Elefant
- 4.5. „Vipera“ – Die Schlange
- 4.6. „Piber“ - Der Biber
- 4.7. „Ar“ Der Adler
- 4.8. „Sisegoum“ - Der Pelikan
- 4.9. „Fenix“ - Der Phönix
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Tiersymbolik im altdeutschen Physiologus, insbesondere die Millstätter Reimfassung. Ziel ist es, die Bedeutung der Tiere im Kontext der mittelalterlichen Hermeneutik und des vierfachen Schriftsinns zu beleuchten.
- Der Physiologus als Zeugnis frühchristlich-mittelalterlicher Spiritualität
- Der vierfache Schriftsinn und seine Anwendung im Physiologus
- Symbolische Bedeutung ausgewählter Tiere
- Die Entstehungsgeschichte und Verbreitung des Physiologus
- Die naturwissenschaftliche und allegorische Ebene des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Physiologus als ein zentrales Werk frühchristlich-mittelalterlicher Spiritualität, welches die Natur als Kosmos von Zeichen versteht, durch die Gott zum Menschen spricht. Die Arbeit fokussiert auf den altdeutschen Physiologus, insbesondere die Millstätter Reimfassung, und untersucht dessen Bedeutung im Kontext der mittelalterlichen Hermeneutik. Die Methode beinhaltet die Analyse der Tiersymbolik unter Berücksichtigung des vierfachen Schriftsinns.
2. Der Physiologus: Dieses Kapitel beleuchtet allgemeine Informationen und die Entstehungsgeschichte des Physiologus. Es diskutiert die Frage nach dem Autor und Titel des Werkes, unterscheidet zwischen der naturwissenschaftlichen Grundlage und der hinzugefügten christlich-symbolischen Dimension. Die Debatte um den Entstehungsort (Alexandria) und -zeitraum (2. Jahrhundert) wird dargelegt, wobei verschiedene wissenschaftliche Positionen und deren Argumentationen berücksichtigt werden. Der Aufbau des Werkes mit seinen etwa 48 Kapiteln und der typischen Struktur der einzelnen Kapitel (naturgeschichtliche Information, Bibelstelle, typologische Deutung) wird beschrieben.
3. Der Vierfache Schriftsinn: Dieses Kapitel erläutert den vierfachen Schriftsinn der mittelalterlichen Hermeneutik – historisch, allegorisch, moralisch und anagogisch – und seine Funktionsweise. Es wird detailliert dargelegt, wie diese Schriftsinne im Physiologus angewendet werden, um die Texte auf mehreren Ebenen zu interpretieren und christliche Botschaften zu vermitteln. Die Bedeutung des vierfachen Schriftsinns für das Verständnis der Tiersymbolik im Physiologus wird hervorgehoben.
4. Tiersymbolik im altdeutschen Physiologus: Dieses Kapitel analysiert die symbolische Bedeutung ausgewählter Tiere im altdeutschen Physiologus, basierend auf der Millstätter Reimfassung. Es untersucht die einzelnen Tierbeschreibungen (Löwe, Einhorn, Elefant, Schlange, Biber, Adler, Pelikan, Phönix) im Detail, beleuchtet ihre jeweilige Symbolik und deutet deren Bedeutung im Kontext des christlichen Glaubens und der mittelalterlichen Weltanschauung. Die Analyse berücksichtigt die naturwissenschaftlichen Aspekte der Beschreibungen sowie ihre allegorische und moralische Interpretation.
Schlüsselwörter
Physiologus, Tiersymbolik, Mittelalterliche Hermeneutik, Vierfacher Schriftsinn, Altdeutsche Literatur, Millstätter Reimfassung, Christliche Symbolik, Allegorie, Typologie.
Häufig gestellte Fragen zum altdeutschen Physiologus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Tiersymbolik im altdeutschen Physiologus, insbesondere die Millstätter Reimfassung. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Tiere im Kontext der mittelalterlichen Hermeneutik und des vierfachen Schriftsinns.
Was ist der Physiologus?
Der Physiologus ist ein zentrales Werk frühchristlich-mittelalterlicher Spiritualität. Er versteht die Natur als einen Kosmos von Zeichen, durch die Gott zum Menschen spricht. Die Arbeit konzentriert sich auf die altdeutsche Version, speziell die Millstätter Reimfassung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Der Physiologus als Zeugnis frühchristlich-mittelalterlicher Spiritualität; der vierfache Schriftsinn und seine Anwendung im Physiologus; die symbolische Bedeutung ausgewählter Tiere; die Entstehungsgeschichte und Verbreitung des Physiologus; und die naturwissenschaftliche und allegorische Ebene des Textes.
Was ist der vierfache Schriftsinn?
Das Kapitel 3 erläutert den vierfachen Schriftsinn der mittelalterlichen Hermeneutik – historisch, allegorisch, moralisch und anagogisch – und seine Funktionsweise im Physiologus. Es zeigt, wie dieser Schriftsinn Texte auf mehreren Ebenen interpretiert und christliche Botschaften vermittelt.
Welche Tiere werden untersucht?
Kapitel 4 analysiert die symbolische Bedeutung folgender Tiere im altdeutschen Physiologus: Löwe, Einhorn, Elefant, Schlange, Biber, Adler, Pelikan und Phönix. Die Analyse berücksichtigt sowohl naturwissenschaftliche Aspekte als auch allegorische und moralische Interpretationen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert die Tiersymbolik unter Berücksichtigung des vierfachen Schriftsinns. Sie untersucht die einzelnen Tierbeschreibungen detailliert und deutet deren Bedeutung im Kontext des christlichen Glaubens und der mittelalterlichen Weltanschauung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der Tiere im Physiologus im Kontext der mittelalterlichen Hermeneutik und des vierfachen Schriftsinns zu beleuchten und den Physiologus als Zeugnis frühchristlich-mittelalterlicher Spiritualität zu verstehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Der Physiologus, Der Vierfache Schriftsinn, Tiersymbolik im altdeutschen Physiologus und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Untersuchung der jeweiligen Thematik.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel". Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die Inhalte jedes Kapitels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Physiologus, Tiersymbolik, Mittelalterliche Hermeneutik, Vierfacher Schriftsinn, Altdeutsche Literatur, Millstätter Reimfassung, Christliche Symbolik, Allegorie, Typologie.
- Quote paper
- Julia Diedrich (Author), 2009, Die Tiersymbolik im altdeutschen Physiologus an ausgewählten Beispielen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189304