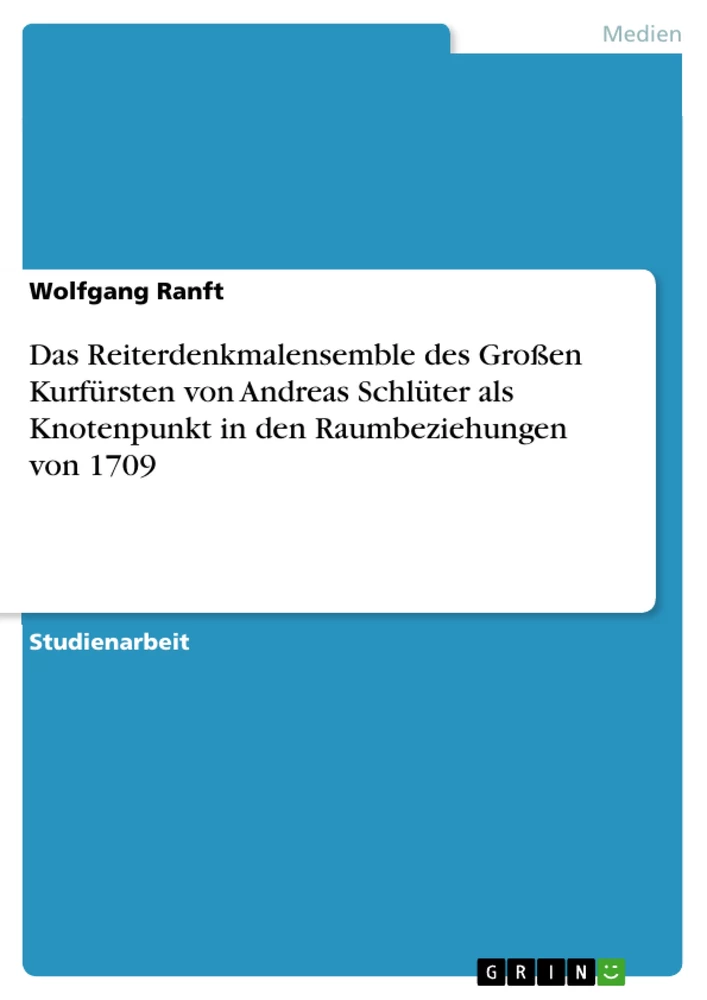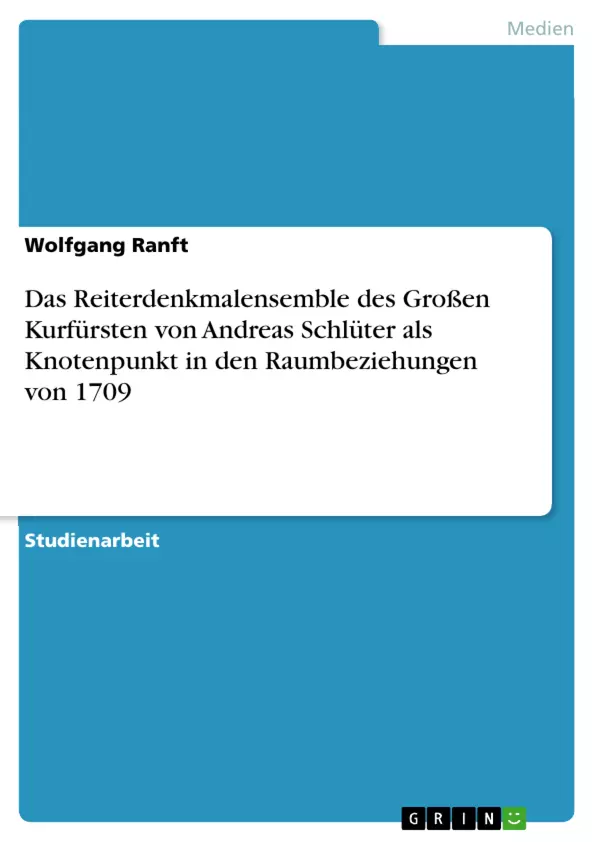Die Arbeit macht sich zur Aufgabe, das Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten als Knotenpunkt in der architektionsichen Umgebung von 1709 zu diskutieren. Dazu werden die Raumbezüge vor dem Hintergrund des historischen "Raumdenkens" untersucht. Dem Reiterdenkmal wird eine exponierte Sonderstellung zugeschrieben, die anhand der Raumbezüge hergeleitet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Die Entwicklung des Denkens vom Ort zum Raum
- Die Karte als Zeugnis des Raumdenkens: Der Memhard-Plan von 1652
- Die Raumbezüge des Denkmalensembles
- Der Große Kurfürst
- Pferd und Reiter
- Reiter, Pferd und Sockel
- Der Reiter mit Pferd, Sockel und Beifiguren
- Das Denkmalensemble und der „Brückenpfeiler“
- Das Denkmalensemble und die Brücke
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten als zentralen Punkt in der architektonischen Umgebung Berlins im Jahr 1709. Sie untersucht die Raumbezüge des Denkmals im Kontext des historischen "Raumdenkens", wobei der Schwerpunkt auf der exponierten Stellung des Denkmals liegt. Das Kunstwerk wird als Objekt und raumbildendes Element betrachtet, um es aus seiner Zeit heraus zu verstehen.
- Die Entwicklung des Raumdenkens vom "Ort" zum "Raum"
- Die Bedeutung des Memhard-Plans von 1652 für das Raumdenken
- Die Raumbezüge des Reiterdenkmals in Bezug auf seine Umgebung
- Die Rolle des Denkmals als Knotenpunkt im städtischen Raum
- Die Einordnung des Denkmals in die barocke Vorstellung vom Raum
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung des Raumdenkens, indem es die Ansichten von Foucault und de Certeau zum "Ort" und "Raum" heranzieht. Es stellt die Veränderung vom mittelalterlichen "Ortdenken" zum "Raumdenken" des 17. Jahrhunderts dar. Kapitel 2 untersucht den Memhard-Plan von 1652 als Zeugnis für die veränderte Gestaltung von Stadtplänen und die Entstehung eines synthetischen Raumverständnisses. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Raumbezüge des Reiterdenkmals selbst, indem es die einzelnen Elemente des Denkmalensembles - vom Großen Kurfürsten bis zur Brücke - in ihren räumlichen Beziehungen analysiert.
Schlüsselwörter
Das Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten, Raumdenken, Ortdenken, Memhard-Plan, barocker Raum, Raumbezüge, Stadtplanung, Architektur, Kunstwerk, Denkmalensemble, Lange Brücke, Berlin, Cölln, Raumverhältnisse, historische Beschreibungen, Foucault, de Certeau.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten für Berlin?
Das von Andreas Schlüter geschaffene Denkmal gilt als zentraler architektonischer Knotenpunkt, der die Raumbeziehungen der Stadt im frühen 18. Jahrhundert maßgeblich prägte.
Was versteht man unter dem Wandel vom „Ort“ zum „Raum“?
Die Arbeit beschreibt den historischen Übergang vom mittelalterlichen Denken in isolierten Orten hin zu einem barocken, synthetischen Raumverständnis des 17. Jahrhunderts.
Warum ist der Memhard-Plan von 1652 für diese Analyse wichtig?
Der Memhard-Plan dient als frühes Zeugnis für das veränderte Raumdenken in der Stadtplanung, das die Grundlage für die spätere Platzierung des Denkmals bildete.
Welche Elemente bilden das Denkmalensemble des Großen Kurfürsten?
Das Ensemble besteht aus der Reiterfigur des Kurfürsten, dem Pferd, dem kunstvollen Sockel mit Beifiguren sowie der räumlichen Einbindung auf der Langen Brücke.
Welche Theoretiker werden zur Erklärung des Raumbegriffs herangezogen?
Die Arbeit nutzt Konzepte von Michel Foucault und Michel de Certeau, um die Unterschiede zwischen physischem Ort und sozial konstruiertem Raum zu verdeutlichen.
Wie fungiert das Denkmal als raumbildendes Element?
Durch seine exponierte Stellung auf dem Brückenpfeiler verbindet es die Stadtteile Berlin und Cölln und schafft neue Sichtachsen und räumliche Hierarchien.
- Citar trabajo
- Wolfgang Ranft (Autor), 2010, Das Reiterdenkmalensemble des Großen Kurfürsten von Andreas Schlüter als Knotenpunkt in den Raumbeziehungen von 1709, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189350