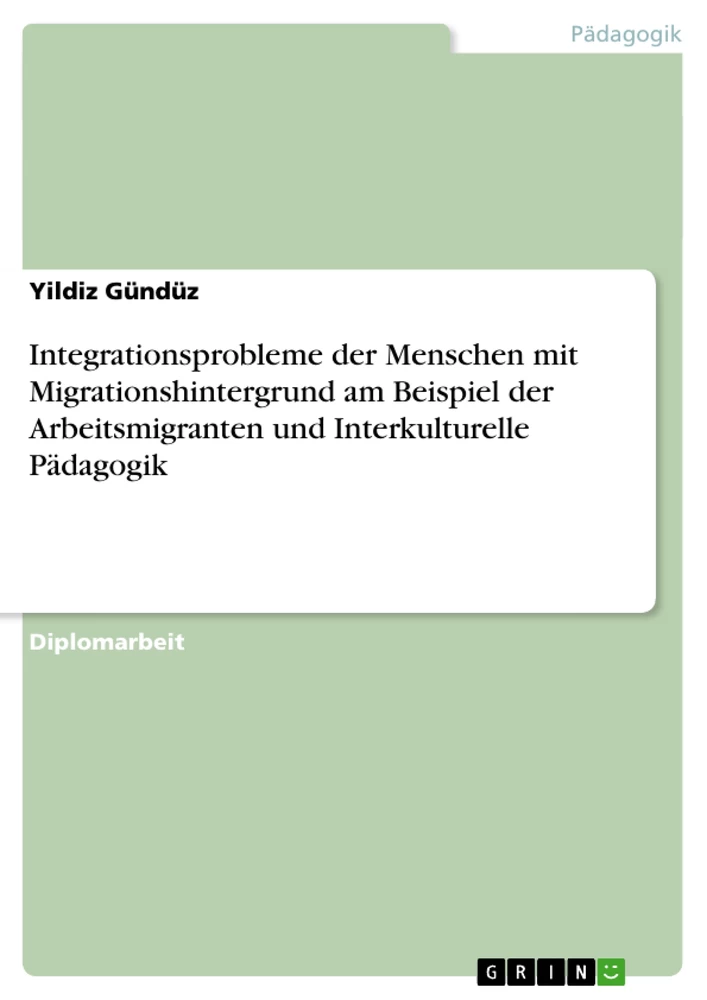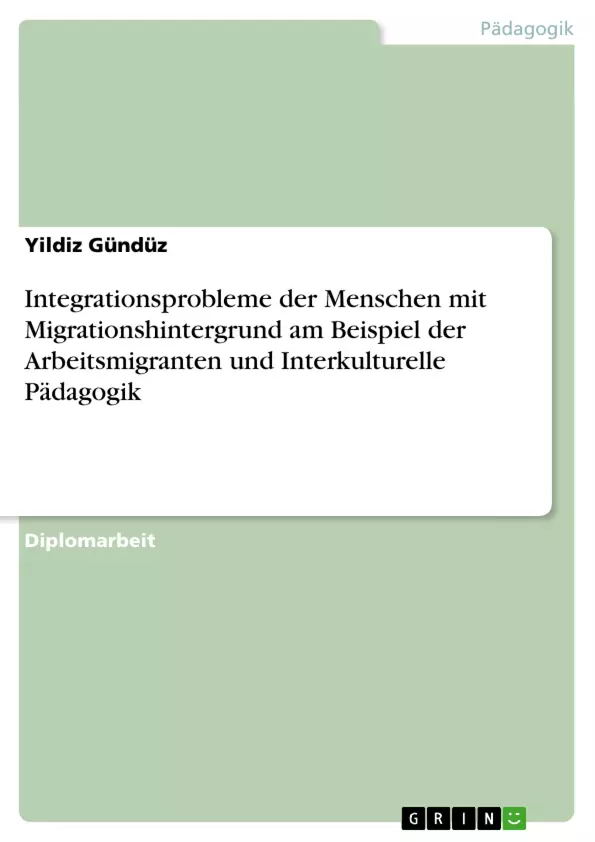Die Welt ist innerhalb der letzten Jahrzehnte zu einem Ganzen zusammengewachsen. Im Zuge der Globalisierung, der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Verpflechtung hat sich die Welt zu einem globalen Dorf entwickelt. Überall auf der Welt treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Im Laufe der Kulturentwicklung haben das Aufeinandertreffen und der Austausch zwischen Kulturen an großer Bedeutung gewonnen. Das Interkulturelle wurde nach und nach zur eigenen Kultur mit eingebaut und wurde somit zum Kulturbestandteil. Jedoch können unterschiedliche Weltansichten das Handeln und Verstehen dieser Interaktionspartner in deutlichem Maße erschweren. Das Stattfinden einer erfolgreichen interkulturellen Kommunikation ist also von der gegenseitigen Toleranz und Akzeptanz abhängig. Vielfalt braucht und voraussetzt nämlich Toleranz. Nur so ist ein friedliches Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft möglich.
Multikulturelle Gesellschaften sind durch den Prozess der Ein- und Auswanderungen entstanden. Weltweit sind Millionen von Menschen von der Migration betroffen.
Auch Deutschland ist von Wanderungsbewegungen betroffen. Die Integration der Migranten und deren Nachkommen, die einerseits an Traditionen aus dem Heimatland festhalten wollen und andererseits mit Misstrauen und Vorurteilen von der ihnen fremden Aufnahmegesellschaft begegnen, ist mit besonderen Problemen verbunden. Außergewöhnliche Sitten und Gebräuche, Kultur, soziale Standards und vielleicht auch religiöse Ansichten warten auf sie. Aus diesem Hintergrund wurden, um das Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Herkunft zu fördern, pädagogische Ansätze konstruiert. Das neue Bildungskonzept, das auf diese neu definierte gesellschaftliche Lage reagieren soll, wurde „Interkulturelle Erziehung“ genannt.
Ziel dieser Arbeit wird deshalb nicht nur sein, die Integrationsprobleme der Arbeitermigranten aus jedem Blickwinkel zu beleuchten, sondern werden auch die Förderung der Beziehungen unterschiedlicher Kulturen aufeinander und die Beseitigung von Hindernissen durch die Interkulturelle Erziehung ausführlich behandelt.
Insgesamt sollen durch die vorliegende Arbeit folgende Fragen beantwortet werden: Welche Hauptproblemfaktoren gibt es bei der Integration von Migranten und kann die interkulturelle Pädagogik ein Instrumentarium zur Lösung dieser Probleme sein?
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einführung
- 2. Die Migration und ihre begriffliche Bedeutung
- 2.1 Deutschland als Einwanderungsland
- 2.2 Die Geschichte der Entwicklung der Arbeitsmigranten in Deutschland seit den 1950er Jahren bis zum Anwerbestopp
- 2.3 Push- und Pull-Faktoren
- 3. Integration
- 3.1 Aktuelle Debatten um die Integration von Migranten
- 3.2 Integration gleich Assimilation?
- 3.2.1 Systemintegration und Sozialintegration
- 3.2.2 Generationsunterschiede und Freundschaftswahlen
- 4. Wohnsituation
- 4.1 Die Wohnbedingungen der Migranten
- 4.2 Segregation im Wohnbereich
- 4.3 Ursachen für ethnische Konzentration in Städten
- 4.3.1 Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt?
- 4.3.2 Bedeutung ethnischer Konzentration für interethnische Kontakte
- 5. Sprache als der Schlüssel zur Integration
- 5.1 Was ist Sprache?
- 5.2 Zwei- und Mehrsprachigkeit
- 5.3 Doppelte Halbsprachigkeit
- 5.3.1 Interferenzen
- 5.3.2 Code-Switching
- 5.3.3 Code-Mixing
- 5.4 Einfluss der Massenmedien auf Sprache und Integration
- 6. Der Umgang mit dem Fremden
- 6.1 Ausländerfeindlichkeit und Rassismus als hemmende Integrationsfaktoren?
- 6.1.1 Ursachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- 6.1.2 Der Konflikt der Kulturen
- 6.1.3 Unterschiedliche Religionen
- 6.2 Die Rolle der Frau in ausländischen Familien
- 6.1 Ausländerfeindlichkeit und Rassismus als hemmende Integrationsfaktoren?
- 7. Bildungsungleichheit und Arbeitslosigkeit
- 7.1 Bildungsbenachteiligungen
- 7.1.1 Deutsche Sprachkenntnisse
- 7.1.2 Sozioökonomischer Status und Bildungskapital
- 7.1.3 Indirekte institutionelle Diskriminierung
- 7.2 Fehlende Schulabschlüsse und Arbeitslosigkeit
- 7.1 Bildungsbenachteiligungen
- 8. Von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik
- 8.1 Begriffsklärung
- 8.2 Ausländerpädagogik
- 8.3 Was ist interkulturelle Pädagogik?
- 8.3.1 Interkulturelle Bildung als soziales Lernen
- 8.3.2 Interkulturelle Bildung als „antirassistische Bildung"
- 8.3.3 Interkulturelles Lernen als Hilfe zur Identitätsbildung
- 8.4 Zehn Ziele der interkulturellen Pädagogik nach Nieke
- 8.5 Kritik an interkultureller Pädagogik
- 9. Forschungsteil
- 9.1 Der Fragebogen
- 9.2 Ziel und Zielgruppe der Forschung
- 9.3 Aufbau des Fragebogens
- 9.4 Durchführung der Befragung
- 9.5 Auswertung der Fragebögen
- 10. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit setzt sich zum Ziel, die Integrationsprobleme von Menschen mit Migrationshintergrund am Beispiel von Arbeitsmigranten zu beleuchten und den Zusammenhang zur interkulturellen Pädagogik zu untersuchen. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die Arbeitsmigranten im deutschen Kontext im Hinblick auf Sprache, Bildung, Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe erfahren.
- Migrationsgeschichte und Einwanderungspolitik in Deutschland
- Herausforderungen der Integration von Migranten, insbesondere Arbeitsmigranten
- Integration und die Rolle von Sprache, Bildung und Wohnen
- Diskriminierungserfahrungen von Migranten in verschiedenen Bereichen
- Die Bedeutung interkultureller Pädagogik für die Integration von Migrantenkindern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Dieses Kapitel beleuchtet die Migration und ihre begriffliche Bedeutung, wobei der Fokus auf Deutschland als Einwanderungsland liegt. Die Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland seit den 1950er Jahren bis zum Anwerbestopp wird dargestellt. Push- und Pull-Faktoren, die Menschen zur Migration motivieren, werden ebenfalls untersucht.
Kapitel 3: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema Integration. Aktuelle Debatten um die Integration von Migranten werden aufgezeigt und verschiedene Integrationskonzepte, wie Systemintegration und Sozialintegration, erläutert. Zudem werden Generationsunterschiede und die Rolle von Freundschaftswahlen in Bezug auf Integration beleuchtet.
Kapitel 4: Dieses Kapitel analysiert die Wohnsituation von Migranten und thematisiert die Herausforderungen, die mit der Suche nach Wohnraum verbunden sind. Segregation im Wohnbereich und die Ursachen für ethnische Konzentration in Städten werden untersucht. Die Bedeutung von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und der Einfluss ethnischer Konzentration auf interethnische Kontakte werden beleuchtet.
Kapitel 5: Dieses Kapitel betrachtet die Sprache als Schlüssel zur Integration. Die Bedeutung von Sprache für die soziale Teilhabe und die Herausforderungen, die durch Zwei- und Mehrsprachigkeit entstehen, werden erläutert. Das Phänomen der "doppelten Halbsprachigkeit" und die damit verbundenen Interferenzen, Code-Switching und Code-Mixing werden untersucht. Der Einfluss der Massenmedien auf Sprache und Integration wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 6: Dieses Kapitel behandelt den Umgang mit dem Fremden und die Herausforderungen, die mit Ausländerfeindlichkeit und Rassismus verbunden sind. Ursachen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden untersucht, und der Konflikt der Kulturen sowie die Rolle unterschiedlicher Religionen werden in Bezug auf Integration beleuchtet. Die Rolle der Frau in ausländischen Familien wird ebenfalls betrachtet.
Kapitel 7: Dieses Kapitel untersucht die Problematik von Bildungsungleichheit und Arbeitslosigkeit bei Migranten. Bildungsbenachteiligungen, die mit Sprachkenntnissen, sozioökonomischem Status und Bildungskapital zusammenhängen, werden analysiert. Der Einfluss indirekter institutioneller Diskriminierung und das Problem fehlender Schulabschlüsse werden ebenfalls behandelt.
Kapitel 8: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung der Pädagogik in Bezug auf Migranten, von der Ausländerpädagogik zur interkulturellen Pädagogik. Die Begriffe werden geklärt, und es wird erläutert, was unter interkultureller Pädagogik zu verstehen ist. Die Bedeutung interkultureller Bildung als soziales Lernen und als "antirassistische Bildung" wird hervorgehoben. Interkulturelles Lernen als Hilfe zur Identitätsbildung sowie die zehn Ziele der interkulturellen Pädagogik nach Nieke werden vorgestellt. Kritische Punkte der interkulturellen Pädagogik werden ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Migration, Integration, Arbeitsmigranten, interkulturelle Pädagogik, Sprache, Bildung, Wohnen, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Diskriminierung, Bildungsungleichheit, Arbeitslosigkeit, sozioökonomischer Status, Bildungskapital, Identitätsbildung, und interkulturelles Lernen. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptprobleme bei der Integration von Arbeitsmigranten?
Zentrale Hürden sind Sprachbarrieren, Bildungsbenachteiligung, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt sowie soziale Ausgrenzung und Rassismus.
Was versteht man unter „Interkultureller Pädagogik“?
Es ist ein Bildungskonzept, das auf Vielfalt mit Toleranz und Akzeptanz reagiert und durch soziales Lernen Vorurteile abbauen sowie die Identitätsbildung in einer multikulturellen Gesellschaft fördern will.
Warum wird Sprache als Schlüssel zur Integration bezeichnet?
Sprache ermöglicht die soziale Teilhabe. Probleme wie „doppelte Halbsprachigkeit“ können die Integration erschweren, während Mehrsprachigkeit eine wertvolle Ressource darstellt.
Was sind Push- und Pull-Faktoren in der Migration?
Push-Faktoren sind Gründe, die Menschen aus ihrer Heimat vertreiben (z.B. Armut), während Pull-Faktoren die Anziehungspunkte des Ziellandes beschreiben (z.B. Arbeitsplätze).
Wie unterscheidet sich Integration von Assimilation?
Während Assimilation die vollständige Anpassung an die Aufnahmegesellschaft fordert, zielt Integration auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben unter Wahrung kultureller Identitäten ab.
- Citation du texte
- Yildiz Gündüz (Auteur), 2011, Integrationsprobleme der Menschen mit Migrationshintergrund am Beispiel der Arbeitsmigranten und Interkulturelle Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189537