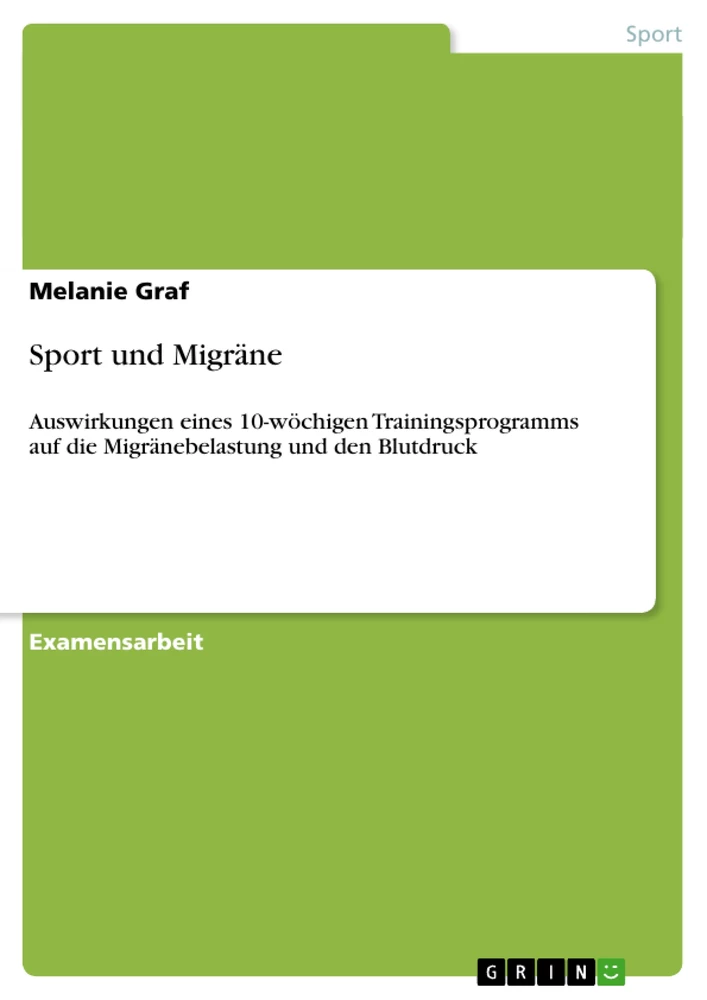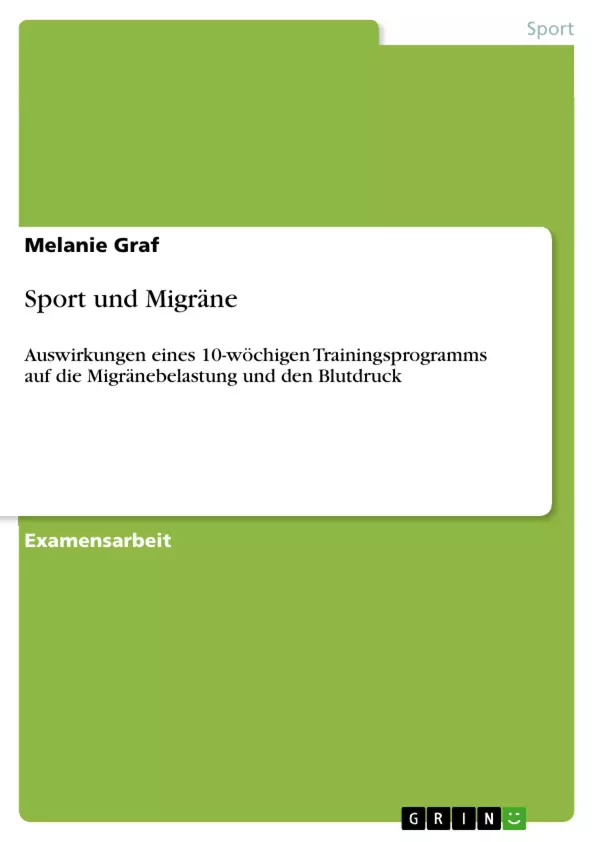Die Migräne ist seit tausenden von Jahren bekannt. Auf einer ägyptischen Papyrusrolle 2000 vor Christi Geburt, in der Apostelgeschichte 9:1-9 des alten Testaments oder in den Schriften von Hildegard von Bingen fanden sich Hinweise auf eine migränöse Erkrankung. Seither sind zahlreiche Therapieversuche unternommen worden, die vom Aderlass über Stromschläge, bis hin zur Schädelöffnung führte. Ein optimale Lösung ist bis dato nicht gefunden worden und aus diesem Grund wird bis in die heutige Zeit wird immer noch nach der effektivsten Methode geforscht. Göbel, Petersen-Braun und Soyka (1993) gaben an, dass 71% zeitweise unter Kopfschmerzen zu leiden. Das machte damals auf die Gesamtbevölkerung Deutschlands hochgerechnet 54 Millionen Menschen aus. Laut Schätzungen leiden 2-6% der Gesamtbevölkerung unter Migräne (Göbel, 2004a). Die deutsche Migräneliga spricht von 8 Millionen Bundesbürgern (Neubauer & Ujlaky, 2002). Viele wissen jedoch nicht um ihre Krankheit, da sie sich oft selbst falsch diagnostizieren und eine ärztliche Konsultation nicht in Betracht ziehen. Menschlich betrachtet schränkt die Migräne den Betroffenen in seinem Alltag sehr ein. Sie werden nicht nur während einer Attacke in ihrem normalen Alltagsleben gestört und erleiden Schmerzen, sondern bewegen sich in ihrem Arbeits- und sozialem Umfeld anders. Die Migräne steht gemäß der WHO auf dem 19. Rang der Erkrankung, die eine Behinderung bewirken (Göbel, 2004a). Ragonesi (2007) beschreibt einige Studien, die bei bis zu 56% genannte Einschränkungen belegen. Sie können sich weniger um ihre Kinder kümmern, sind sich oft uneinig mit dem Partner, was zusätzlichen Stress erzeugt. Die von Jane Osterhaus et al. (1994) durchgeführte Studie zeigt bei den Migränikern zusätzlich signifikant niedrigere Werte hinsichtlich der Lebensqualität, als bei den anderen Krankheiten (siehe Abbildung 1). Sie zeigt eine Übersicht zur Lebensqualität von Menschen mit Migräne, solche mit koronarer Herzkrankheit und Diabetes mellitus im Vergleich zu gesunden Menschen. Die Werte beziehen sich ebenso auf anfallsfreie Intervalle.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Migräne
- 2.1.1 Begriffliche Klärung und Epidemiologie
- 2.1.2 Klassifikation und klinisches Bild
- 2.1.3 Phasen der Migräne und klinisches Bild
- 2.1.4 Ätiologie der Migräne
- 2.1.4.1 Biophysiologische Ansätze
- 2.1.4.2 Psychologische Ansätze
- 2.1.4.3 Genetische Prädisposition
- 2.1.5 Triggerfaktoren
- 2.1.6 Integration der Theorien
- 2.1.7 Komorbidität
- 2.1.8 Behandlungsformen der Migräne
- 2.1.8.1 Medikamentöse Therapie
- 2.1.8.2 Nichtmedikamentöse Therapie
- 2.2 Der Blutdruck
- 2.2.1 Die Physiologie des Blutdrucks
- 2.2.2 Die Erfassung des Blutdrucks
- 2.2.2.1 Die Blutdruckmesswerte
- 2.2.3 Die Pathophysiologie des Blutdrucks
- 2.3 Sport
- 2.3.1 Ausdauer
- 2.3.1.1 Formen der Ausdauer
- 2.3.2 Das Ausdauertraining im Gesundheitsbereich
- 2.3.2.1 Die Quantifizierung des Ausdauertrainings
- 2.3.2.2 Anpassungsvorgänge durch Ausdauertraining
- 2.3.2.3 Zwei Ausdauersportarten im Vergleich
- 2.3.3 Sport und Blutdruck
- 2.3.1 Ausdauer
- 2.4 Aktuelle Studien
- 2.4.1 Derzeitiger Forschungsstand zur Rolle von Sport auf Migräne
- 2.4.2 Derzeitiger Forschungsstand zu Migräne und Blutdruck
- 2.1 Migräne
- 3 Methode
- 3.1 Fragestellung der Untersuchung
- 3.1.1 Fragestellung A
- 3.1.2 Fragestellung B
- 3.2 Formulierung der Hypothesen
- 3.2.1 Hypothesen zur Fragestellung A
- 3.2.2 Hypothesen zur Fragestellung B
- 3.3 Das Untersuchungsdesign
- 3.4 Die Untersuchungspersonen
- 3.4.1 Die Interventionsgruppen
- 3.4.2 Einteilung in die Blutdruckklassen BK 1 und BK 2
- 3.5 Untersuchungsplan und Untersuchungsablauf
- 3.6 Datenerhebung
- 3.6.1 Erhebung der Physical Working Capacity
- 3.6.1.1 Testvorbereitungen
- 3.6.1.2 Testablauf
- 3.6.1.3 Testbewertung
- 3.6.1.4 Störvariablen
- 3.6.2 Trainingsintensität
- 3.6.3 Erfassung der Schmerzcharakteristik
- 3.6.4 Erhebung des arteriellen Blutdrucks
- 3.6.4.1 Störvariablen
- 3.6.1 Erhebung der Physical Working Capacity
- 3.1 Fragestellung der Untersuchung
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Methoden der Datenauswertung
- 4.2 Ergebnisdarstellung
- 4.2.1 Prüfung der A-Hypothesen
- 4.2.2 Prüfung der B-Hypothesen
- 5 Diskussion der Ergebnisse
- 5.1 Diskussion zur methodischen Vorgehensweise
- 5.1.1 Angemessenheit der Fragestellungen
- 5.1.2 Betrachtung des Studiendesigns
- 5.1.3 Betrachtung der Probandenzahl
- 5.1.4 Diskussion der Interventionsphase
- 5.1.5 Angemessenheit des Datenerhebungsverfahrens
- 5.1.5.1 Leistungsdiagnostischer Test
- 5.1.5.2 Die Erfassung der Schmerzcharakteristik
- 5.1.5.3 Die Erfassung der Blutdruckwerte
- 5.1 Diskussion zur methodischen Vorgehensweise
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Untersuchung des Einflusses eines 10-wöchigen aeroben Ausdauertrainings auf den Blutdruck und die Migränebelastung bei Migränepatienten. Es soll geklärt werden, ob ein Zusammenhang zwischen Blutdruckänderung und der Veränderung der Schmerzcharakteristik besteht.
- Einfluss von Ausdauertraining auf den Blutdruck bei Migränepatienten
- Zusammenhang zwischen Trainingsintensität und Blutdruckänderung
- Beziehung zwischen Blutdruckänderung und Schmerzcharakteristik (Intensität, Dauer, Häufigkeit) der Migräne
- Optimale Trainingsintensität für Migränepatienten
- Eignung von Ausdauertraining als Therapieoption für Migräne
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die historische Bedeutung der Migräne, deren Verbreitung und die damit verbundenen Auswirkungen auf das menschliche Leben (physisch, psychisch, ökonomisch). Sie hebt die Notwendigkeit der Forschung nach effektiven, nicht-medikamentösen Therapiemethoden hervor, besonders im Hinblick auf den hohen Anteil an Patienten mit Therapieversagen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des positiven Effekts von Sport auf die Migräne und die mögliche Rolle des Blutdrucks.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Migräne, Blutdruck und Sport. Es beschreibt die verschiedenen Arten von Migräne, deren Klassifizierung, Ätiologie (biologische und psychologische Ansätze), Triggerfaktoren und Behandlungsmöglichkeiten (medikamentös und nicht-medikamentös). Der Abschnitt über Blutdruck behandelt dessen Physiologie, Messung und Pathophysiologie. Der Sportteil konzentriert sich auf Ausdauertraining, dessen Quantifizierung und Anpassungsvorgänge im Körper, mit besonderem Fokus auf Jogging und Walking. Schließlich werden aktuelle Studien zu Sport und Migräne, sowie Migräne und Blutdruck kritisch diskutiert.
3 Methode: Dieses Kapitel detailliert die Methodik der Studie. Die Fragestellungen, Hypothesen und das Untersuchungsdesign werden erläutert. Es beschreibt die Auswahl und Zusammensetzung der Probandengruppen (Jogging- und Walkinggruppe), die Einteilung in Blutdruckklassen, den Ablauf des PWC150-Tests und die Erhebungsmethoden für Blutdruck und Schmerzcharakteristik. Die Kapitel beschreibt auch die Störvariablen und deren Berücksichtigung.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der statistischen Auswertung. Es beschreibt die angewandten statistischen Methoden (t-Tests, Korrelationen) und deren Voraussetzungen. Die Ergebnisse zur Prüfung der Hypothesen A und B werden detailliert dargestellt und grafisch illustriert. Die Ergebnisse beinhalten Daten zur Blutdruckänderung in den verschiedenen Gruppen und den Zusammenhang mit der Schmerzcharakteristik.
5 Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse im Kontext der methodischen Vorgehensweise. Es analysiert die Stärken und Schwächen des Studiendesigns, die Probandenzahl, die Interventionsphase und die Datenerhebungsverfahren. Die möglichen Einflussfaktoren und Fehlerquellen werden kritisch betrachtet und die Ergebnisse im Lichte dieser Limitationen interpretiert.
Schlüsselwörter
Migräne, Blutdruck, Ausdauertraining, Jogging, Walking, Schmerzcharakteristik, PWC150, Herzfrequenz, Intervention, Quasiexperimentelles Design, Komorbidität, Therapie, Prophylaxe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Einfluss von Ausdauertraining auf Blutdruck und Migräne
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht den Einfluss eines 10-wöchigen aeroben Ausdauertrainings (Jogging und Walking) auf den Blutdruck und die Migränebelastung bei Migränepatienten. Ein zentrales Forschungsinteresse liegt im Zusammenhang zwischen Blutdruckänderung und Veränderungen der Schmerzcharakteristik (Intensität, Dauer, Häufigkeit).
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, herauszufinden, ob Ausdauertraining den Blutdruck bei Migränepatienten beeinflusst, ob ein Zusammenhang zwischen Trainingsintensität und Blutdruckänderung besteht und wie sich die Blutdruckänderung auf die Schmerzcharakteristik der Migräne auswirkt. Weiterhin soll die optimale Trainingsintensität für Migränepatienten und die Eignung von Ausdauertraining als Therapieoption untersucht werden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Methode, Ergebnisse, Diskussion der Ergebnisse und Zusammenfassung und Ausblick. Der theoretische Hintergrund behandelt umfassend Migräne, Blutdruck und Ausdauertraining, inklusive aktueller Forschungsergebnisse. Die Methodenbeschreibung detailliert das Studiendesign, die Probandenauswahl, die Datenerhebung (inkl. PWC150-Test) und die statistischen Verfahren. Die Ergebnisse werden präsentiert und im Kontext der methodischen Vorgehensweise diskutiert. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie verwendet ein quasiexperimentelles Design. Die Probanden wurden in Jogging- und Walkinggruppen eingeteilt und mittels PWC150-Test untersucht. Die Datenerhebung umfasste die Erfassung der Schmerzcharakteristik, des Blutdrucks und der Trainingsintensität. Zur statistischen Auswertung wurden t-Tests und Korrelationen eingesetzt. Die Studie berücksichtigt auch Störvariablen und deren Einfluss.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der statistischen Auswertung (t-Tests, Korrelationen) zur Prüfung der aufgestellten Hypothesen (A und B) werden detailliert im Kapitel "Ergebnisse" dargestellt und grafisch illustriert. Die Ergebnisse beinhalten Daten zur Blutdruckänderung in den verschiedenen Gruppen und deren Zusammenhang mit der Schmerzcharakteristik der Migräne.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Diskussion der Ergebnisse analysiert die Stärken und Schwächen des Studiendesigns, die Probandenzahl, die Interventionsphase und die Datenerhebungsverfahren. Mögliche Einflussfaktoren und Fehlerquellen werden kritisch betrachtet, um die Ergebnisse im Lichte dieser Limitationen zu interpretieren. Die Angemessenheit der Fragestellungen, des Studiendesigns, der Probandenzahl, der Interventionsphase und des Datenerhebungsverfahrens (inkl. PWC150-Test, Schmerzcharakteristik und Blutdruckmessung) wird detailliert beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Migräne, Blutdruck, Ausdauertraining, Jogging, Walking, Schmerzcharakteristik, PWC150, Herzfrequenz, Intervention, Quasiexperimentelles Design, Komorbidität, Therapie, Prophylaxe.
- Citar trabajo
- Melanie Graf (Autor), 2011, Sport und Migräne, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189852