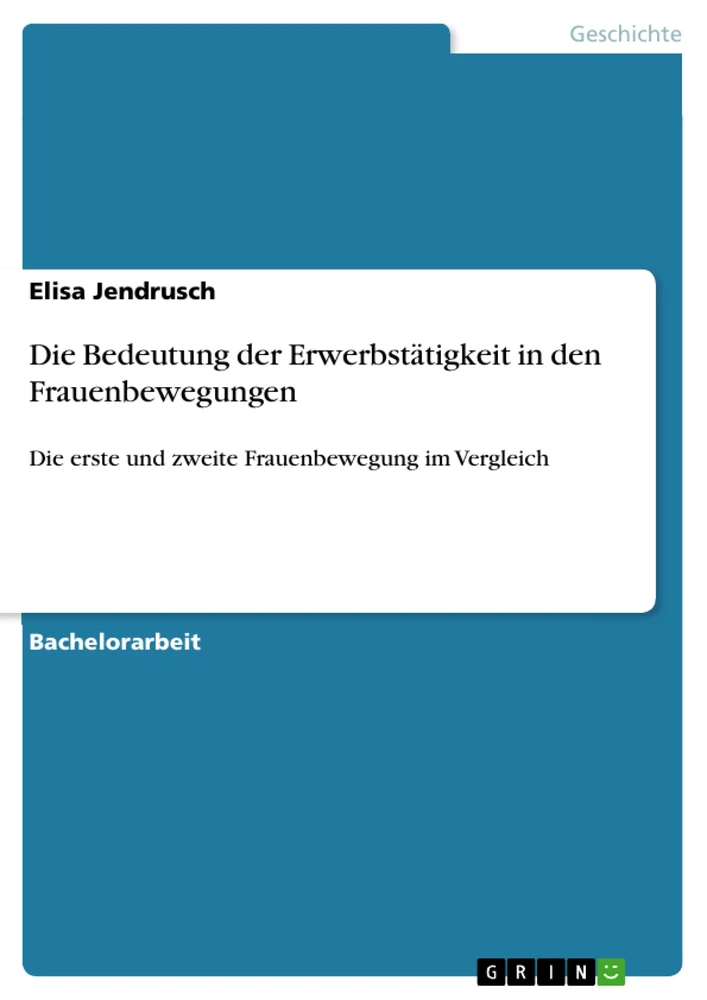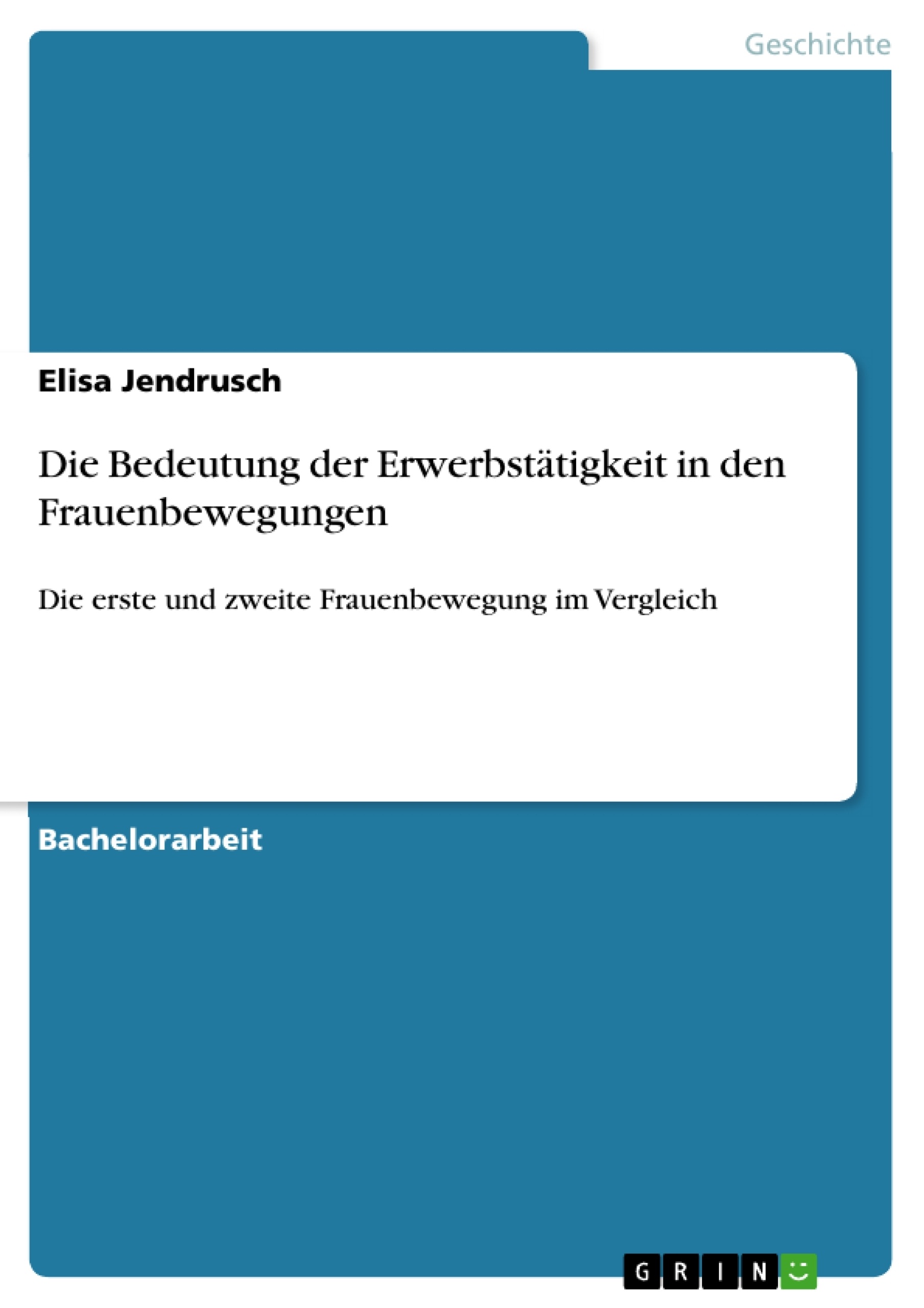Linnhoff merkt in ihrer Arbeit an, dass sich „Diskriminierung und Benachteiligung von Frauen wie ein roter Faden durch die Geschichte“ ziehen. So fingen am Ende des 18.Jahrhunderts Frauen allmählich an sich gegen ihre geschlechtsbedingte Benachteiligungen aufzulehnen. Die wichtigsten Anstöße erhielten sie von der Französischen Revolution und durch die Aufbruchsstimmung der europäischen Revolution 1848/49. Die Frauenbewegung in Europa war größtenteils bis Anfang des 20. Jahrhunderts kämpferisch und wollte die rechtliche sowie politische Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Sowohl die erste deutsche Frauenbewegung im 19. Jahrhundert als auch die zweite, welche knapp ein Jahrhundert später entstand, bezogen ihre Forderungen und Initiativen auf viele Lebensbereiche wie die Bildungs- und Wohlfahrtspolitik oder die Jugendarbeit. Aber auch die Erwerbstätigkeit der Frau verkörperte eine wichtige Thematik in beiden Bewegungen: Am Ende der 1980er Jahre gab es kaum eine Frau, die sich nicht in einer Weise mit dem Gedanken an die Beruftätigkeit befasste.
Es muss allerdings beachtet werden, dass die Frauenbewegungen und ihre Interessen nicht für alle Frauen sprechen. Denn es gab auch Frauen, die das bestehende gesellschaftliche Bild unterstützten und sich gegen die sogenannte Emanzipation richteten. Die zunehmende weibliche Bildungsbeteiligung und Erwerbstätigkeit hatte nämlich gleichzeitig in allen Alters- und Familienstandsgruppen die traditionellen Vorstellungen einer „natürlichen Funktionsteilung“ immer weiter durchlöchert. Die weibliche Individualisierung führte außerdem über die außerhäusliche weibliche Erwerbtätigkeit nach Ansichten von Kritikern zur Auflösung der Familie.
Doch was wird unter Erwerbstätigkeit verstanden? Das Statistische Bundesamt definiert sie im Rahmen von volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen folgendermaßen: „Erwerbstätige sind alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, geringfügig Beschäftigte, Soldaten) oder Selbstständige beziehungsweise mithelfende Familienangehörige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben [...].“ Auffällig ist bei dieser Definition, dass sie sich explizit an die Männer richtet, denn die weibliche Anredeform bleibt aus. Können Frauen somit nicht erwerbstätig sein? Fällt die Hausarbeit nicht unter die Kategorie der Berufstätigkeit und muss somit erst durch Löhne aufgewertet werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die erste Frauenbewegung und ihre Stellung zur Erwerbstätigkeit
- 2.1 Historischer Umriss der ersten Frauenbewegung
- 2.2 Positionen zur Erwerbstätigkeit
- 2.2.1 Die einzelnen Gruppierungen
- 2.3 Erfolge der Bewegung
- 3. Die zweite Frauenbewegung und ihre Stellung zur Erwerbstätigkeit
- 3.1 Historischer Umriss der zweiten Frauenbewegung
- 3.2 Positionen zur Erwerbstätigkeit
- 3.2.1 Tagung in Rehburg Loccum
- 3.2.2 Die einzelnen Gruppierungen
- 3.2.3 Die Alternative: HausArbeit
- 3.3 Erfolge der Bewegung
- 4. Vergleich der Positionen der beiden Frauenbewegungen
- 4.1 Gemeinsamkeiten
- 4.2 Unterschiede
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Erwerbstätigkeit in den deutschen Frauenbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Haltungen beider Bewegungen zur weiblichen Berufstätigkeit zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Dabei soll die Frage geklärt werden, inwiefern die Erwerbstätigkeit als ein entscheidendes Element für die Durchsetzung von Gleichberechtigung angesehen wurde.
- Historischer Kontext der ersten und zweiten Frauenbewegung in Deutschland
- Positionen der Frauenbewegungen zur Erwerbstätigkeit und ihren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Rollenverteilung
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Forderungen und Strategien der beiden Bewegungen
- Bedeutung der Erwerbstätigkeit für die weibliche Selbstbestimmung und Emanzipation
- Analyse des gesellschaftlichen Umfelds und der Herausforderungen, denen die Frauenbewegungen in Bezug auf die Erwerbstätigkeit begegneten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Hintergrund der Frauenbewegung dar und führt den Leser in die Thematik der Erwerbstätigkeit in den Frauenbewegungen ein. Sie beleuchtet die gesellschaftlichen Diskurse rund um die weibliche Arbeitswelt und die Bedeutung der Erwerbstätigkeit für die Gleichstellung der Geschlechter. Das zweite Kapitel befasst sich mit der ersten deutschen Frauenbewegung und ihren Positionen zur Erwerbstätigkeit. Es werden die historischen Wurzeln der Bewegung, ihre wichtigsten Gruppierungen und deren Ansichten zur weiblichen Berufstätigkeit sowie die erzielten Erfolge der Bewegung beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der zweiten deutschen Frauenbewegung. Es werden die historischen Entwicklungen der Bewegung, ihre unterschiedlichen Positionen zur Erwerbstätigkeit, die Diskussionen um die Alternative "HausArbeit" und die erreichten Erfolge der Bewegung analysiert. Im vierten Kapitel werden die Positionen der beiden Frauenbewegungen miteinander verglichen. Es werden sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede in ihren Forderungen und Strategien herausgestellt.
Schlüsselwörter
Frauenbewegung, Erwerbstätigkeit, Gleichstellung, Geschlechterrollen, Emanzipation, Hausarbeit, Bildungspolitik, Wohlfahrtspolitik, Jugendarbeit, Historische Entwicklung, Vergleichende Analyse, Gesellschaftliche Strukturen.
Häufig gestellte Fragen
Was wird in dieser Arbeit verglichen?
Es werden die Positionen und Forderungen der ersten deutschen Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts und der zweiten Frauenbewegung des 20. Jahrhunderts zur Erwerbstätigkeit verglichen.
Welche historischen Ereignisse gaben der Frauenbewegung erste Impulse?
Wichtige Anstöße kamen von der Französischen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts und der europäischen Revolution 1848/49.
Wie definiert das Statistische Bundesamt Erwerbstätige?
Erwerbstätige sind alle Personen, die als Arbeitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte etc.) oder Selbstständige eine auf wirtschaftlichen Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben.
Was war die Kritik an der traditionellen „natürlichen Funktionsteilung“?
Die zunehmende Bildung und Erwerbstätigkeit von Frauen durchlöcherte die Vorstellung, dass Geschlechterrollen fest vorgegeben seien, was von Kritikern teils als Gefahr für die Familie gesehen wurde.
Welche Rolle spielt die Hausarbeit in der Diskussion der zweiten Frauenbewegung?
In der zweiten Frauenbewegung wurde die Hausarbeit als Alternative zur externen Erwerbstätigkeit diskutiert und die Frage nach deren Aufwertung gestellt.
- Citation du texte
- Elisa Jendrusch (Auteur), 2009, Die Bedeutung der Erwerbstätigkeit in den Frauenbewegungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190543