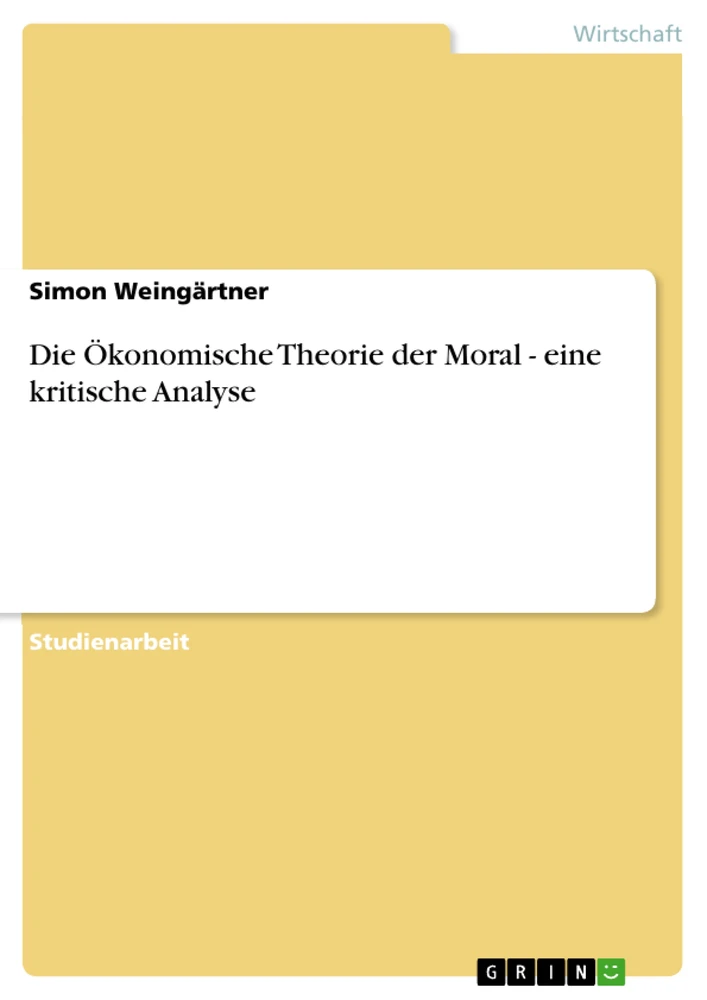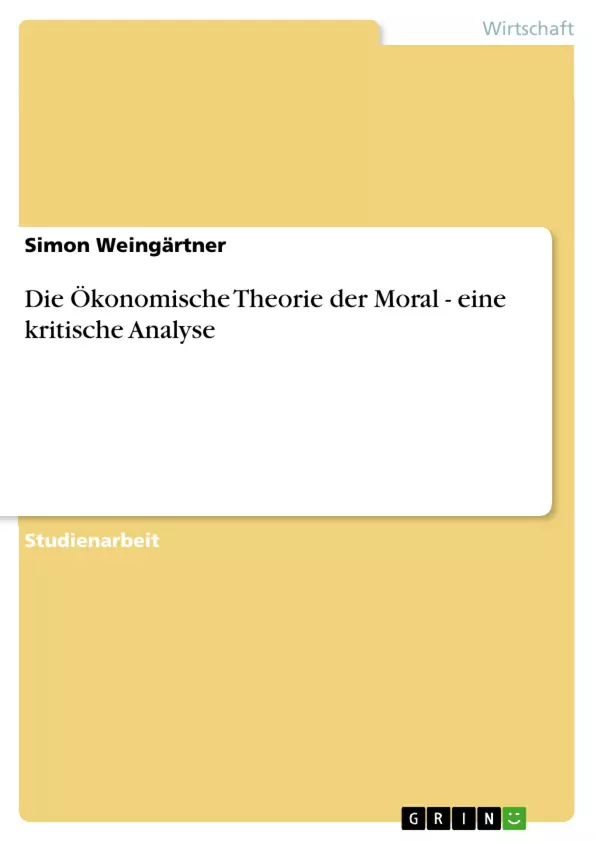Der Zusammenbruch der großen US-amerikanischen Investmentbank Lehmann Brothers im September 2008 stürzte nicht nur die Weltwirt-schaft in die Rezession, sondern auch das marktwirtschaftliche System insgesamt in eine Legitimationskrise. Das Finanzmarktversagen wird insbesondere im öffentlichen Diskurs auf ein Moralversagen seitens der Management-Elite zurückgeführt. Die Reaktion vieler Ökonomen fiel allerdings deutlich anders aus. Der Wirtschaftsethiker Karl Homann etwa sagte in einem Interview, dass nicht die Menschen die Schuld trügen, sondern falsche Anreizwirkungen im System (vgl. Wirtschaftswoche, 2009). Es scheint ganz offenbar so zu sein, dass das intuitive Moralverständnis der meisten Menschen mit dem der Ökonomik im Konflikt steht. Um es mit den Worten des Nobelpreisträgers Thomas C. Schelling zu sagen:
"[d]urch nichts unterscheiden sich Ökonomen so sehr von anderen Menschen, als durch ihren Glauben an die Marktwirtschaft, oder an das, was manche den freien Markt nennen." (Schelling, 2009, S. 517)
So mag es für den Nicht-Ökonomen geradezu grotesk anmuten, dass es in der Ökonomik verschiedene Theorien gibt, die versuchen, moralisches Handeln ökonomisch zu erklären. Derartige Konzepte stehen in der Tradition des sog. ökonomischen Imperialismus. Ein Begriff, der durch Wirtschaftsnobelpreisträger Gary Becker geprägt wurde und der das „Phänomen, dass der ökonomische Ansatz auch auf Probleme angewendet wird, die nicht zum Problemkanon der Wirtschaftswissenschaften gehören“, bezeichnet (vgl. Pies, 1998, S. 1). In der Tat scheint auf den ersten Blick die ökonomische Theorie für die menschliche Eigenschaft der Moral blind zu sein - schließlich modelliert sie den Menschen aus methodischen Erwägungen als profitmaximierenden und vollkommen amoralischen Egoisten.
Im Rahmen dieser Arbeit soll die ökonomische Theorie der Moral einer kritischen Analyse unterzogen werden. Dafür werden in Abschnitt 2 zunächst die ideengeschichtlichen Grundlagen der normativen Ökonomik mit Bezug zur Moralphilosophie erörtert. Den Kernbereich bildet Abschnitt 3: Hier werden zwei bekannte ökonomische Konzeptionen von Moral (Hegselmann und Homann) miteinander verglichen. Im abschließenden Diskussionsteil werden Möglichkeiten und Grenzen des ökonomischen Ansatzes in Bezug auf das Phänomen der Moral erörtert und insbesondere der ethische Subjektivismus in der Ökonomik am Beispiel der Theorie von Homann aus philosophischer und methodischer Perspektive kritisch hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der ökonomischen Theorie der Moral
- 2.1 Begriffsklärung: Moral, Moralität und Ethik
- 2.2 Die menschliche Vernunft als Basis eines universellen Geltungsanspruchs der Moral. Der Kategorische Imperativ Immanuel Kants
- 2.3 Das moralphilosophische Fundament der normativen Ökonomik: Von der angelsächsischen Vertragstheorie bis zu Adam Smith
- 3. Ökonomische Theorien der Moral: Konzeptionen und Lösungsversuche des moralischen Dilemmas
- 3.1 Das Gefangenendilemma
- 3.2 Karl Homann – institutionelle Ordnungs- statt normativer Sollensethik
- 3.3 Das Modell von Hegselmann – Die ökonomische Funktion der Moral
- 4. „Ökonomik als Fortsetzung der Ethik mit anderen Mitteln?“ – Sinn, Möglichkeiten und Grenzen der Moralökonomik
- 5. Kritik des ethischen Subjektivismus: theoretische, methodologische und philosophische Einwände
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert kritisch die ökonomische Theorie der Moral. Sie untersucht die ideengeschichtlichen Grundlagen der normativen Ökonomik im Kontext der Moralphilosophie und vergleicht zwei ökonomische Konzeptionen von Moral (Hegselmann und Homann). Abschließend werden Möglichkeiten und Grenzen des ökonomischen Ansatzes bezüglich Moral erörtert, insbesondere der ethische Subjektivismus in der Ökonomik.
- Die ideengeschichtlichen Grundlagen der normativen Ökonomik und deren Bezug zur Moralphilosophie.
- Vergleich zweier ökonomischer Konzeptionen von Moral (Hegselmann und Homann).
- Möglichkeiten und Grenzen des ökonomischen Ansatzes zur Erklärung von Moral.
- Kritische Auseinandersetzung mit dem ethischen Subjektivismus in der Ökonomik.
- Analyse des Gefangenendilemmas als Modell für moralische Dilemmata.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit beginnt mit der Beschreibung der Legitimationskrise des marktwirtschaftlichen Systems nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im Jahr 2008. Der öffentliche Diskurs führt das Finanzmarktversagen auf ein Moralversagen zurück, während Ökonomen wie Karl Homann eher systemische Anreizwirkungen verantwortlich machen. Die Arbeit untersucht den Konflikt zwischen intuitivem Moralverständnis und ökonomischer Theorie und kündigt eine kritische Analyse der ökonomischen Theorie der Moral an.
2. Grundlagen der ökonomischen Theorie der Moral: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Moral, Moralität und Ethik. Es werden die moralphilosophischen Grundlagen der ökonomischen Theorie erörtert, wobei der Kategorische Imperativ Kants als Beispiel einer auf normativen Sollensvorschriften beruhenden Ethik gegenübergestellt wird. Weiterhin werden die angelsächsische Vertragstheorie und der Utilitarismus als Wurzeln der normativen Ökonomik behandelt und Adam Smiths Ansatz als emotivistisch interpretiert.
3. Ökonomische Theorien der Moral: Konzeptionen und Lösungsversuche des moralischen Dilemmas: Dieses Kapitel stellt zwei gegensätzliche ökonomische Konzeptionen von Moral vor: Homanns institutionelle Ordnungs- statt normativer Sollensethik und Hegselmanns Modell, das internalisierte Moral als Handlungsparameter einbezieht. Es wird das Gefangenendilemma als spieltheoretische Denkfigur verwendet, um die unterschiedlichen Ansätze zu veranschaulichen. Homann betont die Notwendigkeit einer institutionellen Ordnung, um moralische Dilemmata zu lösen, während Hegselmann versucht, Moral als ökonomisch erklärbaren Handlungsfaktor zu integrieren.
4. „Ökonomik als Fortsetzung der Ethik mit anderen Mitteln?“ – Sinn, Möglichkeiten und Grenzen der Moralökonomik: Dieses Kapitel fasst die Ansätze von Homann und Hegselmann zusammen und diskutiert deren wissenschaftstheoretische Implikationen. Es wird die Frage nach dem Erklärungsgehalt der ökonomischen Methode in Bezug auf Moral gestellt. Die Stärken der ökonomischen Methode werden für Bereiche mit Wettbewerb hervorgehoben, während ihre Grenzen im Hinblick auf die Begründung ethischer Normen aufgezeigt werden. Eine „kommunikative Ökonomik“ wird als Lösungsansatz vorgeschlagen.
5. Kritik des ethischen Subjektivismus: theoretische, methodologische und philosophische Einwände: Das Kapitel präsentiert Kritik am ethischen Subjektivismus, insbesondere an Homanns Ansatz. Es werden Einwände zur historischen Genauigkeit seiner Modernitätsdiagnose, zur Gefahr einer selbsterfüllenden Prophezeiung im Hinblick auf gesellschaftliche Solidarität und zur normativen Natur seiner Sachlogik erörtert. Der logische Zirkel in Homanns Argumentation und die Reduktion von Moral auf eine spezifische Form von Egoismus werden kritisiert. Schließlich wird Homanns ökonomischer Instrumentalismus in Frage gestellt.
Schlüsselwörter
Ökonomische Theorie der Moral, Moralphilosophie, Gefangenendilemma, institutionelle Ordnungspolitik, normativer Sollensethik, ethischer Subjektivismus, Homo oeconomicus, Kant, Utilitarismus, Vertragstheorie, Adam Smith, Hegselmann, Homann, Rationalität, Moralitätskoeffizient, Anreizwirkungen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Ökonomische Theorie der Moral
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert kritisch die ökonomische Theorie der Moral. Sie untersucht die ideengeschichtlichen Grundlagen der normativen Ökonomik im Kontext der Moralphilosophie und vergleicht zwei ökonomische Konzeptionen von Moral (Hegselmann und Homann). Abschließend werden Möglichkeiten und Grenzen des ökonomischen Ansatzes bezüglich Moral erörtert, insbesondere der ethische Subjektivismus in der Ökonomik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit den ideengeschichtlichen Grundlagen der normativen Ökonomik und deren Bezug zur Moralphilosophie, vergleicht die ökonomischen Konzeptionen von Moral nach Hegselmann und Homann, untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des ökonomischen Ansatzes zur Erklärung von Moral, setzt sich kritisch mit dem ethischen Subjektivismus in der Ökonomik auseinander und analysiert das Gefangenendilemma als Modell für moralische Dilemmata.
Welche Autoren und Konzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die ökonomischen Moral-Konzeptionen von Hegselmann und Homann. Dabei werden auch die philosophischen Grundlagen bei Kant (Kategorischer Imperativ), im Utilitarismus, in der Vertragstheorie und bei Adam Smith berücksichtigt. Der ethische Subjektivismus wird kritisch diskutiert.
Wie wird das Gefangenendilemma in die Analyse einbezogen?
Das Gefangenendilemma dient als spieltheoretisches Modell zur Veranschaulichung moralischer Dilemmata und zur Illustration der unterschiedlichen Ansätze von Homann und Hegselmann zur Erklärung von Moral.
Was ist die Kernaussage zum ethischen Subjektivismus?
Die Arbeit übt Kritik am ethischen Subjektivismus, insbesondere an Homanns Ansatz. Es werden Einwände zur historischen Genauigkeit, zur Gefahr selbsterfüllender Prophezeiungen und zur normativen Natur seiner Sachlogik erörtert. Der logische Zirkel in Homanns Argumentation und die Reduktion von Moral auf Egoismus werden kritisiert.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt die Legitimationskrise des marktwirtschaftlichen Systems und den Konflikt zwischen intuitivem Moralverständnis und ökonomischer Theorie. Kapitel 2 (Grundlagen) klärt Begriffe und erörtert die moralphilosophischen Grundlagen der ökonomischen Theorie. Kapitel 3 (Ökonomische Theorien) stellt die Konzeptionen von Homann und Hegselmann vor. Kapitel 4 („Ökonomik als Fortsetzung der Ethik…“) diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Moralökonomik. Kapitel 5 (Kritik des ethischen Subjektivismus) präsentiert Kritik am ethischen Subjektivismus, insbesondere an Homanns Ansatz.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Ökonomische Theorie der Moral, Moralphilosophie, Gefangenendilemma, institutionelle Ordnungspolitik, normativer Sollensethik, ethischer Subjektivismus, Homo oeconomicus, Kant, Utilitarismus, Vertragstheorie, Adam Smith, Hegselmann, Homann, Rationalität, Moralitätskoeffizient, Anreizwirkungen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich mit der ökonomischen Theorie der Moral auseinandersetzt. Sie eignet sich für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Philosophie und Politikwissenschaften.
- Citar trabajo
- Simon Weingärtner (Autor), 2010, Die Ökonomische Theorie der Moral - eine kritische Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190657