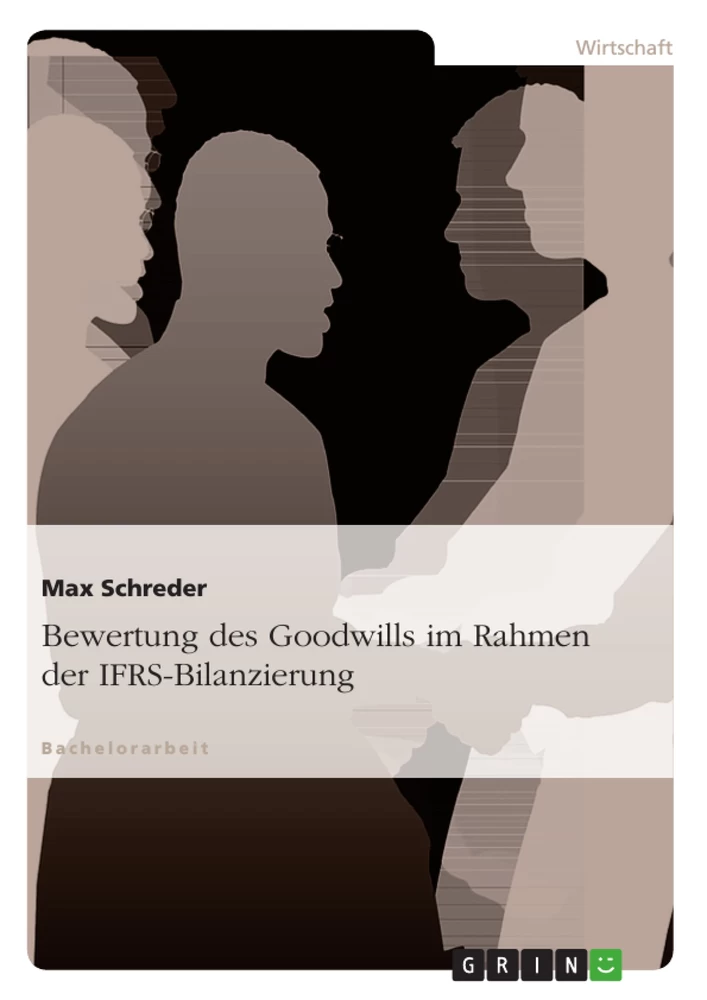Den Anlass dieser Arbeit gaben wesentliche Neuerungen des IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ zur Goodwill-Bewertung in der jüngeren Vergangenheit. Einerseits wurde im Rahmen dieser Arbeit untersucht, inwieweit die Bilanzierungspraxis die Neuerungen des IFRS 3 berücksichtigt respektive zur Anwendung bringt. Anderseits besteht die Zielsetzung darin, es dem interessierten Leser zu ermöglichen, die wesentlichen Facetten und Spezifikation der Goodwill-Bewertung in kompakter Form, praxisnah nachzuvollziehen und zu verstehen.
Dabei wurde methodisch darauf geachtet, dass nebst der theoretischen Fundierung der bilanzierungsrechtlichen Sachverhalte, vor allem der Bezug zur praktischen Anwendung, in Form von ausgewählten Beispielen und empirischen Analysen, stets gewahrt bleibt. Im Hauptteil dieser Arbeit Prozessorientiere Darstellung der Goodwill-Bewertung wurde zunächst die Frage beantwortet, welche Relevanz das neu geschaffene Goodwill-Wahlrecht zur Behandlung von Minderheitsgesellschaftern für die Bilanzierungspraxis darstellt. […]
Darauf hingewiesen sei, dass das Goodwill-Wahlrecht für jede Unternehmensakquisition erneut ausgeübt werden kann, wodurch der Stetigkeitsgrundsatz des Frameworks konterkariert wird und sich gleichermaßen die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieses Wahlrechts stellt. […]
Zu konstatieren gilt es, dass nicht nur der Goodwill als unsicherer Vermögenswert verstanden werden darf, auch die IFRS-Bilanzierung des Goodwills lässt weiterhin (trotz aller respektive gerade wegen der Neuerungen) umfängliche Ermessenspielräume offen, die es der Bilanzierungspraxis erlaubt, sowohl den im Erwerbszeitpunkt zu bilanzierenden, als auch in den Folgejahren zu bewertenden Goodwill in seiner betragsmäßigen Erscheinung signifikant zu beeinflussen. Ob dies der Intention des IASB entsprechen mag, muss bezweifelt werden.
Dennoch soll nicht vergessen werden, dass die Internationale Rechnungslegung der Zielsetzung einer zukunftsgerichteten Bilanzierung im Rahmen des Fair Value Accounting anhängt. Umso mehr verwundert es, dass zahlreiche Kritiken in der Fachliteratur regelmäßig auf die Schwächen des Fair Value Accounting per se abstellen, um hierdurch Schwächen der IFRS-Goodwill-Bewertung aufzudecken. Ob dies der Qualität der Diskussion immer vorteilhaft sein mag, muss ebenfalls bezweifelt werden. Ingolstadt, im Januar 2012
Inhaltsverzeichnis
- Abstrakt
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Aufbau der Arbeit
- II. Themenabgrenzung
- B. Grundlagen der Goodwill-Bewertung
- I. Anwendungsfälle der Goodwill-Bewertung
- II. Wesentliche Begriffsdefinitionen
- 1. Erläuterungen zum Goodwill
- 2. Fair Value in der IFRS-Bilanzierung
- 3. Die Cash Generating Unit
- C. Prozessorientierte Darstellung der Goodwill-Bewertung
- I. Zugangsbewertung des Goodwills
- 1. Übertragene Gegenleistung und Nettovermögen
- 2. Berücksichtigung von Minderheitsgesellschaftern
- 2.1 Partial Goodwill Approach
- 2.2 Full Goodwill Approach
- 2.3 Kritische Würdigung des Goodwill-Wahlrechts
- II. Folgebewertung des Goodwills
- 1. Goodwill-Verteilung auf CGUs
- 1.1 Zuteilungseinheit
- 1.2 Zuteilungsschlüssel
- 2. Impairment-Test des Goodwills
- 3. Ermittlung des erzielbaren Betrags
- 4. Ermittlung des Nutzungswertes
- 4.1 Detailplanungsphase
- 4.2 Fortschreibungsphase
- 5. Berücksichtigung von Minderheitsgesellschaftern
- 5.1 Auswirkungen des Goodwill-Wahlrechts
- 5.2 Maßgeblichkeit der Goodwill-Allokation
- 5.3 Beispielhafte Sachverhalte
- 1. Goodwill-Verteilung auf CGUs
- I. Zugangsbewertung des Goodwills
- D. Empirische Analyse des Goodwill-Reportings der DAX30-Konzerne
- I. Quantitative Analyse
- 1. Goodwill-Bestands-Analyse
- 2. Goodwill-Impairment-Analyse
- II. Qualitative Analyse
- 1. Ausübung des Goodwill-Wahlrechts
- 2. Ermittlung des erzielbaren Betrags
- I. Quantitative Analyse
- Anhang
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bewertung des Goodwills im Rahmen der IFRS-Bilanzierung. Sie untersucht, inwieweit die Bilanzierungspraxis Neuerungen des IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ zur Goodwill-Bewertung berücksichtigt. Darüber hinaus zielt die Arbeit darauf ab, dem Leser die wesentlichen Facetten und Spezifikationen der Goodwill-Bewertung in kompakter und praxisnaher Form verständlich zu machen.
- Relevanz des Goodwill-Wahlrechts zur Behandlung von Minderheitsgesellschaftern
- Goodwill-Allokation und Kompensationseffekte
- Goodwill-Impairment-Tests und die Ermittlung des Nutzungswertes
- Ermessensspielräume in der IFRS-Bilanzierung des Goodwills
- Kritikpunkte am Fair Value Accounting im Kontext der Goodwill-Bewertung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit untersucht die Relevanz des Goodwill-Wahlrechts für Minderheitsgesellschafter. Es wird gezeigt, dass im Geschäftsjahr 2010 kein Unternehmen des DAX30 dieses Wahlrecht nutzte. Die Arbeit beleuchtet die Intention von Unternehmen bei der Goodwill-Allokation, welche darin besteht, erworbenen Goodwill auf eine möglichst große Gruppe von CGUs zu verteilen, um sich die Vorteile von Kompensationseffekten zunutze zu machen. Eine Analyse der Goodwill-Impairments der DAX30-Konzerne zeigt die Zweischneidigkeit dieser Kompensationseffekte auf.
Im Rahmen des Goodwill-Impairment-Tests fokussiert sich die Arbeit auf die standardkonforme Ermittlung des Nutzungswertes. Es wird aufgezeigt, dass Anpassungsvorschriften des IAS 36, die eine Adjustierung der internen Planungsrechnung um Investitionen und Restrukturierungsmaßnahmen erfordern, von vielen Unternehmen ignoriert werden.
Schlüsselwörter
Goodwill, IFRS-Bilanzierung, Unternehmenszusammenschlüsse, Goodwill-Bewertung, Goodwill-Wahlrecht, Minderheitsgesellschafter, Full Goodwill Approach, Partial Goodwill Approach, Goodwill-Allokation, Impairment-Test, Nutzungswert, erzielbarer Betrag, Cash Generating Unit (CGU), DAX30-Konzerne, Fair Value Accounting.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem Partial und dem Full Goodwill Approach?
Beim Partial Goodwill Approach wird nur der anteilige Goodwill des Erwerbers bilanziert. Der Full Goodwill Approach hingegen erfasst auch den Goodwill, der auf die Minderheitsgesellschafter entfällt.
Wie funktioniert der Goodwill-Impairment-Test nach IFRS?
Da Goodwill nicht planmäßig abgeschrieben wird, muss jährlich ein Impairment-Test durchgeführt werden. Dabei wird der Buchwert einer Cash Generating Unit (CGU) mit ihrem erzielbaren Betrag verglichen, um Wertminderungen festzustellen.
Was ist eine Cash Generating Unit (CGU)?
Eine CGU ist die kleinste identifizierbare Gruppe von Vermögenswerten, die weitgehend unabhängige Mittelzuflüsse erzeugt. Auf diese Einheiten wird der Goodwill bei der Akquisition verteilt.
Wie nutzen DAX30-Konzerne das Goodwill-Wahlrecht?
Empirische Analysen (Stand 2010/2012) zeigen, dass DAX30-Unternehmen das Wahlrecht zum Full Goodwill Approach kaum nutzten und oft Ermessensspielräume bei der Allokation verwenden, um Kompensationseffekte zu erzielen.
Welche Kritik gibt es an der Goodwill-Bilanzierung?
Kritisiert werden vor allem die weiten Ermessensspielräume, die mangelnde Stetigkeit durch Wahlrechte und die oft unzureichende Anpassung interner Planungsrechnungen bei der Ermittlung des Nutzungswertes.
- Citar trabajo
- Max Schreder (Autor), 2012, Bewertung des Goodwills im Rahmen der IFRS-Bilanzierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190791