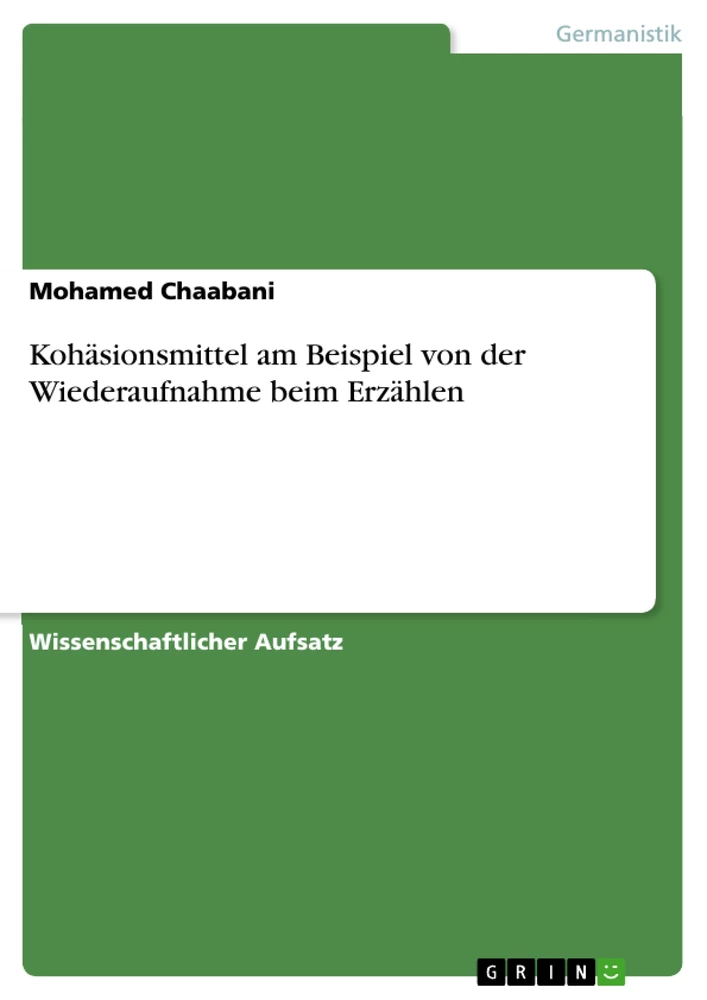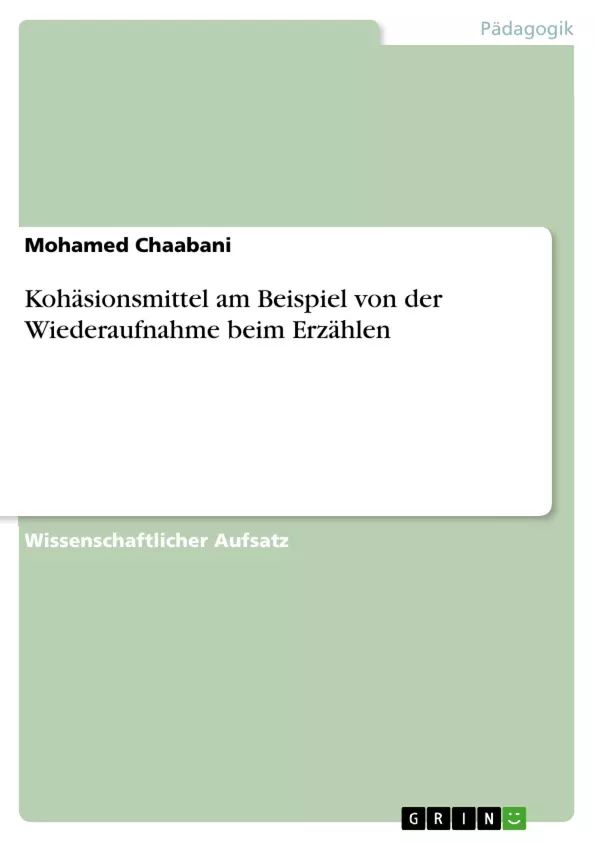Abstract
Im Fremdsprachenunterricht ist das Schreiben von Erzählungen eine wichtige Schreibtätigkeit. Um diese Erzählungen bestens zu gestalten, sollten die Studierenden ihre Texte kohärenter gestalten, indem sie Kohäsionsmittel gebrauchen. Vor diesem Hintergrund möchte diese Arbeit den Einsatz der Wiederaufnahme als ein Kohäsionsmittel untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Kohäsion und Kohärenz
- Zum Erzählen
- Zur Entwicklung des schriftlichen Erzählens
- Zur Analyse der Studententexte
- Wiederaufnahme in Nacherzählungen
- Wiederaufnahme in der Übung „Perspektivenwechsel“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einsatz der Wiederaufnahme als Kohäsionsmittel im Fremdsprachenunterricht, insbesondere beim Schreiben von Erzählungen. Die Arbeit untersucht, wie Wiederaufnahme die Kohärenz von Texten verbessern kann und analysiert die Verwendung von Wiederaufnahmemitteln in Studententexten.
- Kohäsion und Kohärenz als wichtige Kriterien für Textqualität
- Die Wiederaufnahme als Kohäsionsmittel und ihre Funktion im Text
- Analyse der Verwendung von Wiederaufnahmemitteln in Studententexten
- Die Rolle von Wiederaufnahme im Prozess des schriftlichen Erzählens
- Die Bedeutung von Kohäsion und Wiederaufnahme für den Fremdsprachenunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Konzepte von Kohäsion und Kohärenz und ihre Bedeutung für das Erstellen eines Textes. Dabei wird die Unterscheidung zwischen thematischer, grammatischer und struktureller Kohärenz erläutert. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Textsorte „Erzählen“ und seinen Merkmalen, insbesondere mit dem Schreibziel, der Modalität der Themenentfaltung, der Textstruktur und der sprachlichen Mittel. Das dritte Kapitel analysiert die Entwicklung des schriftlichen Erzählens in vier Phasen: enumerativer Modus, linear sequenzierender Modus, kontrastierender Modus und involvierender Modus.
Schlüsselwörter
Kohäsion, Kohärenz, Wiederaufnahme, Erzählen, Nacherzählung, Fremdsprachenunterricht, Textsortenmerkmale, Studententexte, Analyse, Pronominalisierung, Perspektivenwechsel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Kohäsion und Kohärenz?
Kohäsion bezieht sich auf den sprachlichen Zusammenhalt an der Textoberfläche (z.B. durch Pronomen), während Kohärenz den inhaltlich-logischen Zusammenhang im Kopf des Lesers meint.
Was versteht man unter „Wiederaufnahme“?
Wiederaufnahme ist ein Kohäsionsmittel, bei dem bereits eingeführte Konzepte oder Personen im Text erneut aufgegriffen werden (z.B. durch Pronominalisierung), um den Lesefluss zu sichern.
Warum ist Wiederaufnahme im Fremdsprachenunterricht wichtig?
Studierende lernen dadurch, ihre Texte flüssiger und professioneller zu gestalten, was besonders beim Schreiben von Erzählungen und Nacherzählungen entscheidend ist.
Welche Phasen des schriftlichen Erzählens gibt es?
Die Entwicklung verläuft meist über vier Phasen: den enumerativen, den linear sequenzierenden, den kontrastierenden und schließlich den involvierenden Modus.
Was ist die Übung „Perspektivenwechsel“?
Es ist eine Methode, bei der Studierende eine Geschichte aus einer anderen Sicht schreiben müssen, was den gezielten Einsatz von Wiederaufnahmemitteln und Pronomina erfordert.
- Arbeit zitieren
- Mohamed Chaabani (Autor:in), 2012, Kohäsionsmittel am Beispiel von der Wiederaufnahme beim Erzählen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190915