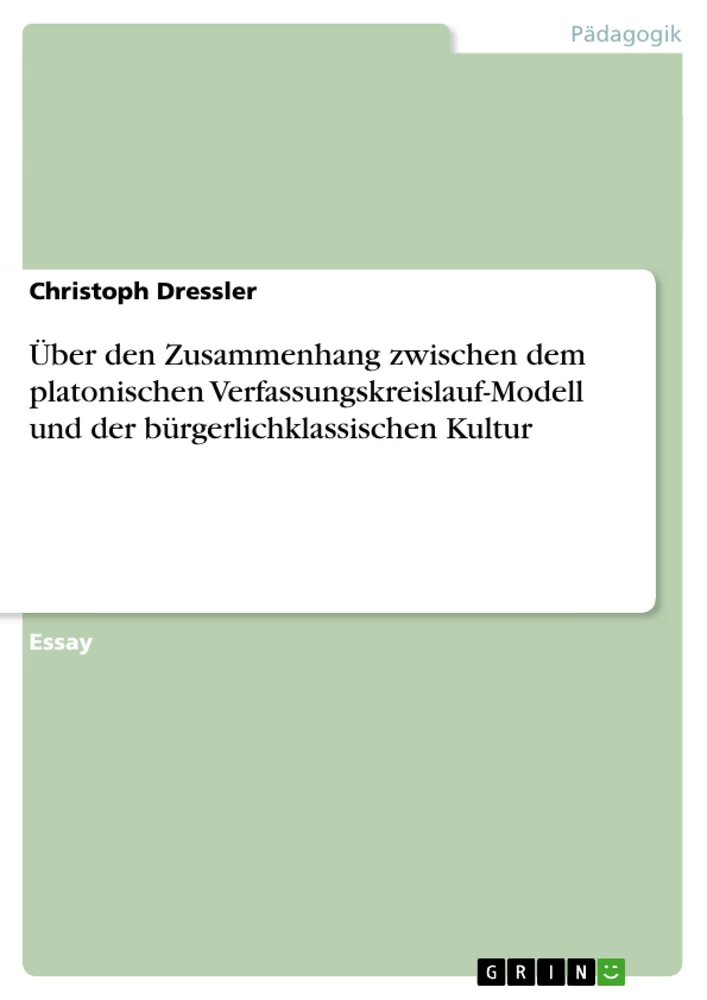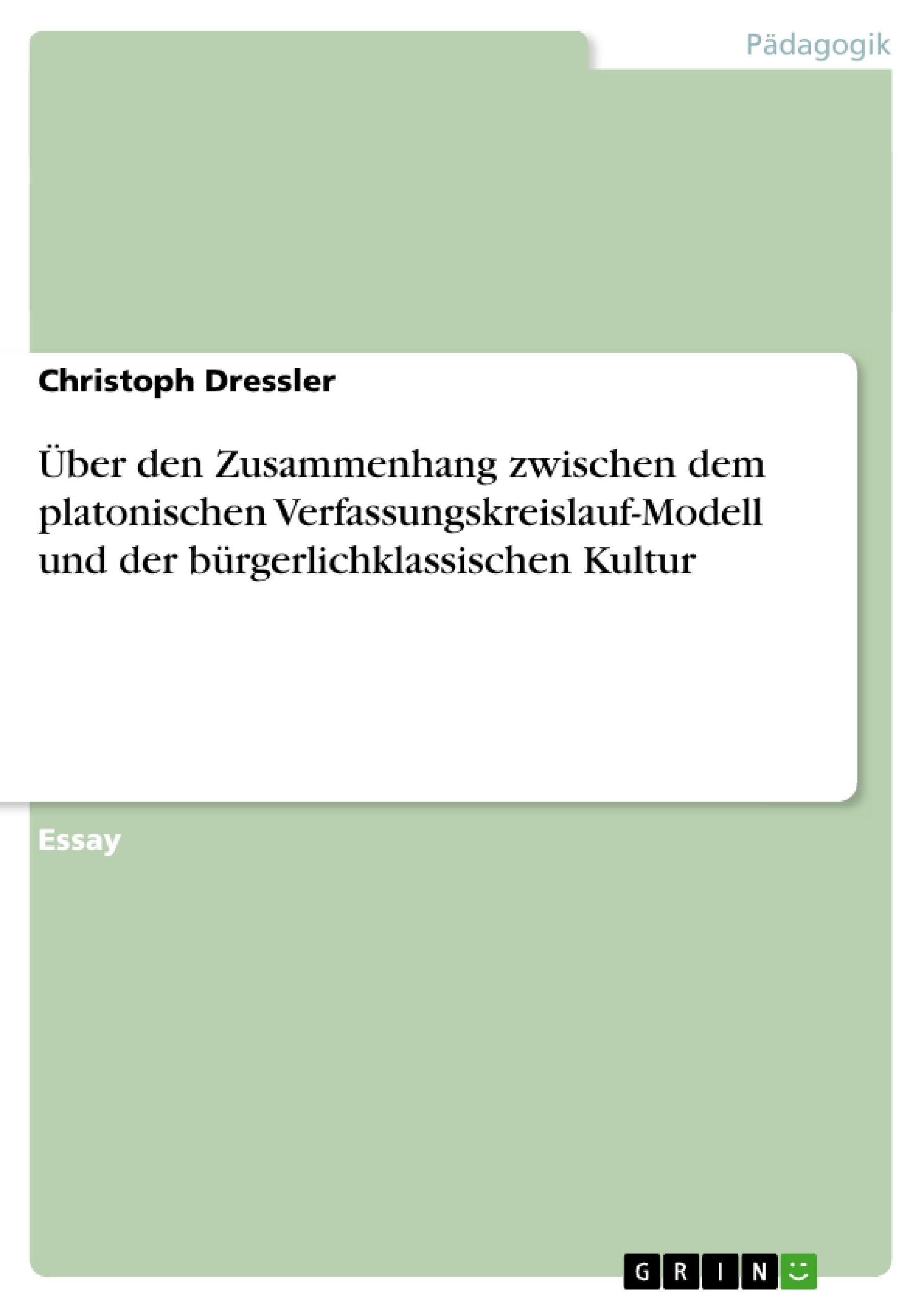Der Frage, wie es zum Nationalsozialismus kommen konnte und wie es möglich war, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit aktiv begangen, oder passiv akzeptiert wurden, stellte sich der in Nürnberg geborene Hermann Glaser. Glaser, der sein Studium der Germanistik, Anglistik, Geschichte und Philosophie in Erlangen und Bristol absolvierte hatte und 1952 promovierte, begleitete zwischen 1964 bis 1990 das Amt des Schul- und Kulturdezernenten der Stadt Nürnberg.
Glaser ging dabei über populäre historisch-politologische Ansätze hinaus, welche die selbstzerstörerischen Elemente der Weimarer Verfassung als Grund für das Scheitern der Republik ausmachten und wählte einen Erklärungsansatz, der die Rolle der Gesellschaft und insbesondere der Kultur in dessen Mittelpunkt stellte. Im Fokus seines Erklärungsansatzes rückte insbesondere das klassisch-autoritäre Kulturverständnis des frühen 20. Jahrhunderts, welches auch nach dem 2. Weltkrieg noch nicht überwunden war.
Inhaltsverzeichnis
- Der Zusammenhang zwischen dem Platonischen Verfassungskreislaufmodell und der bürgerlich-klassischen Kultur
- Platons Philosophie und die Kritik an der Demokratie
- Aristoteles und die Politie
- Polybios und das Kreislaufmodell der Staatsverfassungen
- Die Demokratie in Deutschland
- Die Aktualität des Platonischen Modells
- Die Weimarer Republik und die Parallelen zum Verfassungskreislaufmodell
- Hermann Glasers Kritik an der unkritischen Masse und dem kulturellen Kontext des Nationalsozialismus
- Die Rolle der Kultur im 20. Jahrhundert
- Kennzeichen der vor-nationalsozialistischen Kultur
- Die Unfähigkeit der Weimarer Demokratie, eine kritische Öffentlichkeit zu fördern
- Der Wahlkampf Hitlers und die fehlende Kritikfähigkeit der Bevölkerung
- Erklärungsansätze für die Zustimmung Hitlers
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem platonischen Verfassungskreislaufmodell und der bürgerlich-klassischen Kultur des frühen 20. Jahrhunderts. Das Ziel ist es, zu analysieren, inwiefern die Kultur des vor-nationalsozialistischen Deutschlands die Entartung der Demokratie in eine Ochlokratie und schließlich in eine Diktatur begünstigte.
- Das platonische Verfassungskreislaufmodell
- Die Rolle der Kultur im Nationalsozialismus
- Die Bedeutung der Kritikfähigkeit und des sozialen Handelns
- Der Einfluss der Kultur auf die politische Entwicklung Deutschlands
- Die Folgen der gesellschaftlichen Spaltung und der unpolitischen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt die philosophischen Grundlagen des Verfassungskreislaufmodells dar und beleuchtet die Kritik von Platon, Aristoteles und Polybios an der Demokratie.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung der Demokratie in Deutschland und der Aktualität des platonischen Modells im Kontext der jüngeren Geschichte.
- Das dritte Kapitel untersucht die Weimarer Republik und die Parallelen zum Verfassungskreislaufmodell, insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Kultur und der Kritikfähigkeit der Bevölkerung.
- Das vierte Kapitel analysiert die Kritik von Hermann Glaser an der unkritischen Masse und dem kulturellen Kontext des Nationalsozialismus. Es beleuchtet die Kennzeichen der vor-nationalsozialistischen Kultur und die Folgen der gesellschaftlichen Spaltung.
- Das fünfte Kapitel untersucht die Unfähigkeit der Weimarer Demokratie, eine kritische Öffentlichkeit zu fördern und die Folgen des unpolitischen Kulturverständnisses.
- Das sechste Kapitel analysiert den Wahlkampf Hitlers und die fehlende Kritikfähigkeit der Bevölkerung, die ihn zur Macht verhalf.
- Das siebte Kapitel beschäftigt sich mit Erklärungsansätzen für die Zustimmung Hitlers und die Rolle der Kultur in diesem Prozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Demokratie, Verfassungskreislaufmodell, Kultur, Kritikfähigkeit, Nationalsozialismus, Weimarer Republik, Hermann Glaser und der Rolle der Kultur im 20. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das platonische Verfassungskreislaufmodell?
Es ist eine philosophische Theorie, die beschreibt, wie Staatsformen (z.B. Demokratie) aufgrund innerer Instabilitäten in andere Formen (z.B. Ochlokratie oder Tyrannis) übergehen.
Welchen Erklärungsansatz verfolgte Hermann Glaser zum Nationalsozialismus?
Glaser betonte die Rolle der Gesellschaft und Kultur, insbesondere das klassisch-autoritäre Kulturverständnis, als Ursache für das Scheitern der Weimarer Republik.
Warum scheiterte die Weimarer Demokratie laut dieser Analyse?
Ein Hauptgrund war die Unfähigkeit, eine kritische Öffentlichkeit zu fördern, sowie eine "unpolitische" Kultur, die der Manipulation durch Hitler wenig entgegensetzte.
Was versteht man unter einer "Ochlokratie"?
In der antiken Staatstheorie bezeichnet dies die "Pöbelherrschaft" oder eine entartete Form der Demokratie, die oft einer Diktatur vorausgeht.
Wie beeinflusste die bürgerlich-klassische Kultur die politische Entwicklung?
Das autoritäre Kulturverständnis des frühen 20. Jahrhunderts begünstigte laut Glaser die Akzeptanz einer starken Führungsperson und schwächte demokratische Werte.
Welche Rolle spielten Platon, Aristoteles und Polybios in der Arbeit?
Ihre antiken Theorien bilden das philosophische Fundament, um die Gefahren und Zyklen staatlicher Verfassungen im Vergleich zur Moderne zu verstehen.
- Citar trabajo
- Christoph Dressler (Autor), 2010, Über den Zusammenhang zwischen dem platonischen Verfassungskreislauf-Modell und der bürgerlichklassischen Kultur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/190918