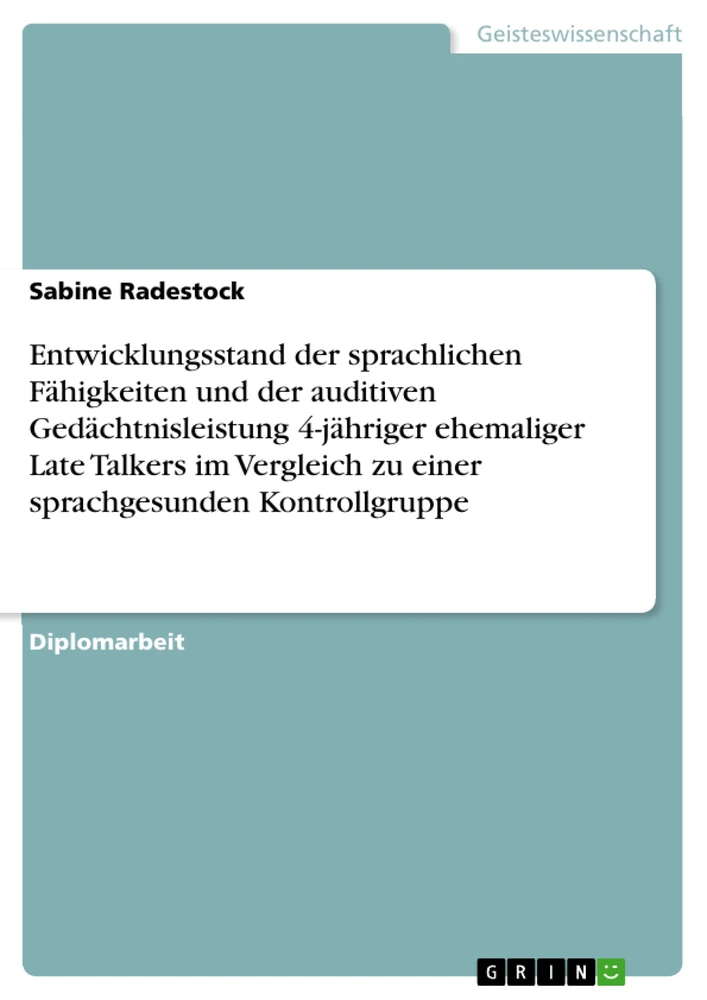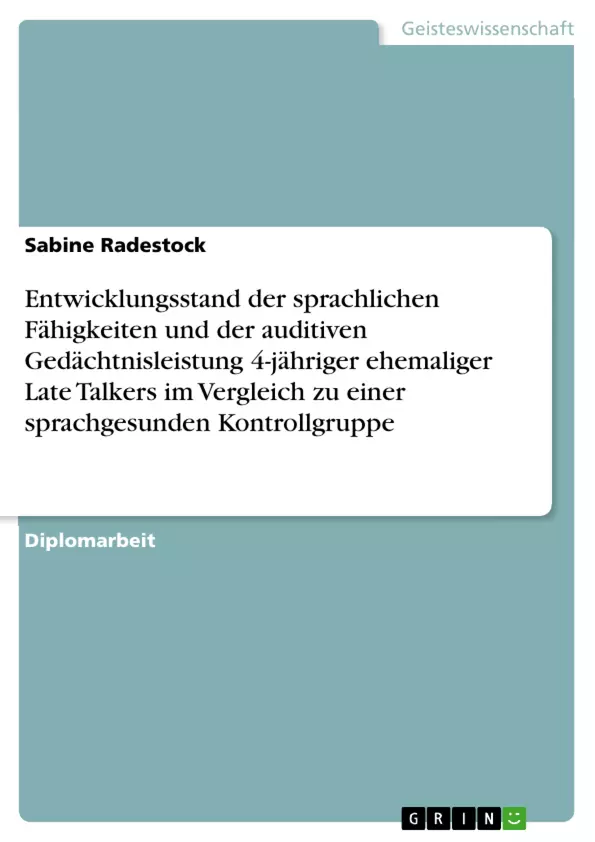Sprache ist ein für den Menschen wichtiges Medium, um sich in der Gesellschaft
zurechtzufinden und durchzusetzen, um zu lernen, sich zu entwickeln sowie um sich
sozial und emotional mitzuteilen (Weinert, 2006).
Der Prozess der Sprachentwicklung ist ein komplexer Vorgang, der überwiegend in den
ersten Jahren der Kindheit stattfindet. Störungen der Sprachentwicklung gehören mit
einer Prävalenzrate von 6-8% zu den häufigsten Problemen der kindlichen Entwicklung
im Vorschulalter (Kühn, 2010).
Die früher häufig
praktizierte Wait-and-See-Strategie, die auf der Annahme basiert, dass der Rückstand
von selbst aufgeholt wird, ist heutzutage wissenschaftlich nicht mehr vertretbar (Buschmann
et al., 2008). In Anbetracht der weitreichenden und gravierenden Folgen einer
Sprachentwicklungsstörung ist eine frühe Identifizierung der Risikokinder von immenser
Bedeutung, um Maßnahmen zur Prävention oder zur Therapie einzuleiten.
Heute machen es diagnostische Methoden möglich, die von einer stark verzögerten
Sprachentwicklung gefährdeten Kinder in einem Alter von circa 2 Jahren zu erkennen.
Für diese Kinder hat Frau Dr. Buschmann mit dem 2008 veröffentlichten Heidelberger
Elterntraining (HET) eine elternzentrierte Frühintervention vorgestellt, deren kurz- und
mittelfristige Effektivität bereits überprüft und bestätigt wurde (Buschmann, Jooss &
Pietz, 2009).
In dieser Arbeit wird nun die langfristige Effektivität des Heidelberger Elterntrainings
untersucht. Dazu werden der Sprachentwicklungsstand ehemaliger Late Talkers, deren
2 1 Einleitung
Eltern das HET besuchten (Interventionsgruppe), mit dem von Late Talkers ohne
Intervention (Wartegruppe) im Alter von 4 Jahren untereinander und mit dem von
sprachentwicklungsgesunden Kindern (Kontrollgruppe) verglichen.
Sollte sich zeigen, dass das Sprachniveau der ehemaligen Late Talkers nach dem HET
im Alter von 4 Jahren nicht von dem der Late Talkers, deren Eltern nicht am HET
teilgenommen haben, unterscheidet, dann sollte über eine längere und intensivere
Unterstützung dieser Kinder nachgedacht werden. Sollte aber der langfristige Erfolg des
Heidelberger Elterntrainigs bestätigt werden, dann wäre dies eine klare Befürwortung
für eine Frühintervention bei Sprachentwicklungsverzögerungen (im speziellen für das
Heidelberger Elterntraining), die - bei entsprechender Befundlage - intensiviert angeboten
und möglichst vielen betroffenen Kindern zugänglich gemacht werden sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Spracherwerbstheorien
- 2.2 Regelhafte Sprachentwicklung
- 2.2.1 Frühkindliche Sprachentwicklung
- 2.2.2 Sprachentwicklung nach dem 24. Lebensmonat
- 2.3 Gestörte Sprachentwicklung
- 2.3.1 Spezifische Sprachentwicklungsstörung
- 2.3.2 Sprachentwicklungsverzögerung – Late Talkers
- 2.3.3 Ursachen und Prädiktoren der Sprachentwicklungsverzögerung
- 2.3.3.1 Das auditive Gedächtnis.
- 2.3.4 Entwicklungsverläufe bei Late Talkers
- 2.3.5 Intervention bei Sprachentwicklungsverzögerung
- 2.4 Das Heidelberger Elterntraining .
- 2.5 Die Heidelberger Sprachentwicklungsstudie
- 2.6 Fragestellung
- 3 Hypothesen
- 4 Methode
- 4.1 Stichprobe.
- 4.1.1 Late Talkers.
- 4.1.1.1 Interventionsgruppe
- 4.1.1.2 Wartegruppe
- 4.1.2 Kontrollgruppe
- 4.1.1 Late Talkers.
- 4.2 Erhebungsverfahren
- 4.2.1 Messzeitpunkt T1 (Prätest)
- 4.2.1.1 ELFRA-2.
- 4.2.1.2 SETK-2.
- 4.2.1.3 BSID-II-NL .
- 4.2.2 Messzeitpunkt T4
- 4.2.2.1 AWST-R
- 4.2.2.2 SETK 3-5.
- 4.2.2.3 K-ABC
- 4.2.2.4 SON-R 2.5-7
- 4.2.1 Messzeitpunkt T1 (Prätest)
- 4.3 Datenauswertung .
- 4.1 Stichprobe.
- 5 Ergebnisse
- 5.1 Kontrollanalysen
- 5.1.1 Soziodemographische Unterschiede zwischen Kontrollgruppe und Late Talkers.
- 5.1.2 Unterschiede in nonverbalen kognitiven Fähigkeiten
- 5.2 Unterschiede zwischen sprachgesunden Kindern und Late Talkers mit 4 Jahren.
- 5.2.1 Unterschiede im Sprachentwicklungsstand
- 5.2.2 Unterschiede in auditiver Gedächtnisleistung
- 5.3 Unterschiede zwischen den Aufholern in auditiver Gedächtnisleistung
- 5.4 Logopädische Behandlung
- 5.1 Kontrollanalysen
- 6 Diskussion
- 6.1 Befunde zum Sprachentwicklungsstand.
- 6.2 Befunde zur auditiven Gedächtnisleistung
- 6.3 Befunde zur auditiven Gedächtnisleistung der Aufholer.
- 6.4 Befunde zur logopädischen Behandlung
- 6.5 Methodik und Stichprobe
- 6.6 Künftige Forschungsfragen.
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die langfristige Effektivität des Heidelberger Elterntrainings (HET) zur Förderung der Sprachentwicklung bei Kindern mit verzögerter Sprachentwicklung (Late Talkers). Zwei Jahre nach der Intervention werden die sprachlichen Fähigkeiten und die auditive Gedächtnisleistung der ehemaligen Late Talkers in der Interventionsgruppe mit einer Wartegruppe von Late Talkers sowie einer Kontrollgruppe sprachgesunder Kinder verglichen.
- Langfristige Effektivität des Heidelberger Elterntrainings
- Sprachentwicklungsverzögerung bei Late Talkers
- Auditive Gedächtnisleistung bei Late Talkers
- Vergleich von Interventionsgruppe, Wartegruppe und Kontrollgruppe
- Prävention von Sprachentwicklungsstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Sprachentwicklungsverzögerung bei Late Talkers ein und erläutert die Bedeutung frühzeitiger Interventionen. Kapitel 2 präsentiert den theoretischen Hintergrund, einschließlich Spracherwerbstheorien, regelhafter Sprachentwicklung, gestörter Sprachentwicklung sowie der Ursachen und Prädiktoren von Sprachentwicklungsverzögerungen, insbesondere des auditiven Gedächtnisses. Das Heidelberger Elterntraining und die Heidelberger Sprachentwicklungsstudie werden ebenfalls vorgestellt. Die Fragestellung der Arbeit wird definiert, die sich auf die Langzeiteffekte des HET auf die sprachlichen Fähigkeiten und die auditive Gedächtnisleistung von Late Talkers fokussiert. Kapitel 3 formuliert die Hypothesen, die die erwarteten Unterschiede zwischen den Gruppen beschreiben. Kapitel 4 erläutert die Methoden, die zur Erhebung und Auswertung der Daten verwendet wurden, einschließlich der Beschreibung der Stichprobe, der Erhebungsverfahren und der Datenauswertung. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie und untersucht die Unterschiede in den sprachlichen Fähigkeiten und der auditiven Gedächtnisleistung zwischen den Gruppen. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse im Kontext des bestehenden Forschungsstandes und beleuchtet die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis.
Schlüsselwörter
Sprachentwicklung, Late Talkers, Heidelberger Elterntraining, Frühintervention, auditives Gedächtnis, Sprachentwicklungsstörung, Prävention, Interventionsgruppe, Wartegruppe, Kontrollgruppe, Sprachentwicklungsstand, Langzeiteffekte
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Late Talkers“?
Late Talkers sind Kinder, deren Sprachentwicklung im Alter von etwa 2 Jahren stark verzögert ist, was ein Risiko für spätere Sprachentwicklungsstörungen darstellt.
Was ist das Heidelberger Elterntraining (HET)?
Das HET ist eine elternzentrierte Frühintervention, die darauf abzielt, die sprachlichen Fähigkeiten von Late Talkers durch gezielte Anleitung der Eltern zu fördern.
Wie wurde die Effektivität des Trainings untersucht?
Die Studie vergleicht eine Interventionsgruppe (mit HET) mit einer Wartegruppe (ohne HET) und einer sprachgesunden Kontrollgruppe im Alter von 4 Jahren.
Welche Rolle spielt das auditive Gedächtnis?
Die auditive Gedächtnisleistung gilt als wichtiger Prädiktor für die Sprachentwicklung und wurde in dieser Arbeit als zentrales Vergleichskriterium untersucht.
Warum ist eine frühe Identifizierung wichtig?
Da Sprachentwicklungsstörungen gravierende Folgen für die soziale und emotionale Entwicklung haben, ermöglicht eine frühe Diagnose rechtzeitige Präventionsmaßnahmen.
- Quote paper
- Sabine Radestock (Author), 2011, Entwicklungsstand der sprachlichen Fähigkeiten und der auditiven Gedächtnisleistung 4-jähriger ehemaliger Late Talkers im Vergleich zu einer sprachgesunden Kontrollgruppe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191263