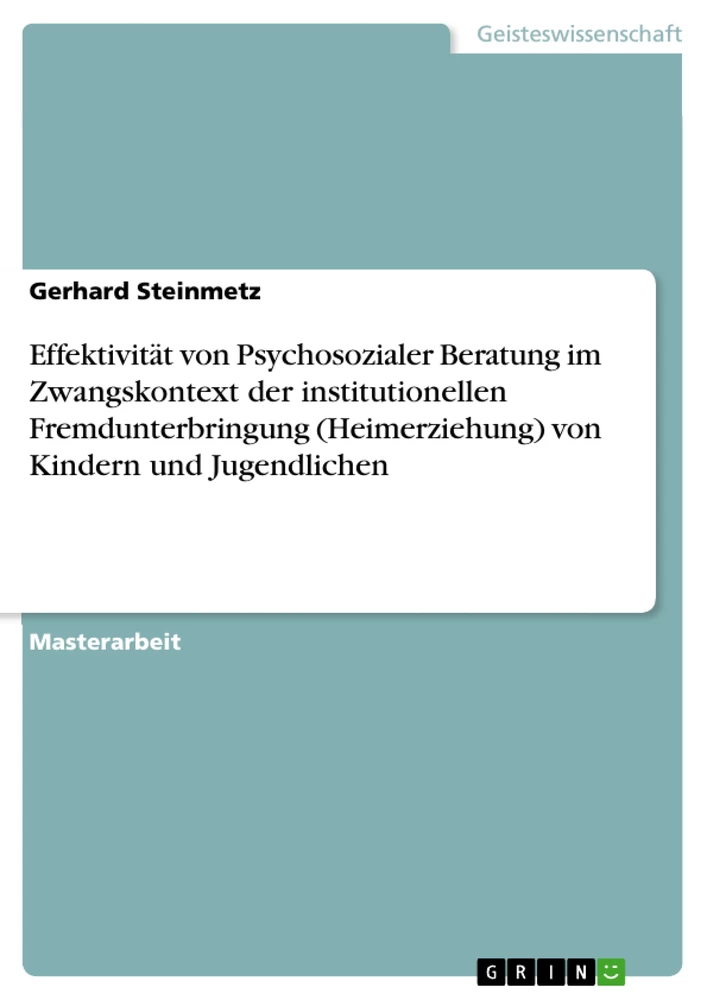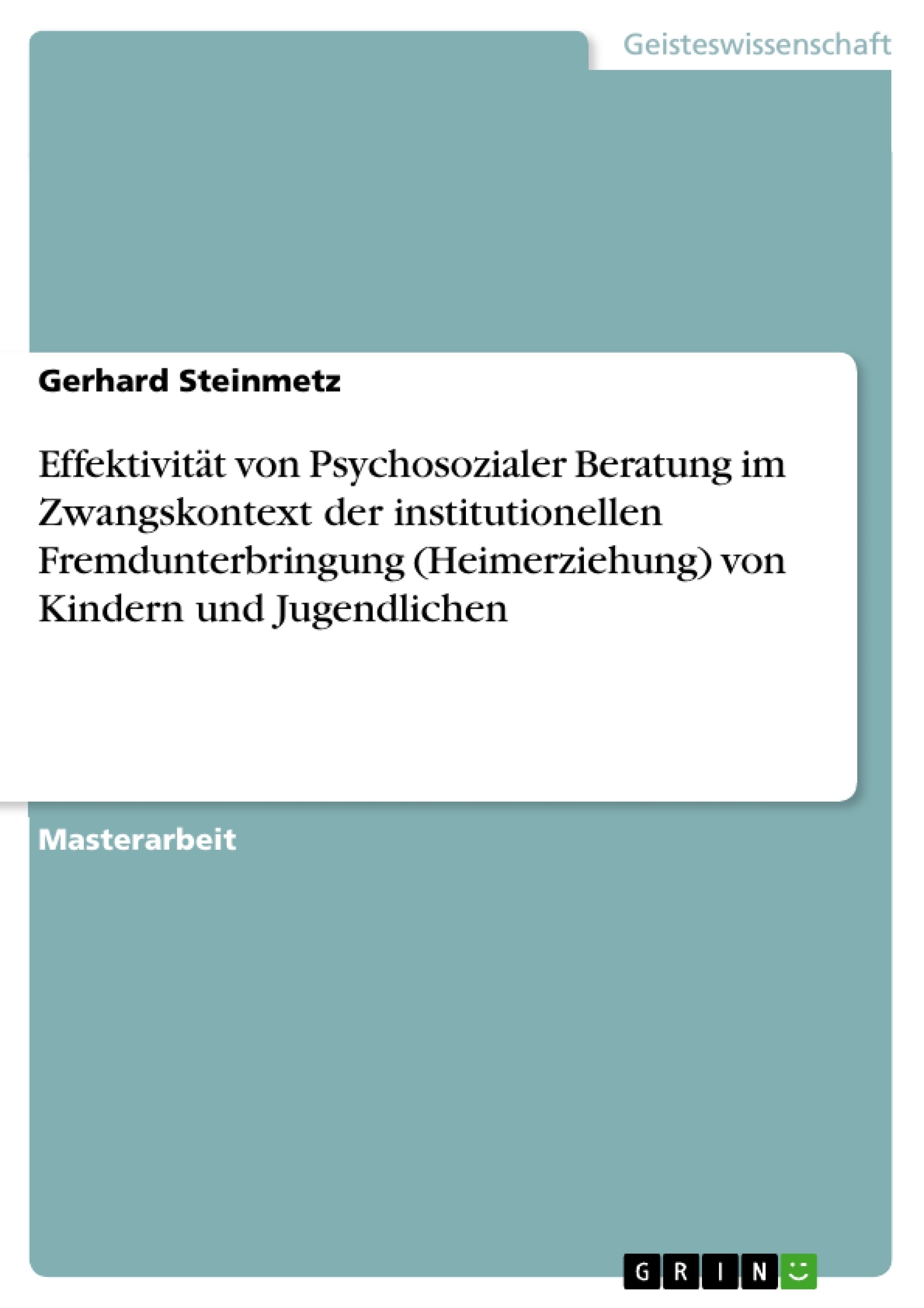Abstract
Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der institutionellen Heimerziehung stellt eine teure Maßnahme dar, bestehende Insuffizienzen der primären Sozialisationssysteme kompensatorisch auszugleichen, und verursacht darüber hinaus viel menschliches Leid. Der Gesetzgeber beabsichtigt, beide durch die Anwendung vorgeschalteter Maßnahmen unter Betonung des Primates der Familienerziehung zu minimieren. Die vorliegende Arbeit stellt die Frage nach dem verbindlichen, stringenten gesetzlichen Auftrag, nach daraus resultierenden taxativen Normierungen, ebenso wie jene nach der Effektivität der vorgesehenen, der Fremdunterbringung vorgeschalteteten Unterstützungsmaßnahmen; insbesondere aber die nach Vorhandensein und Wirksamkeit psychosozialer Beratung im Zwangskontext der institutionellen Heimerziehung unter präventivem, kurativem und rehabilitativem Blickwinkel. Diese Betrachtung gründet auf einer Längsschnittuntersuchung der aus der eigenen Institution des Verfassers entlassenen Klienten im Zeitraum 1995 bis 2006 ebenso wie auf einer Querschnittsbetrachtung der Lagebeurteilung der fallführenden Sozialarbeiter dreier Bezirksjugendwohlfahrtsbehörden. Auf Basis der erhobenen Datenlage wird ein struktureller Verbesserungsvorschlag entwickelt und begründet.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Untersuchungsdesign
- 1. Arbeitshypothese
- 2. Begriffsexplikation
- 2.1. Psychosoziale Beratung
- 2.1.1. Psychosoziale Beratung – Psychologische Beratung – Psychotherapie
- 2.1.2. Repräsentanz der Handlungsfelder
- 2.2. (Institutionelle) Zwangskontexte
- 2.3. Freiwillige vs. angeordnete Fremdunterbringung (Stationäre) Heimerziehung
- 2.5. Gesetzliche Grundlage und gesetzlicher Auftrag
- 2.6. Wirksamkeit und Beratungseffektivität
- 3. Problemstellung
- 3.1. Das Klientensystem
- 3.1.1. Initiative zur Kontaktaufnahme durch den Klienten
- 3.1.2. Initiative zur Kontaktaufnahme durch Netzwerkangehörige
- 3.1.3. Initiative zur Kontaktaufnahme aufgrund rechtlicher Vorgaben
- 3.1.4. Klientenverhalten in Zwangskontexten
- 3.2. Das Helfersystem
- 3.3. Effektivität
- 3.3.1. Längsschnittbetrachtung der Effektivität
- 3.3.2. Querschnittbetrachtung der Effektivität
- 3.3.2.1. Präventive Wirksamkeit
- 3.3.2.2. Kurative Wirksamkeit
- 3.3.2.3. Rehabilitative Wirksamkeit
- 4. Verbesserungsvorschläge: optimierte Netzwerkarbeit und Case-Management
- 4.1. Status Quo der Netzwerkarbeit
- 4.2. Historische Entwicklung sozialer Netzwerkforschung
- 4.3. Der Netzwerkbegriff – ein Definitionsversuch
- 4.4. Netzwerkarbeit
- 4.5. Rahmenbedingungen gelingender Netzwerkarbeit
- 4.5.1. Systeminterne Voraussetzungen
- 4.5.2. Kooperierende institutionenübergreifende Zusammenarbeit
- 4.5.3. Verbindlichkeit der Vereinbarungen
- 4.5.4. Implementierung einer Steuerungsgruppe
- 4.5.5. Qualitätsentwicklung durch Praxisforschung und -evaluation
- 4.6. Weitere zentrale Aspekte der Netzwerkarbeit
- 4.7. Inhibitorische Faktoren erfolgreicher Netzwerkarbeit
- 4.7.1. Der Faktor ,Team'
- 4.7.2. Der Faktor ,Hierarchie'
- 4.7.3. Der Faktor ,Professionalität'
- 4.7.4. Der Faktor ,Evaluation'
- 4.8. ,Case-Management' und/oder/ist gleich Netzwerkarbeit?
- 4.8.1. Das Netzwerkkonzept
- 4.8.2. Der Case-Manager
- 4.8.3. Modelle des Case-Management
- 5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation
- 5.1. Übereinstimmungen
- 5.2. Divergenzen
- 6. Perspektiven
- 7. Auswirkungen auf die Arbeitshypothese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Effektivität psychosozialer Beratung im Zwangskontext der institutionellen Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen. Sie analysiert die Wirksamkeit von Unterstützungsmaßnahmen im Hinblick auf die Reintegration von Kindern und Jugendlichen in ihre Ursprungsfamilien und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Bereitstellung psychosozialer Beratung in Zwangskontexten verbunden sind.
- Die Wirksamkeit von psychosozialer Beratung in der Heimerziehung
- Die Herausforderungen der Beratung im Zwangskontext
- Die Reintegration von Kindern und Jugendlichen in ihre Familien
- Die Bedeutung von Netzwerkarbeit und Case-Management
- Die Entwicklung von strukturellen Verbesserungsvorschlägen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer klaren Definition von psychosozialer Beratung und der Erläuterung von Zwangskontexten in der Heimerziehung. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und den gesetzlichen Auftrag der Heimerziehung sowie die unterschiedlichen Arten der Kontaktaufnahme durch Klienten und Netzwerkangehörige. Die Analyse der Effektivität psychosozialer Beratung erfolgt sowohl durch Längsschnitt- als auch durch Querschnittsbetrachtungen, wobei die präventive, kurative und rehabilitative Wirksamkeit untersucht wird.
Die Arbeit diskutiert anschließend die Rahmenbedingungen gelingender Netzwerkarbeit und die Herausforderungen, die mit der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen verbunden sind. Dabei werden verschiedene Modelle des Case-Managements vorgestellt und die Bedeutung von Qualitätssicherung und Evaluation hervorgehoben. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation der Daten sowie mit Perspektiven für die zukünftige Gestaltung psychosozialer Beratung im Zwangskontext der Heimerziehung.
Schlüsselwörter
Psychosoziale Beratung, Zwangskontext, Heimerziehung, Fremdunterbringung, Reintegration, Netzwerkarbeit, Case-Management, Effektivität, Längsschnitt, Querschnitt, Prävention, Kur, Rehabilitation, Familienintegration.
Häufig gestellte Fragen
Wie effektiv ist psychosoziale Beratung in der Heimerziehung?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit anhand von Längsschnittdaten und zeigt auf, wie Beratung trotz des Zwangskontexts präventiv, kurativ und rehabilitativ wirken kann.
Was ist ein "Zwangskontext" in der Sozialen Arbeit?
Ein Zwangskontext liegt vor, wenn Hilfemaßnahmen wie die Heimerziehung gesetzlich angeordnet sind und nicht auf der freiwilligen Initiative der Klienten beruhen.
Welche Rolle spielt das Case-Management?
Case-Management dient der Koordination verschiedener Hilfsangebote und Institutionen, um die Reintegration der Kinder in ihre Familien zu optimieren.
Welche Faktoren behindern erfolgreiche Netzwerkarbeit?
Inhibitorische Faktoren sind unter anderem starre Hierarchien, mangelnde Professionalität in der Kooperation und fehlende verbindliche Vereinbarungen zwischen den Institutionen.
Kann psychosoziale Beratung die Familienreintegration fördern?
Ja, durch gezielte kurative und rehabilitative Beratung können Insuffizienzen in den primären Sozialisationssystemen (Familien) kompensiert werden.
- Citation du texte
- Mag. MSc Gerhard Steinmetz (Auteur), 2007, Effektivität von Psychosozialer Beratung im Zwangskontext der institutionellen Fremdunterbringung (Heimerziehung) von Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191477