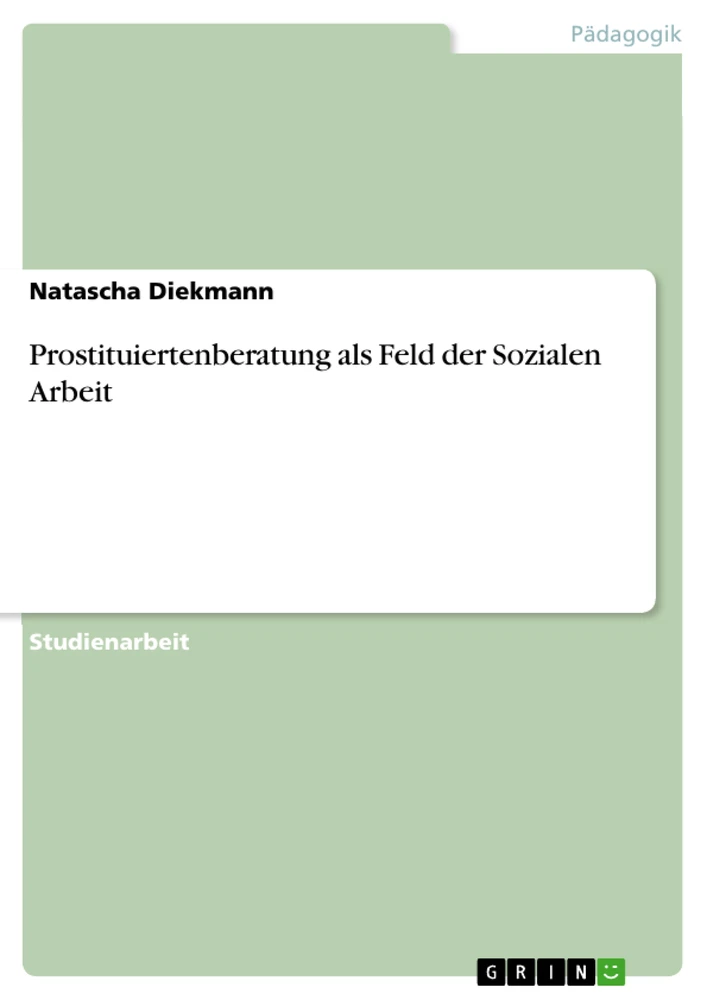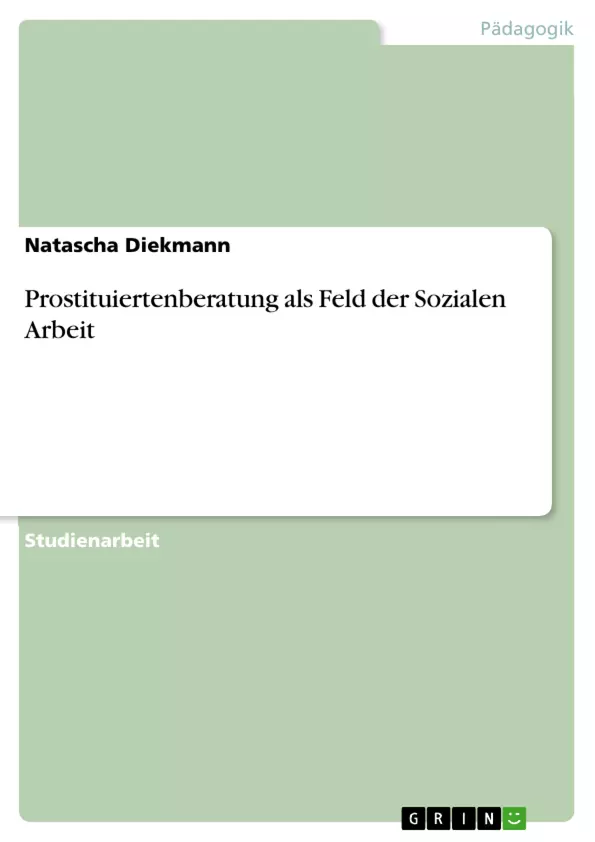Das Thema Prostitution wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Die Thematik ist aufgeladen mit Stigmatisierungen und moralischen Bewertungen, hat Befürworter und Gegner und trifft in unserer heutigen Gesellschaft generell auf reges Interesse (vgl. BMFSFJ 1997, S. 12 f.).
Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Prostitution im Rahmen sozialer Beratung. Andere Themenbereiche der Prostitution, wie beispielsweise die feministische Debatte (vgl. Grenz 2005, S. 11 ff.), werden aus Kapazitätsgründen in dieser Arbeit nicht dargestellt oder diskutiert.
Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit wird die Prostitution in Deutschland zunächst in ihren wichtigsten Aspekten skizziert. Um die Bandbreite von Prostitution zu verdeutlichen wird kurz auf die bestehende Heterogenität innerhalb der Prostitution eingegangen. Die weitere Basis für diese Arbeit bildet die Darstellung des Wandels der Prostitution in den letzten Jahren in Deutschland, um anschließend die Prostituiertenberatung zu fokussieren.
Der Hauptteil besteht aus der Darstellung eines Praxisbeispiels für Prostituiertenberatung und einem theoretischen Konzept, welches sich als Grundlage für die Soziale Arbeit in der Prostituiertenszene eignet.
Das Praxisbeispiel ist eine 2011 gegründete Prostituiertenberatungsstelle in Herford. Diese wird kurz in ihrer Entstehung und ihren Grundzügen dargelegt und mit exemplarischen Fällen veranschaulicht.
Ein möglicher theoretischer Zugang für die Soziale Arbeit mit Prostituierten ist die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Das Konzept wird in seinen Grundlagen, seiner theoretischen Basis, seinen Dimensionen, den Aufgaben und Strukturen sowie im Hinblick auf Nähe und Distanz erörtert.
Anschließend an diese Darstellungen wird das theoretische Konzept auf das Praxisbeispiel bezogen und ausführlich kritisch hinterfragt.
Das Fazit bildet den Abschluss dieser Arbeit und greift die Schwierigkeiten der Sozialen Arbeit im Feld der Prostitution auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Prostitution in Deutschland.
- 2.1 Heterogenität innerhalb der Prostitution.....
- 2.2 Prostitution im Wandel.
- 2.3 Beratung für Prostituierte
- 3. Prostituierten Beratung am Praxisbeispiel „THEODORA“.
- 3.1 Entstehung der Beratungsstelle THEODORA..
- 3.2 Grundlegende Aspekte der Arbeit von THEODORA
- 3.3 Fallbeispiele von THEODORA.
- 4. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit.
- 4.1 Grundlagen der Lebensweltorientierung
- 4.2 Theoretische Basis.
- 4.3 Dimensionen..
- 4.4 Aufgaben und Strukturen.
- 4.5 Nähe und Distanz..
- 5. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit als Konzept für die Prostituiertenberatung.
- 5.1 Lebensweltorientierung in der Prostituiertenberatung..
- 5.2 Kritische Betrachtung.
- 6. Fazit.
- 7. Literaturverzeichnis..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Prostitution im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Formen der Prostitution in Deutschland und stellt den Wandel der rechtlichen Rahmenbedingungen dar. Im Fokus steht die Prostituiertenberatung, die anhand des Praxisbeispiels der Beratungsstelle „THEODORA“ veranschaulicht wird. Darüber hinaus wird das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit als theoretischer Zugang für die Arbeit mit Prostituierten beleuchtet und kritisch betrachtet.
- Heterogenität der Prostitution in Deutschland
- Rechtlicher Wandel der Prostitution
- Praxisbeispiel der Prostituiertenberatung „THEODORA“
- Lebensweltorientierte Soziale Arbeit als Konzept
- Kritik und Anwendung des Konzepts in der Prostituiertenberatung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Prostitution ein und stellt die Problematik von Stigmatisierungen und moralischen Bewertungen heraus. Sie umreißt den Fokus der Arbeit auf die Prostitution im Rahmen der Sozialen Beratung.
- Kapitel 2: Prostitution in Deutschland: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen der Prostitution in Deutschland, beleuchtet die Heterogenität innerhalb des Berufsfelds und erläutert den Wandel der Prostitution in den letzten Jahren.
- Kapitel 3: Prostituierten Beratung am Praxisbeispiel „THEODORA“: Dieses Kapitel stellt die Beratungsstelle „THEODORA“ vor, beschreibt ihre Entstehung und Grundzüge ihrer Arbeit und veranschaulicht diese anhand von Fallbeispielen.
- Kapitel 4: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit: Dieses Kapitel definiert das Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, beleuchtet seine theoretischen Grundlagen, Dimensionen und Aufgaben sowie die Bedeutung von Nähe und Distanz in der Arbeit.
- Kapitel 5: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit als Konzept für die Prostituiertenberatung: Dieses Kapitel untersucht die Anwendbarkeit des Konzepts der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit auf die Prostituiertenberatung und unterzieht diese Verbindung einer kritischen Betrachtung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Prostitution in Deutschland, dem Wandel der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Die Schwerpunkte liegen auf der Beratung von Prostituierten, dem Praxisbeispiel „THEODORA“ und dem Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit. Weitere wichtige Begriffe sind Heterogenität, Stigmatisierung, Ausbeutung, Nähe und Distanz, Lebenswelt und Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit zur Prostituiertenberatung?
Die Arbeit untersucht Prostitution als Feld der Sozialen Arbeit, beleuchtet rechtliche Rahmenbedingungen und stellt mit der „Lebensweltorientierung“ ein theoretisches Konzept für die Beratung vor.
Was verbirgt sich hinter dem Praxisbeispiel „THEODORA“?
THEODORA ist eine 2011 in Herford gegründete Beratungsstelle für Prostituierte, deren Arbeit und Fallbeispiele in der Arbeit analysiert werden.
Was bedeutet „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ in diesem Kontext?
Es ist ein Konzept, das die individuellen Lebensumstände und den Alltag der Klienten in den Mittelpunkt stellt, um passgenaue Unterstützung anzubieten, die Stigmatisierung vermeidet.
Welche Herausforderungen werden für die Soziale Arbeit in diesem Feld genannt?
Besondere Schwierigkeiten liegen in der Stigmatisierung der Prostitution, dem Spannungsverhältnis von Nähe und Distanz in der Beratung sowie dem rechtlichen Wandel der Branche.
Wird in der Arbeit auch die feministische Debatte zur Prostitution behandelt?
Nein, aus Kapazitätsgründen wird die feministische Debatte ausgeklammert; der Fokus liegt rein auf der sozialen Beratung und praktischen Konzepten.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Natascha Diekmann (Autor:in), 2012, Prostituiertenberatung als Feld der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191783