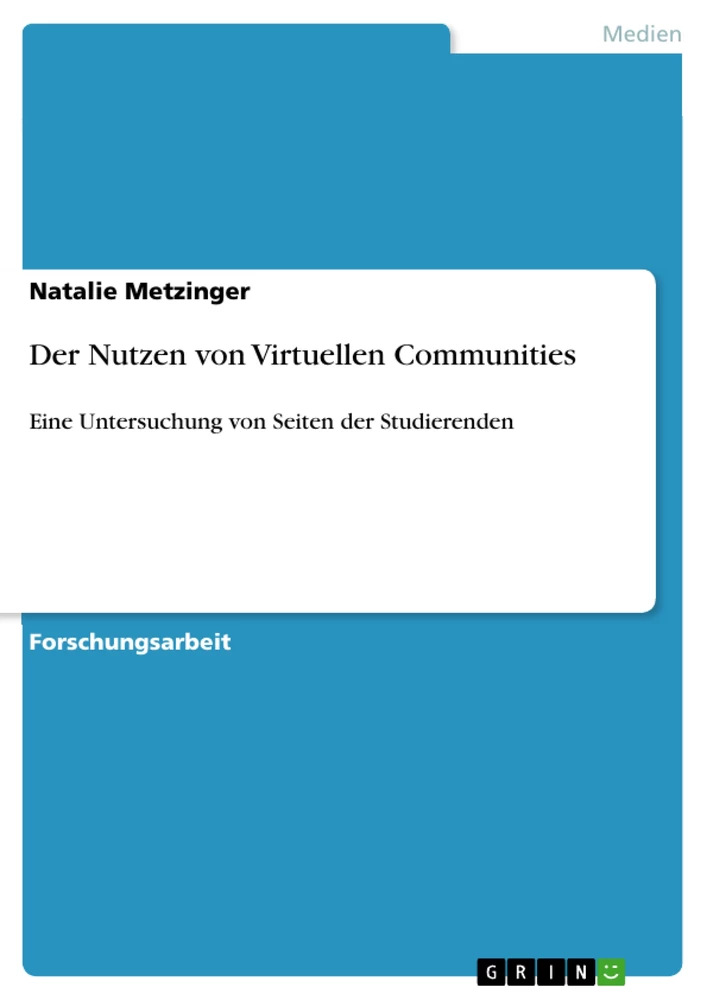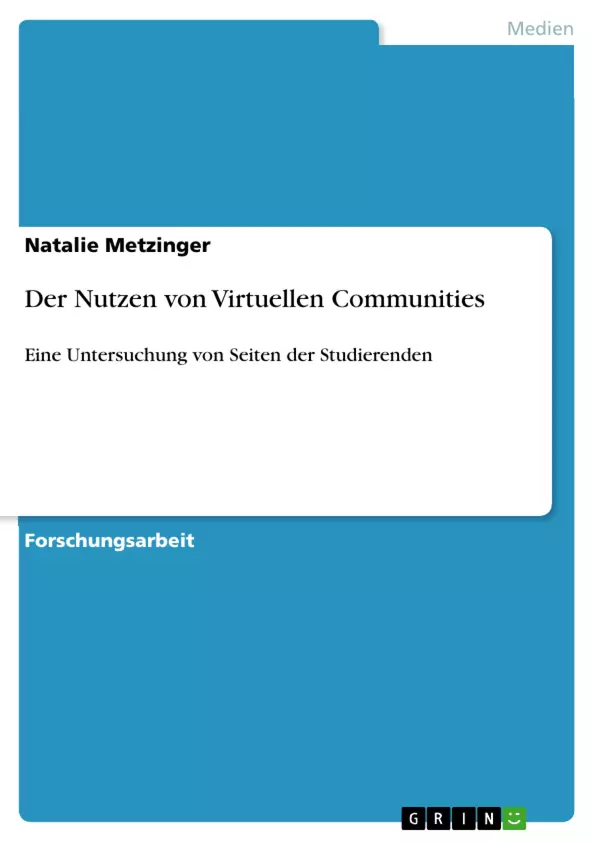In unserer heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft gewinnen computergestütz-te Medien immer mehr an Bedeutung und verdrängen bezüglich der Nutzungshäufigkeit zunehmend andere Informationsquellen wie Zeitung und Fernsehen.
Besonders beliebt sind dabei Virtuelle Communities, die es dem Internetnutzer ermöglichen, nicht nur rezeptiv, sondern auch aktiv im Netz tätig zu sein. „Mit den neuen Technologien wie dem Internet wird die gewohnte Trennung zwischen dem Produzen-ten und den Rezipienten im Prozess der öffentlichen Kommunikation aufgegeben“ (von Liechtenstein 2002, S. 14 nach Eibl & Podehl, 2005).
Doch was versteht man unter einer Virtuellen Community? Nach Döring (2001b, S.3)ist
„eine virtuelle Gemeinschaft […] ein Zusammenschluss von Menschen mit gemeinsamen Interessen, die untereinander mit gewisser Regelmäßigkeit und Verbindlichkeit auf com-putervermitteltem Wege Informationen austauschen und Kontakte knüpfen.“
Nahezu jede Woche geht ein neuer Social-Network-Dienst online (Richter & Koch, 2008). Das Angebot ist somit immens: mittlerweile existieren für soziale Gruppen jegli-cher Art, die durch gemeine Interessen oder demographische Eigenschaften verbunden sind, Communities im Netz. So zählt alleine das Soziale Netzwerk StudiVZ, das sich überwiegend an Studenten orientiert, bereits nach einer kurzen Laufzeit von 2 Jahren seit dem Start 2006 5,73 Mio. Mitglieder im Ranking der größten Online-Medien laut einer Statista-Umfrage.
Ihnen allen liegen allgemeine, strukturgegebene und beziehungsbezogene Eigenschaften zugrunde. Unter allgemeinen Eigenschaften sind Voraussetzungen wie der unbeschränk-te und offene Zugang zum Netzwerk und die Mitgliedschaft an sich zu verstehen. Struk-turgegebene Eigenschaften bezeichnen die „structural embeddedness“, also die Bezie-hungen zwischen den Teilnehmer auf, die stark oder schwach ausgeprägt sein können.
Der Nutzen dieser Plattformen ist jedoch umstritten. Empirische Untersuchungen zeigen sowohl positive als auch negative Auswirkung von Online Communities auf. Während eine Sonderstudie der repräsentativen (N)Onliner Atlas Umfrage ergab, dass Networ-king insbesondere die Schulleistungen von Jugendlichen in dem Fach Deutsch fördere,
2
berichtet das britische Medienforschungsunternehmen Wiggin, dass gerade die Alters-gruppe zwischen 15 und 19 Jahren mehr Zeit in Social Networks als in ihre Hausaufga-ben investiert (Kalenda, 4. März 2008).
Inhaltsverzeichnis
- I.: Einleitung
- II.: Theoretischer Hintergrund
- II.1.: Bezug zu Medienpädagogik
- II.2.: Merkmale und Erfolgsfaktoren Virtueller Communities
- II.3: Funktionen virtueller Communities
- II.4. Nutzungsverhalten in virtuellen Communities
- II.5: Virtuelle Gemeinschaften als Lerngemeinschaften
- III: Gegenstand/Thema/Projekt
- III.1: Ziel des Projektes
- III.2: Vorhaben
- IV: Methoden
- IV.1.: Auswahl der Zielgruppe
- IV.2.: Auswahl der Methode zur Datenerhebung: Fragebogen
- IV.3: Datenauswertung
- IV.4.: Auswahl der Methode zur Datenerhebung: Interviews
- V.: Ergebnisse
- V.1: Auswertung der einzelnen Fragen
- V.2: Überprüfung der Hypothesen
- VI. Diskussion
- VII.: Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Projektbericht analysiert das Nutzungsverhalten von Studenten in virtuellen Communities. Er beleuchtet die Bedeutung dieser Netzwerke für die Studenten und untersucht, welchen Zweck sie erfüllen. Die Studie befasst sich mit den allgemeinen Eigenschaften, Strukturgegebenheiten und Beziehungsaspekten dieser Plattformen, um zu verstehen, wie sie im Kontext der Medienpädagogik und insbesondere im Bereich der Bildung eine Rolle spielen.
- Bedeutung von virtuellen Communities für Studenten
- Nutzungsverhalten und Funktionen virtueller Communities
- Einordnung in die Medienpädagogik und der Einfluss auf Bildungsprozesse
- Vergleich von Online-Kommunikation mit face-to-face Kommunikation
- Empirische Ergebnisse und ihre Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Virtuelle Communities ein und betont deren steigende Bedeutung in der heutigen Wissensgesellschaft. Es wird auf die Definition und die verschiedenen Typen von virtuellen Communities eingegangen sowie die Nutzungshäufigkeit in der heutigen Zeit beleuchtet.
Der theoretische Hintergrund beleuchtet den Bezug zur Medienpädagogik und definiert den Begriff. Es wird die Relevanz virtueller Communities in den Bereichen Freizeit, Bildung und Beruf erörtert, sowie die Funktionsweise und das Nutzungsverhalten in diesen Communities untersucht.
Der Abschnitt „Gegenstand/Thema/Projekt“ beschreibt das Ziel und den Ablauf des Projekts. Es wird die Zielgruppe, die Methoden zur Datenerhebung und -auswertung sowie die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses vorgestellt.
Im Kapitel „Methoden“ werden die Auswahl der Zielgruppe, die Methoden zur Datenerhebung (Fragebogen und Interviews), die Datenauswertung und die Durchführung des Projekts detailliert erläutert.
Das Kapitel „Ergebnisse“ präsentiert die Auswertung der erhobenen Daten und die Überprüfung der im Rahmen des Projekts formulierten Hypothesen.
Schlüsselwörter
Virtuelle Communities, Medienpädagogik, Nutzungsverhalten, Bildung, Lerngemeinschaften, Online-Kommunikation, face-to-face Kommunikation, Empirische Forschung, Studenten, soziale Medien, Netzwerke, Homophilie-Prinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert eine „Virtuelle Community“?
Es ist ein Zusammenschluss von Menschen mit gemeinsamen Interessen, die regelmäßig über computervermittelte Wege Informationen austauschen und Kontakte knüpfen.
Welchen Nutzen haben Studenten von sozialen Netzwerken wie StudiVZ?
Sie dienen der Vernetzung, dem Informationsaustausch und können als informelle Lerngemeinschaften fungieren, die sogar Schulleistungen positiv beeinflussen können.
Gibt es negative Auswirkungen von Online-Communities?
Kritisch gesehen wird der Zeitaufwand; Studien zeigen, dass Jugendliche teils mehr Zeit in sozialen Netzwerken als für Hausaufgaben aufwenden.
Was versteht man unter „Structural Embeddedness“?
Dies bezeichnet die beziehungsbezogenen Eigenschaften und die Stärke der Bindungen zwischen den Teilnehmern innerhalb eines Netzwerks.
Wie unterscheiden sich Online- und Face-to-Face-Kommunikation?
Die Arbeit untersucht, wie computergestützte Medien die Trennung zwischen Produzent und Rezipient aufheben und die gewohnte öffentliche Kommunikation verändern.
- Citation du texte
- Natalie Metzinger (Auteur), 2008, Der Nutzen von Virtuellen Communities, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191946