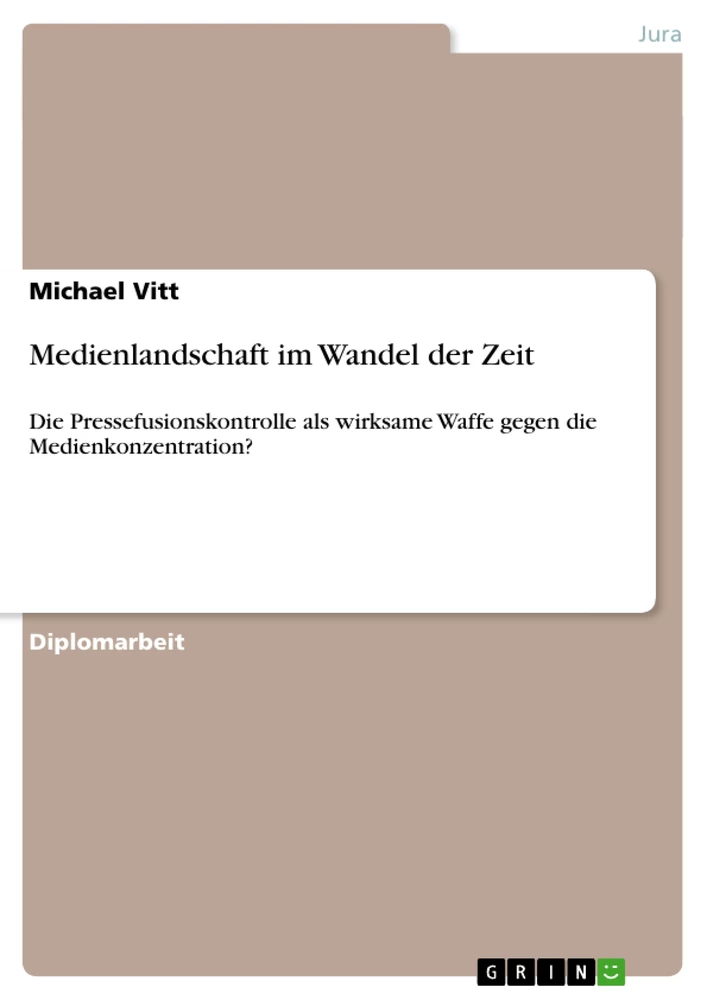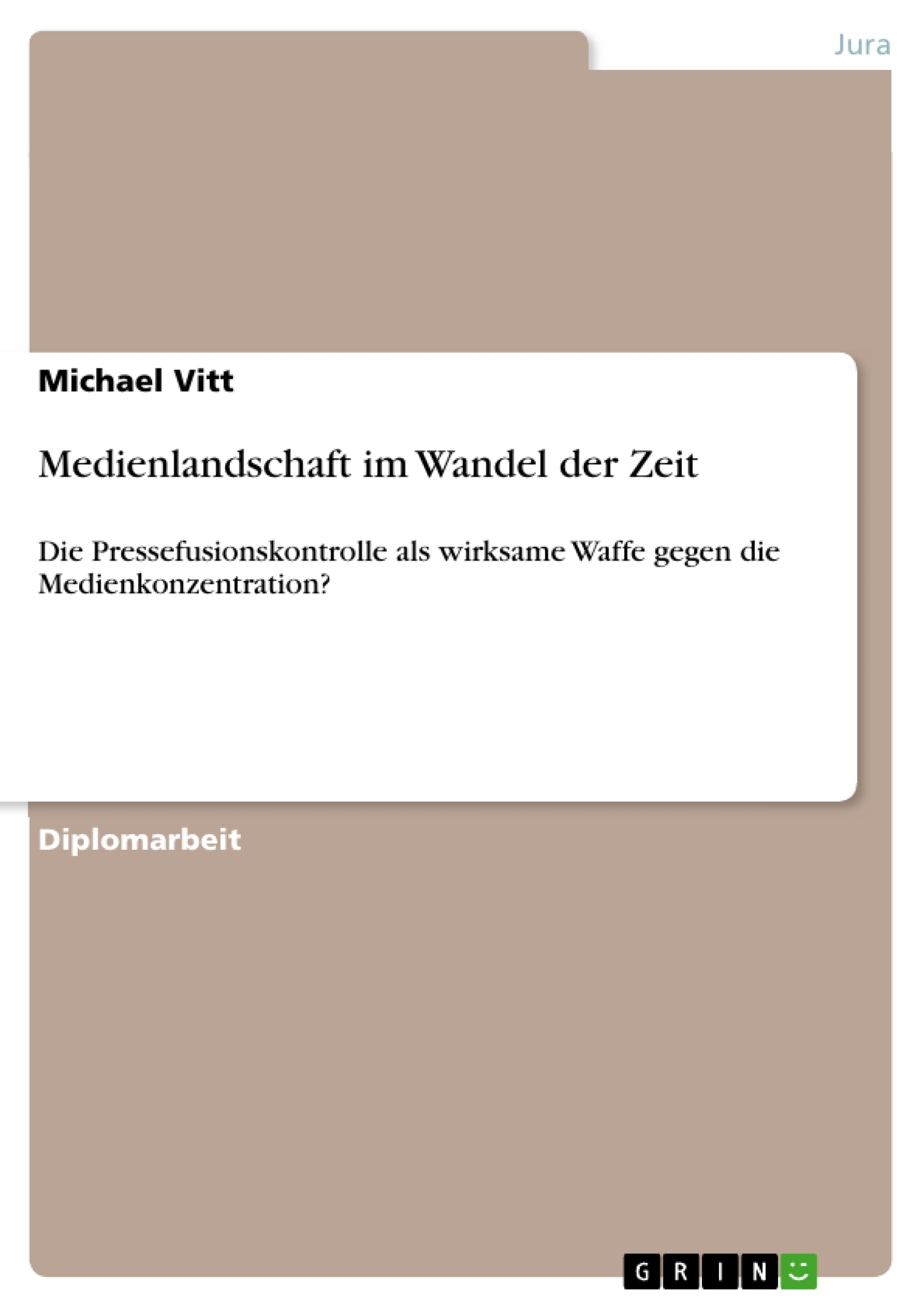Seit Jahrzehnten spielt sich in den Haushalten vieler deutscher Bürger jeden Morgen die gleiche Situation ab: Der Wecker klingelt, es ist Zeit aufzustehen. In der Küche wird erst einmal die Kaffeemaschine angestellt, dann folgt der Gang zum Briefkasten. Dort steckt die aktuelle Ausgabe der abonnierten Tageszeitung. Während des Frühstücks werden die Schlagzeilen studiert. Liegt die Zeitung einmal nicht im Briefkasten, fehlt etwas in der täglichen Routine.
Doch in den letzten Jahren scheinen immer mehr Menschen mit diesem allmorgendlichen Ritual zu brechen. Anstatt einen Blick in die, meist in der Nacht zuvor gedruckte Zeitung zu werfen, werden vermehrt die neuesten Nachrichten aus dem Internet abgerufen. Für viele Menschen scheint die Zeitung als Erstinformationsmedium ausgedient zu haben.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) bereitet seit März 2011 eine erneute Novellierung des Kartellgesetzes vor. Im Zuge dessen wurden Stimmen laut, die eine Änderung der Sonderregeln für die Printbranche im Wettbewerbsrecht verlangen. Bestand nach dem, von Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp RÖSLER, vorgestellten Eckpunktepapier zunächst kein Anlass, die pressespezifischen Regelungen zu ändern, sieht der Referentenentwurf des Achten Gesetzes zur Änderung des GWB nun doch eine Modifizierung der Pressefusionskontrolle vor.
Die in den vergangenen Jahren immer wieder vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) angestoßene Diskussion um die Notwendigkeit einer Änderung der Pressefusionskontrolle, hat weitestgehend nicht für das Gros der Bevölkerung wahrnehmbar stattgefunden. Die angekündigte 8. GWB-Novelle hat diese Debatte nun wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Trotz erster Annäherungen im Hinblick auf die unterschiedlichen Positionen, vertreten das BMWi auf der einen, und der BDZV gemeinsam mit dem Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. (VDL) auf der anderen Seite, nach wie vor verschiedene Standpunkte hinsichtlich des notwendigen Ausmaßes des Änderungsbedarfs.
Die fortdauernde Diskussion gibt Anlass dazu, sich einmal intensiv mit dem Phänomen der Pressekonzentration, dem Sinn und Zweck der Pressefusionskontrolle im Allgemeinen und der Wirksamkeit der derzeitigen Regelungen bzw. der geplanten Änderungen gegen ein Fortschreiten der Medienkonzentration auseinander zu setzen. Für den Fall der Unwirksamkeit sollen mögliche Alternativen aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Teil: Einleitung
- A. Anlass und Gegenstand der Arbeit
- B. Begrenzung der Arbeit
- I. Der Presse- und Zeitungsbegriff
- II. Gründe für die Konzentration der Arbeit auf Tageszeitungen
- 2. Teil: Konzentration auf Pressemärkten
- A. Der Konzentrationsbegriff
- B. Arten und Formen von Pressekonzentration
- C. Ursachen der Pressekonzentration
- I. Strukturelle Gründe
- 1. Technologischer Fortschritt
- 2. Die Anzeigen-Auflagen-Spirale
- 3. Kurzweiliger Konkurrenzkampf durch Mischkalkulation
- 4. Konzentrationsbegünstigung durch hohe Marktzutrittsschranken
- 5. Demographische Veränderungen
- 6. Gesellschaftlicher Wandel
- II. Konjunkturelle Gründe
- I. Strukturelle Gründe
- 3. Teil: Die Presselandschaft in Deutschland
- A. Merkmale des Zeitungsmarktes
- I. Monopolistische Strukturen auf lokalen und regionalen Märkten
- II. Engagement auf zwei Märkten: Der Leser- und Anzeigenmarkt
- III. Meinungen und Informationen im Zentrum des Wettbewerbs
- B. Die historische Entwicklung des Pressewesens
- I.
- II. Der Wiederaufbau der Presse nach dem Zweiten Weltkrieg
- III. 1954-1976: Die Phase der Pressekonzentration in der BRD
- IV. 1976-1985: Die Phase der Konsolidierung in der BRD
- V. 1985-1990: Die Presse vor der Wiedervereinigung in der BRD
- VI. Die Presse in der ehemaligen DDR
- VII. Der Pressemarkt im wiedervereinigten Deutschland
- VIII. Die deutsche Presselandschaft von 1995 bis heute
- IX. Ein Blick in die Zukunft
- A. Merkmale des Zeitungsmarktes
- 4. Teil: Maßnahmen gegen ein Fortschreiten der Pressekonzentration
- A. Die Notwendigkeit eines speziellen Schutzes der Presse
- B. Das Verhältnis der FKVO zur nationalen Wettbewerbsordnung
- I. Der Anwendungsbereich der FKVO
- II. Mögliche Ausnahme vom Exklusivitätsprinzip durch Berufung auf den Schutz berechtigter Interessen nach Art. 21 Abs. 4 FKVO
- C. Pressefusionskontrolle nach dem GWB
- I. Einführung und Novellierungen der Pressefusionskontrolle
- II. Funktionen der Pressefusionskontrolle
- III. Verfassungsmäßigkeit und Systematik der Pressefusionskontrolle
- IV. Die (Un-)Wirksamkeit der geltenden Vorschriften zur Pressefusionskontrolle
- 5. Teil: Die Modifikation der Pressefusionskontrolle
- A. Die unterschiedlichen Positionen von BMWi und BDZV
- I. Geplante Änderungen: Die Pressefusionskontrolle nach dem Referentenentwurf des Achten Gesetzes zur Änderung des GWB
- II. Weitergehende Änderungsforderungen: Die zukünftige Pressefusionskontrolle nach den Vorstellungen des BDZV
- B. Die Auswirkungen der Änderungen auf das Pressewesen und deren Bewertung
- I. Die zu erwartenden Effekte bei einer Änderung der Pressefusionskontrolle
- II. Eine Bewertung der geplanten und der geforderten Änderungen
- C. Alternative Modifikationsmöglichkeiten und deren Auswirkungen auf das Pressewesen
- I. Der Mittelweg: Liberalisierung der bestehenden Regelung, aber Verschärfung des Referentenentwurfs
- II. Die Abschaffung des Pressekontrollgesetzes
- A. Die unterschiedlichen Positionen von BMWi und BDZV
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Entwicklung der Medienlandschaft und die Wirksamkeit der Pressefusionskontrolle als Instrument gegen Medienkonzentration. Ziel ist es, die Ursachen der Konzentration, die aktuelle Situation des deutschen Pressemarktes und die Effektivität bestehender Regulierungen zu analysieren. Die Arbeit evaluiert außerdem verschiedene Modifikationsmöglichkeiten der Pressefusionskontrolle.
- Entwicklung der Medienkonzentration
- Ursachen der Pressekonzentration (strukturell und konjunkturell)
- Analyse des deutschen Zeitungsmarktes
- Wirksamkeit der Pressefusionskontrolle
- Möglichkeiten zur Modifikation der Pressefusionskontrolle
Zusammenfassung der Kapitel
1. Teil: Einleitung: Dieser einführende Teil legt den Gegenstand der Arbeit dar, nämlich die Analyse der Medienlandschaft und der Pressefusionskontrolle im Hinblick auf Medienkonzentration. Es werden die Grenzen der Arbeit definiert, insbesondere der Fokus auf Tageszeitungen, und der Begriff der Presse wird präzisiert.
2. Teil: Konzentration auf Pressemärkten: Dieser Abschnitt definiert den Begriff der Konzentration und beleuchtet verschiedene Arten und Formen. Die Ursachen der Pressekonzentration werden umfassend untersucht, sowohl strukturelle Faktoren wie technologischer Fortschritt, Anzeigen-Auflagen-Spirale und Marktzutrittsschranken als auch konjunkturelle Einflüsse werden berücksichtigt. Es wird die Interdependenz der verschiedenen Faktoren dargelegt.
3. Teil: Die Presselandschaft in Deutschland: Dieser Teil beschreibt die Merkmale des deutschen Zeitungsmarktes, insbesondere die monopolistischen Strukturen auf lokalen und regionalen Ebenen sowie die Dualität des Leser- und Anzeigenmarktes. Die historische Entwicklung des Pressewesens in Deutschland wird von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart nachgezeichnet, wobei die verschiedenen Phasen der Konzentration und Konsolidierung im Detail dargestellt werden.
4. Teil: Maßnahmen gegen ein Fortschreiten der Pressekonzentration: Dieser Teil untersucht die Notwendigkeit eines besonderen Schutzes der Presse und beleuchtet das Verhältnis der Fusionskontrollverordnung (FKVO) zur nationalen Wettbewerbsordnung. Die Funktionsweise und die (Un-)Wirksamkeit der Pressefusionskontrolle im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) werden kritisch analysiert. Verfassungsrechtliche Aspekte werden ebenfalls behandelt.
5. Teil: Die Modifikation der Pressefusionskontrolle: Hier werden unterschiedliche Positionen zum Thema Pressefusionskontrolle, insbesondere die des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), gegenübergestellt. Geplante und geforderte Änderungen werden vorgestellt und ihre potenziellen Auswirkungen auf das Pressewesen bewertet. Alternativen zur Modifikation werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Pressekonzentration, Medienlandschaft, Fusionskontrolle, Tageszeitungen, GWB, FKVO, Medienmarkt, Wettbewerbsordnung, Medienökonomie, monopolistische Strukturen, Anzeigen-Auflagen-Spirale, technologischer Fortschritt, gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Pressekonzentration in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit analysiert die Entwicklung der Medienlandschaft in Deutschland und die Wirksamkeit der Pressefusionskontrolle als Instrument gegen Medienkonzentration. Der Fokus liegt dabei auf Tageszeitungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ursachen der Pressekonzentration (strukturelle und konjunkturelle Faktoren), die aktuelle Situation des deutschen Zeitungsmarktes, die Effektivität der bestehenden Pressefusionskontrolle und verschiedene Möglichkeiten zur Modifikation dieser Kontrolle. Die historische Entwicklung des deutschen Pressewesens wird ebenfalls umfassend dargestellt.
Welche Ursachen für Pressekonzentration werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl strukturelle Ursachen wie technologischer Fortschritt, die Anzeigen-Auflagen-Spirale, hohe Marktzutrittsschranken, demografische Veränderungen und gesellschaftlichen Wandel, als auch konjunkturelle Gründe.
Wie wird der deutsche Zeitungsmarkt beschrieben?
Der deutsche Zeitungsmarkt wird als geprägt von monopolistischen Strukturen auf lokalen und regionalen Märkten beschrieben. Die Arbeit betont die Dualität des Leser- und Anzeigenmarktes und die Bedeutung von Meinungen und Informationen im Wettbewerb.
Was ist die Pressefusionskontrolle und wie wird sie bewertet?
Die Pressefusionskontrolle ist ein Instrument, um die Konzentration im Pressewesen zu begrenzen. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise und die (Un-)Wirksamkeit der Pressefusionskontrolle im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und beleuchtet verfassungsrechtliche Aspekte. Die Effektivität der bestehenden Regulierungen wird kritisch bewertet.
Welche Modifikationsmöglichkeiten der Pressefusionskontrolle werden diskutiert?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Positionen zum Thema Pressefusionskontrolle, insbesondere die des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Geplante und geforderte Änderungen werden vorgestellt und ihre potenziellen Auswirkungen bewertet. Alternative Modifikationsmöglichkeiten, einschließlich einer möglichen Abschaffung des Pressekontrollgesetzes, werden diskutiert.
Welche Phasen der Entwicklung des deutschen Pressewesens werden betrachtet?
Die Arbeit verfolgt die historische Entwicklung des deutschen Pressewesens von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart nach, wobei die verschiedenen Phasen der Konzentration und Konsolidierung im Detail dargestellt werden (Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, 1954-1976, 1976-1985, 1985-1990, die Presse in der ehemaligen DDR, der wiedervereinigte Markt und die Entwicklung von 1995 bis heute).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pressekonzentration, Medienlandschaft, Fusionskontrolle, Tageszeitungen, GWB, FKVO, Medienmarkt, Wettbewerbsordnung, Medienökonomie, monopolistische Strukturen, Anzeigen-Auflagen-Spirale, technologischer Fortschritt, gesellschaftlicher Wandel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert: Einleitung, Konzentration auf Pressemärkten, Die Presselandschaft in Deutschland, Maßnahmen gegen ein Fortschreiten der Pressekonzentration und Die Modifikation der Pressefusionskontrolle. Jeder Teil ist in mehrere Unterkapitel unterteilt (siehe Inhaltsverzeichnis).
- Quote paper
- Michael Vitt (Author), 2011, Medienlandschaft im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192146