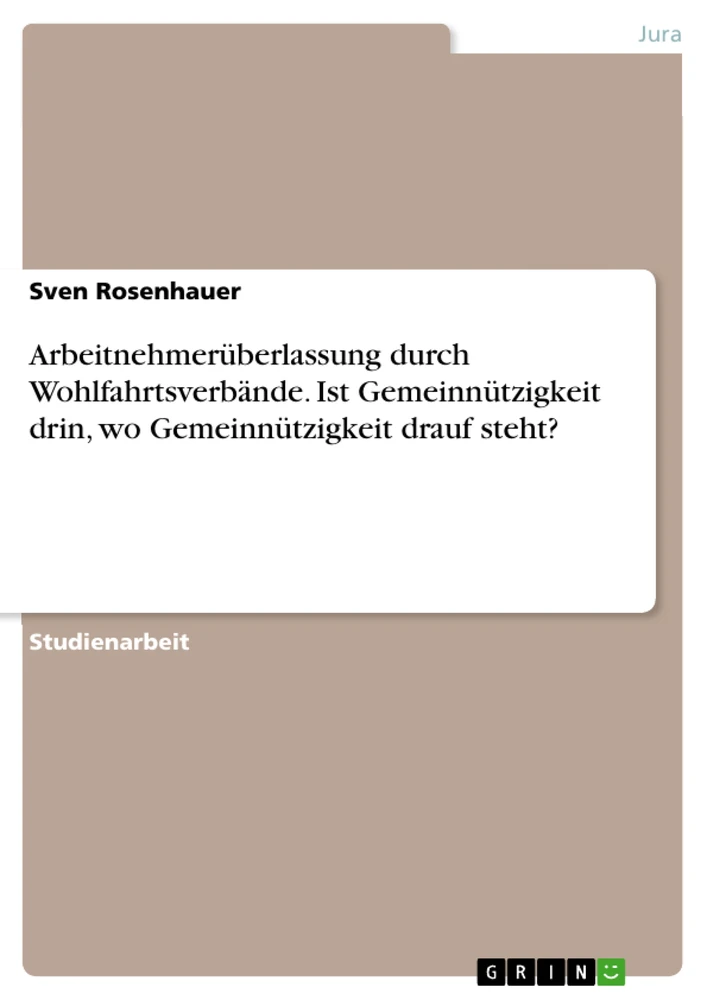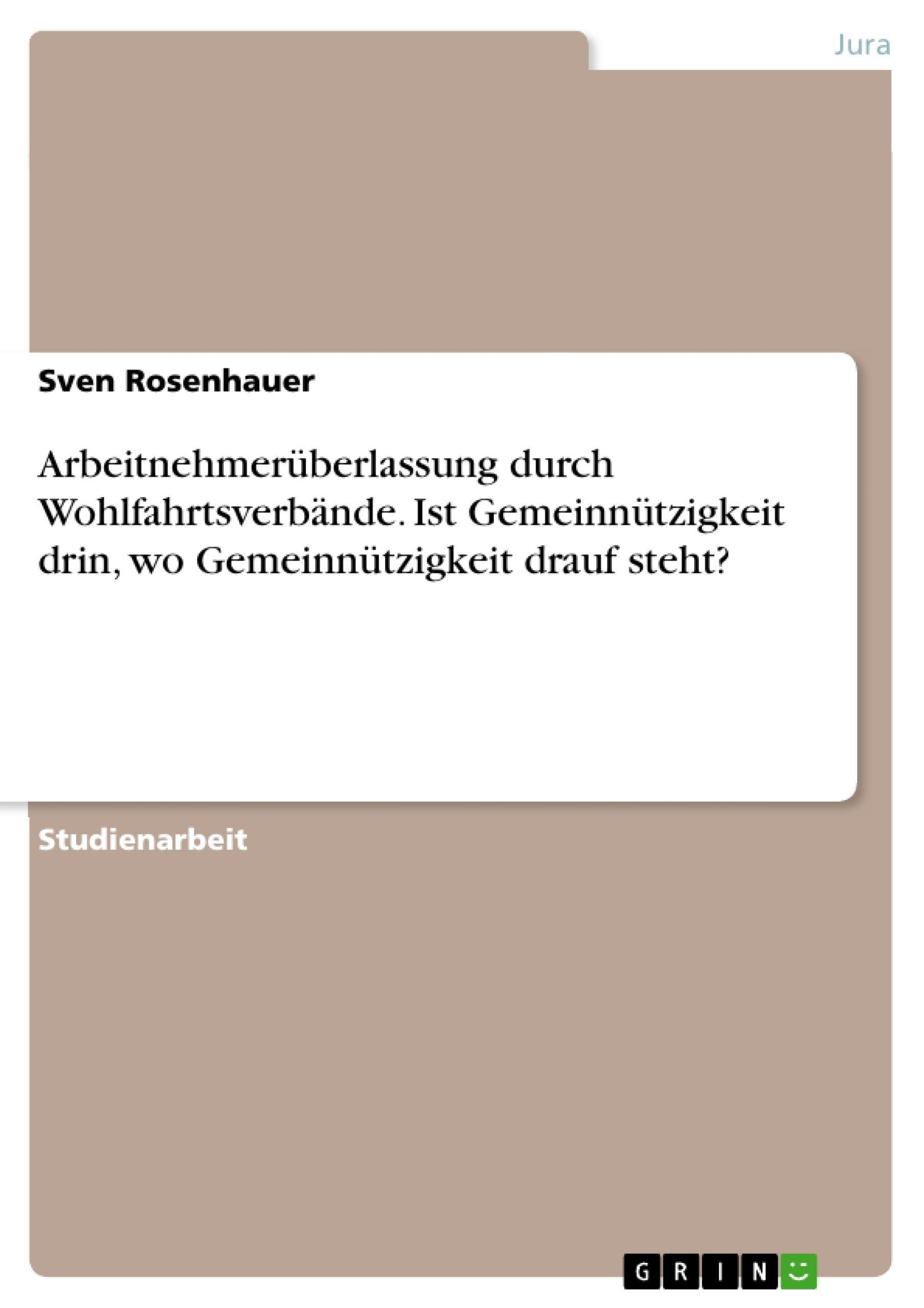Das arbeitsmarktpolitische Modell der Arbeitnehmerüberlassung steht zunehmend im Mittelpunkt arbeitsrechtlicher, politischer und sozialer Diskussionen – vor allem wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit von Leiharbeitnehmern. Die vorliegende Arbeit knüpft genau an diese Diskussion an und untersucht den unternehmerischen Umgang mit dem arbeitsmarktpolitischen Instrument der Arbeitnehmerüberlassung und der sich daraus ergebenden Schutzbedürftigkeit der Leiharbeitnehmer.
Insgesamt ist der Einsatz von Leiharbeitnehmern für viele Unternehmen ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument geworden, um flexibel auf Nachfragespitzen oder Auftragsflauten reagieren zu können. Das Modell Arbeitnehmerüberlassung ist für die Dynamik des Arbeitsmarktes von wesentlicher Bedeutung geworden, denn es bietet vor allem arbeitslosen Bürgern eine Chance auf ein sozial abgesichertes Beschäftigungsverhältnis: Auch eine Arbeitnehmerüberlassung verschafft in der Regel volle sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und gibt Perspektiven. Ein Großteil der Leiharbeitnehmer wechselt anschließend in ein, wenn auch nur mittelfristiges, aber dennoch festes Arbeitsverhältnis.
Am Modell der Arbeitnehmerüberlassung bedienen sich mittlerweile nahezu alle Branchen – von Banken, Handwerks- und Handelsunternehmen über medizinische und soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altenheime. So kam es, dass derzeit in Deutschland mehr als eine Million Leiharbeitnehmer beschäftigt sind. Zwischen 2003 und 2008 war fast jedes zehnte neu entstandene sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis ein Leiharbeitsverhältnis. Bei der öffentlichen Diskussion um die Frage “Arbeitnehmerüberlassung – Chance oder Missbrauch“ wird häufig kritisch auf die Motive sowohl der Verleiher als auch der Entleiher von Arbeitnehmern geschaut.
Inhaltsverzeichnis
- Präsenz des Themas
- Begriffsbestimmungen und Grundlagendefinitionen
- Arbeitnehmerüberlassung
- Leiharbeitnehmer
- Verleiher
- Entleiher
- Arbeitnehmerüberlassung und spezifische Schutzbedürftigkeit
- Rahmenbedingungen einer Arbeitnehmerüberlassung
- Spezifische Schutzbedürftigkeit
- Entstehung und Entwicklung des AÜG
- Geschichtliche Entwicklungen des AÜG
- Gemeinnützige Organisationen im Anwendungsbereich des AÜG
- Das AÜG a.F. in der Praxis- Chance oder Missbrauch?
- Gewerbliche Organisationen und Leiharbeit
- Gemeinnützige Organisationen und Leiharbeit
- Inhalte und Auswirkungen der aktuellen Gesetzesreform
- Erlaubnispflicht im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit
- Erlaubnispflicht im Rahmen einer vorübergehenden Überlassung
- Erlaubnispflicht im Rahmen einer gelegentlichen Überlassung
- Versagung einer Arbeitnehmerüberlassung
- Das neue AÜG und gemeinnützige Organisationen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz von Arbeitnehmerüberlassung durch gemeinnützige Organisationen, insbesondere Wohlfahrtsverbände. Sie analysiert die Entwicklung des AÜG und dessen Regulierung des Arbeitsverhältnisses im Kontext von Leiharbeit. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, ob die Anwendung des Modells Arbeitnehmerüberlassung durch gemeinnützige Organisationen im Einklang mit den Prinzipien der Gemeinnützigkeit steht.
- Entwicklung und Regulierung des AÜG
- Schutzbedürftigkeit von Leiharbeitnehmern
- Gemeinnützigkeit und Leiharbeit
- Einsatz von Arbeitnehmerüberlassung durch Wohlfahrtsverbände
- Kritische Betrachtung der Praxis der Arbeitnehmerüberlassung durch gemeinnützige Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Präsenz des Themas: Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz des Themas Arbeitnehmerüberlassung und deren zunehmende Bedeutung im Kontext von arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Debatten. Es stellt den Fokus auf die Schutzbedürftigkeit von Leiharbeitnehmern dar und beleuchtet Kritikpunkte sowie aktuelle Debatten um mögliche Missbräuche des Modells.
- Kapitel 2: Begriffsbestimmungen und Grundlagendefinitionen: Dieses Kapitel liefert eine grundlegende Definition der Arbeitnehmerüberlassung, der Leiharbeitnehmer, des Verleihers und des Entleihers. Es bildet so das Fundament für das Verständnis der weiteren Ausführungen.
- Kapitel 3: Arbeitnehmerüberlassung und spezifische Schutzbedürftigkeit: Dieses Kapitel widmet sich den Rahmenbedingungen der Arbeitnehmerüberlassung und untersucht die besonderen Schutzbedürfnisse von Leiharbeitnehmern im Vergleich zu festangestellten Mitarbeitern.
- Kapitel 4: Entstehung und Entwicklung des AÜG: In diesem Kapitel wird die Geschichte des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) beleuchtet und die Rolle gemeinnütziger Organisationen im Anwendungsbereich des Gesetzes beleuchtet.
- Kapitel 5: Das AÜG a.F. in der Praxis- Chance oder Missbrauch?: Dieses Kapitel analysiert die Anwendung des AÜG in der Praxis und hinterfragt, ob es sich bei der Arbeitnehmerüberlassung um eine Chance oder einen Missbrauch handelt. Es werden dabei die Perspektiven gewerblicher und gemeinnütziger Organisationen betrachtet.
- Kapitel 6: Inhalte und Auswirkungen der aktuellen Gesetzesreform: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Reform des AÜG und analysiert deren Auswirkungen auf die Praxis der Arbeitnehmerüberlassung. Dabei werden die neuen Regelungen zur Erlaubnispflicht und deren Bedeutung für gemeinnützige Organisationen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmerüberlassung, Leiharbeit, AÜG, Gemeinnützigkeit, Wohlfahrtsverbände, Schutzbedürftigkeit, sozialpolitische Debatte, Arbeitsrecht, Personalkosten, Missbrauch, Gesetzesreform, Erlaubnispflicht, Praxisanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Nutzen auch Wohlfahrtsverbände die Arbeitnehmerüberlassung?
Ja, soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Altenheime, die oft von Wohlfahrtsverbänden getragen werden, nutzen Leiharbeit, um flexibel auf Personalbedarf zu reagieren.
Ist Leiharbeit mit dem Prinzip der Gemeinnützigkeit vereinbar?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob der Einsatz von Leiharbeitnehmern zur Kostensenkung den ethischen Werten gemeinnütziger Organisationen widerspricht oder eine notwendige wirtschaftliche Maßnahme ist.
Was regelt das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)?
Das AÜG bildet den rechtlichen Rahmen für die Überlassung von Mitarbeitern und soll insbesondere den Schutz der Leiharbeitnehmer sicherstellen.
Warum gelten Leiharbeitnehmer als besonders schutzbedürftig?
Sie stehen oft in einem prekäreren Beschäftigungsverhältnis, erhalten teilweise geringere Löhne als die Stammbelegschaft und haben ein höheres Risiko für Arbeitsplatzverlust.
Welche Chancen bietet die Arbeitnehmerüberlassung für Arbeitslose?
Sie dient oft als „Klebeeffekt“: Viele Leiharbeitnehmer erhalten über diesen Weg die Chance auf eine spätere Festanstellung im Entleihbetrieb.
Was hat sich durch die aktuelle Gesetzesreform des AÜG geändert?
Die Reform verschärfte die Erlaubnispflichten und regelt genauer, wann eine Überlassung als vorübergehend oder gelegentlich gilt, was auch Auswirkungen auf gemeinnützige Träger hat.
- Quote paper
- Sven Rosenhauer (Author), 2012, Arbeitnehmerüberlassung durch Wohlfahrtsverbände. Ist Gemeinnützigkeit drin, wo Gemeinnützigkeit drauf steht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192169