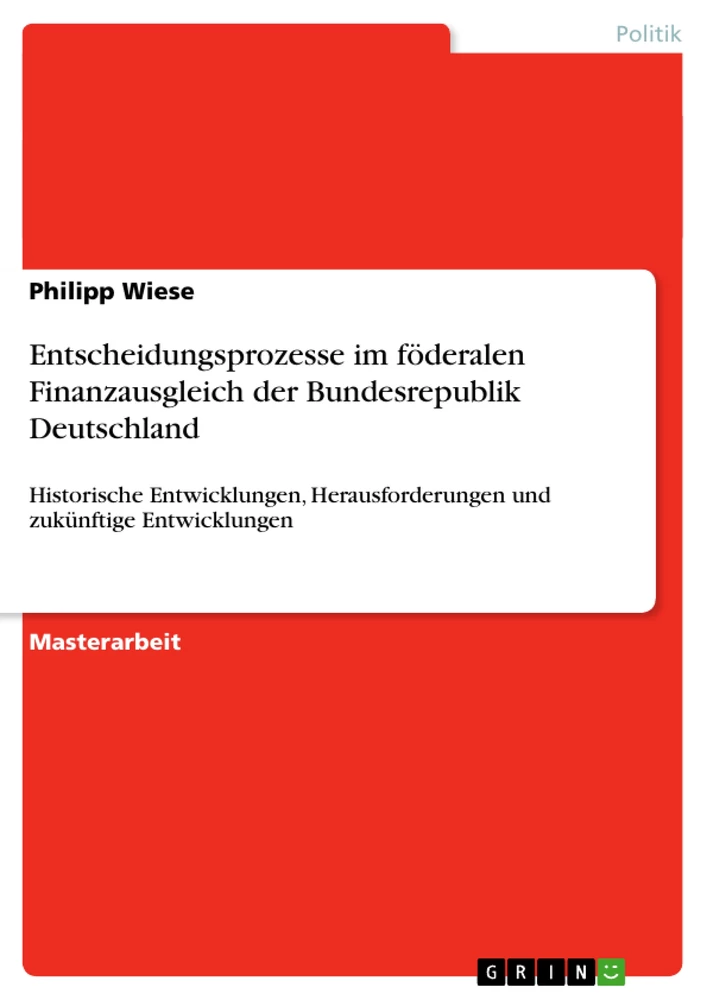Der Länderfinanzausgleich, wenngleich selten Gegenstand breiter öffentlicher politischer Debatte, ist nichtsdestotrotz eine der großen Dauerkontroversen der deutschen Politik.
Aber wo kommt er her, warum gibt es ihn, wie ist er ausgestaltet und welche Zukunft hat er. All diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden. Aufgezogen wird dabei ein Gemälde, das die historische Entwicklung des deutschen Finanzausgleichs nachzeichnet.
Die Arbeit beginnt mit einem methodischen Teil, in dem die theoretischen, definitorischen und untersuchungs-prozessualen Bedingungen dargestellt und vorgestellt werden. Dabei wird am Rande auch die umfängliche Literatursituation zum Thema Länderfinanzausgleich dargestellt. Die wesentliche theoretische Annahme zur Basis dieser Arbeit, die zudem die nachstehenden Äußerungen leitet, ist die Annahme, dass es eine historisch konsistente Pfadabhängigkeit gibt; diese herauszuarbeiten, wird in den nachfolgenden Abschnitten vorgenommen.
Die vorliegende Arbeit greift im dritten Teil bezüglich des Finanzausgleichs weit zurück, hier wird die Vor- und Frühgeschichte des Finanzausgleichs beschrieben. Vielfach wurde der deutsche Finanzausgleich als „spezifisch deutsch“, „kompliziert“ und chaotisch beschrieben. Die Zusammenfassung der Meinungen gipfelt in dem Professorenwitz: „Es gibt nur zwei Leute, die den deutschen Länderfinanzausgleich verstanden haben, der eine ist tot und der andere redet nicht darüber.“ Diese humoristische Zusammenfassung trifft das Problem im Kern, der Rückgriff auf die Vorgeschichte zeigt allerdings auch, dass das hohe Maß an Komplexität des deutschen Ausgleichs einer historischen Traditionslinie folgt.
Der Schwerpunkt der Arbeit wird jedoch darauf liegen, die Entwicklungen des Ausgleichs in der Bundesrepublik nachzuzeichnen, dabei geht es um die Entwicklung zwischen 1949 und 1969, die Zeit bis zur Wiedervereinigung und nach der Einheit. dies ist der wesentliche Inhalt der nachfolgenden Teile. Abschließend wird ein Ausblick auf aktuelle Herausforderungen gegeben, vor denen der föderalistische Finanzausgleich steht. Dabei wird auf die unvollendete Föderalismusreform II eingegangen, aber auch darauf, wie vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Integration ein Konstrukt wie der föderalistische Finanzausgleich leistungsfähig und effizient erhalten werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen / Methodik / Fragestellung / Relevanz
- Definition
- Theoretische Vorüberlegungen
- Föderalismusmodelle
- Politikverflechtung
- Strukturbruchhypothese
- Dynamischer Föderalismus
- Fragestellung
- Der Länderfinanzausgleich 1949 bis zur Wiedervereinigung
- Vorentscheidungen im Parlamentarischen Rat
- Bis 1969
- Die Finanzreform von 1969
- Systematik des prä-Vereinigungsfinanzausgleich
- Vertikale Steuerverteilung
- Horizontale Steuerverteilung
- Verteilungsprinzipien
- Zwischenfazit
- Der Länderfinanzausgleich seit der Wiedervereinigung
- Die Einheit
- Die Verhandlungen
- Das (Zwischen-) Ergebnis
- Bewertung der Ergebnisse
- Die Integration der „neuen“ Länder in den Finanzausgleich
- BVerfGE von 1992
- Reformüberlegungen der Bundesländer
- Die Meinung des Bundes
- Die Verhandlungen und der Verlauf
- Das Verhandlungsergebnis
- Bewertung
- Die Reform von 2001
- Reformverlangen der Geberländer
- BVerfGE 1999
- Verhandlungsverlauf
- Der Finanzausgleich und der Solidarpakt II als Ergebnis
- Das Maßstäbegesetz
- Der Finanzausgleich
- Zwischenfazit
- Die Einheit
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entscheidungsfindung im deutschen Länderfinanzausgleich. Dabei wird der Fokus auf die historischen Entwicklungen gelegt, die Herausforderungen des Systems beleuchtet und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben. Die Arbeit analysiert die Prozesse der Entscheidungsfindung im Finanzausgleich unter besonderer Berücksichtigung des föderalen Systems in Deutschland.
- Historische Entwicklung des Länderfinanzausgleichs
- Herausforderungen des Systems im Kontext des deutschen Föderalismus
- Relevanz des Finanzausgleichs für die politische Stabilität und die Entwicklung der Bundesländer
- Einfluss von Politikverflechtung und Strukturbruchhypothesen auf den Finanzausgleich
- Zukünftige Entwicklungen des Finanzausgleichs im Hinblick auf demografische Veränderungen und fiskalische Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik des Länderfinanzausgleichs ein und definiert die wichtigsten Begriffe, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden. Es werden außerdem die Methodik, die Fragestellung und die Relevanz der Arbeit erläutert.
Das zweite Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Länderfinanzausgleichs von 1949 bis zur Wiedervereinigung. Es werden die Vorentscheidungen im Parlamentarischen Rat, die Entwicklung bis 1969 und die Finanzreform von 1969 sowie die Systematik des prä-Vereinigungsfinanzausgleichs beleuchtet. Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Länderfinanzausgleich seit der Wiedervereinigung. Hier werden die Verhandlungen zur Integration der „neuen“ Länder, das Verhandlungsergebnis und die Bewertung der Ergebnisse dargestellt. Die Kapitel betrachten die verschiedenen Reformüberlegungen der Bundesländer und des Bundes sowie die Integration des Finanzausgleichs in den Solidarpakt II.
Schlüsselwörter
Länderfinanzausgleich, Föderalismus, Entscheidungsfindung, Politikverflechtung, Strukturbruchhypothese, Dynamischer Föderalismus, historische Entwicklung, Herausforderungen, zukünftige Entwicklungen, Deutschland, Bundesländer, Solidarpakt, Finanzierung, Steuern, Verhandlungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Länderfinanzausgleich?
Es ist ein System zur Umverteilung von Steuereinnahmen zwischen dem Bund und den Bundesländern sowie zwischen den Ländern untereinander, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern.
Warum gilt der Finanzausgleich als historisch pfadabhängig?
Die Arbeit argumentiert, dass die hohe Komplexität des heutigen Systems auf eine lange historische Traditionslinie zurückgeht, die bis in die Vor- und Frühgeschichte der Bundesrepublik reicht.
Welche Auswirkungen hatte die Wiedervereinigung auf den Finanzausgleich?
Die Integration der neuen Bundesländer erforderte massive Reformen und führte zu langwierigen Verhandlungen über die Verteilung der Lasten zwischen alten und neuen Ländern.
Was ist die "Politikverflechtung" in diesem Zusammenhang?
Sie beschreibt die enge institutionelle Verzahnung von Bund und Ländern bei der Entscheidungsfindung, die oft zu Kompromisszwängen und Reformstau führen kann.
Was war der Kern der Reform von 2001?
Die Reform basierte auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und führte zum Maßstäbegesetz sowie zum Solidarpakt II.
Vor welchen zukünftigen Herausforderungen steht das System?
Herausforderungen sind demografische Veränderungen, internationale fiskalische Integration und die Notwendigkeit, das System effizient und leistungsfähig zu halten.
- Citar trabajo
- Philipp Wiese (Autor), 2012, Entscheidungsprozesse im föderalen Finanzausgleich der Bundesrepublik Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192251