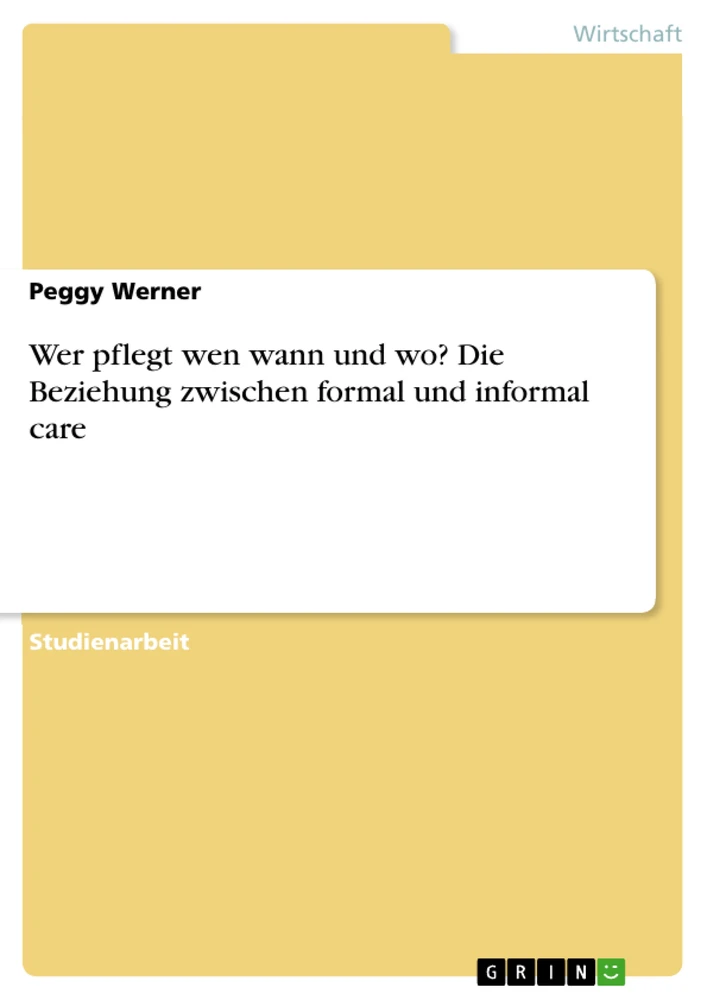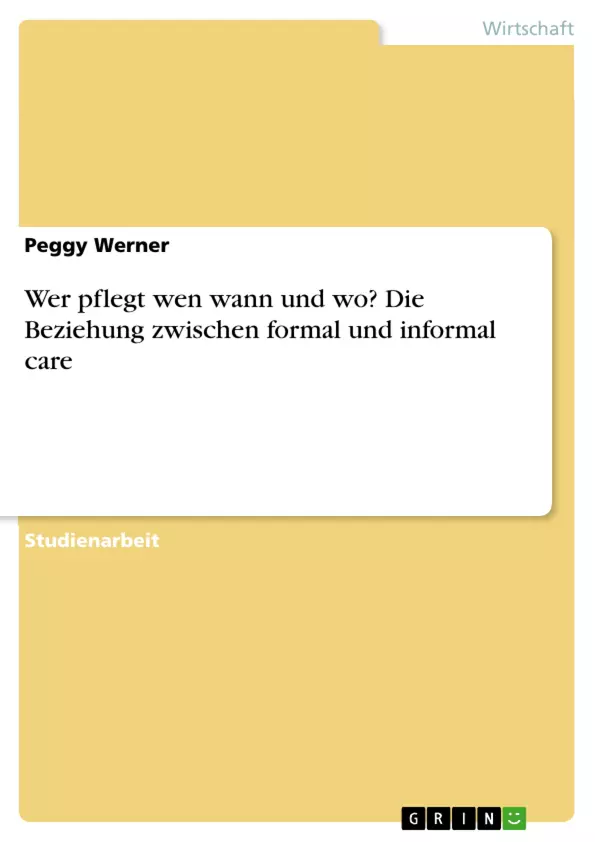Eine überalterte und zugleich unterjüngte Gesellschaft stellt hohe Anforderungen an ein Altenpflegesystem. Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen kann informal care zunehmend als wichtiges Standbein einer funktionierenden Altenpflege betrachtet werden. Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, einen thematisch breiten Einblick in die Forschungsaktivitäten des Themenbereiches um formal und informal care, insbesondere bezüglich deren Beziehung zueinander, zu geben. Die Analyseergebnisse zeigen, dass zwischen ihnen sowohl Substitutions- als auch Ergänzungsbeziehungen bestehen. Informal care ist im Falle geringer Pflegeansprüche ein effektiver Ersatz für formal care Leistungen. Informal care von Pflegebedürftigen wird zumeist von deren unverheirateten Kindern, die geringe Opportunitätskosten haben, geleistet. Die Entscheidung für die Übernahme von informal care Aufgaben wird von rationalen und irrationalen Aspekten determiniert. Der Einsatz von informal care reduziert die staatlichen Ausgaben für formal care durch die Reduktion ihrer Inanspruchnahme. Existierende Forschungsergebnisse in Kombination mit aktuellen, sozialen Entwicklungstendenzen implizieren politischen Handlungsbedarf, zu dem beispielsweise die gezielte Förderung und Motivation von Pflege durch Angehörige oder auch der Ausbau des professionellen Altenpflegeangebots gehören.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themengrundlage
- Problem- und Zielstellung
- Forschungsfragen
- Aufbau der Arbeit
- Methodische Vorgehensweise
- Definitorische Grundlage
- Formal Care
- Informal Care
- Situation in Deutschland
- Die Beziehung zwischen formal und informal care
- Ersatzbeziehungen
- Ergänzungsbeziehungen
- Komplexität der Beziehung
- Europäische Unterschiede
- Charakteristika pflegender Angehöriger
- Kennzeichnende Eigenschaften
- Pflegebereitschaft
- Implikationen für die Politik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Forschungsaktivitäten im Bereich von formal und informal care zu geben, insbesondere bezüglich deren Beziehung zueinander. Sie analysiert die komplexen Zusammenhänge zwischen professioneller Altenpflege und häuslicher Pflege durch Angehörige und trägt so zum Verständnis des Wertes von informal care bei.
- Beziehungen zwischen formal und informal care
- Charakteristika pflegender Angehöriger
- Motivation und Determinanten für die Übernahme von informal care Aufgaben
- Kosten- und Qualitätsaspekte von formal und informal care
- Politische Implikationen und Handlungsbedarf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Themengrundlage, die Problem- und Zielstellung sowie die Forschungsfragen der Arbeit vor. Kapitel 2 schafft eine definitorische Grundlage für formal und informal care. Kapitel 3 gibt einen Einblick in die Situation der Altenpflege in Deutschland. Kapitel 4 analysiert die Beziehung zwischen formal und informal care, wobei sowohl Ersatz- als auch Ergänzungsbeziehungen im Fokus stehen. Kapitel 5 befasst sich mit den Charakteristika pflegender Angehöriger, insbesondere mit ihren Eigenschaften und ihrer Pflegebereitschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themenbereichen von formal und informal care, deren Beziehung zueinander, den Charakteristika pflegender Angehöriger sowie den politischen Implikationen der Forschungsergebnisse. Wichtige Schlagwörter sind: Altenpflege, Langzeitpflege, häusliche Pflege, Angehörige, Pflegebereitschaft, Substitutions- und Ergänzungsbeziehungen, Kosten- und Qualitätsaspekte, demografischer Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen formal und informal care?
Formal care bezeichnet professionelle Pflegeleistungen, während informal care die Pflege durch Angehörige, Freunde oder Nachbarn meint.
Ersetzt häusliche Pflege die professionelle Pflege?
Die Studie zeigt, dass bei geringen Pflegeansprüchen informal care oft als effektiver Ersatz (Substitution) für formal care dient.
Wer leistet in Deutschland meistens die informal care?
Häufig übernehmen unverheiratete Kinder mit geringen Opportunitätskosten die Pflegeaufgaben für ihre Angehörigen.
Welche politischen Implikationen ergeben sich aus der Forschung?
Es besteht Handlungsbedarf bei der Förderung pflegender Angehöriger und dem gleichzeitigen Ausbau professioneller Angebote aufgrund des demografischen Wandels.
Wie beeinflusst häusliche Pflege die Staatsausgaben?
Durch den Einsatz von informal care werden staatliche Ausgaben reduziert, da professionelle Leistungen seltener in Anspruch genommen werden.
- Quote paper
- Peggy Werner (Author), 2010, Wer pflegt wen wann und wo? Die Beziehung zwischen formal und informal care, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192349