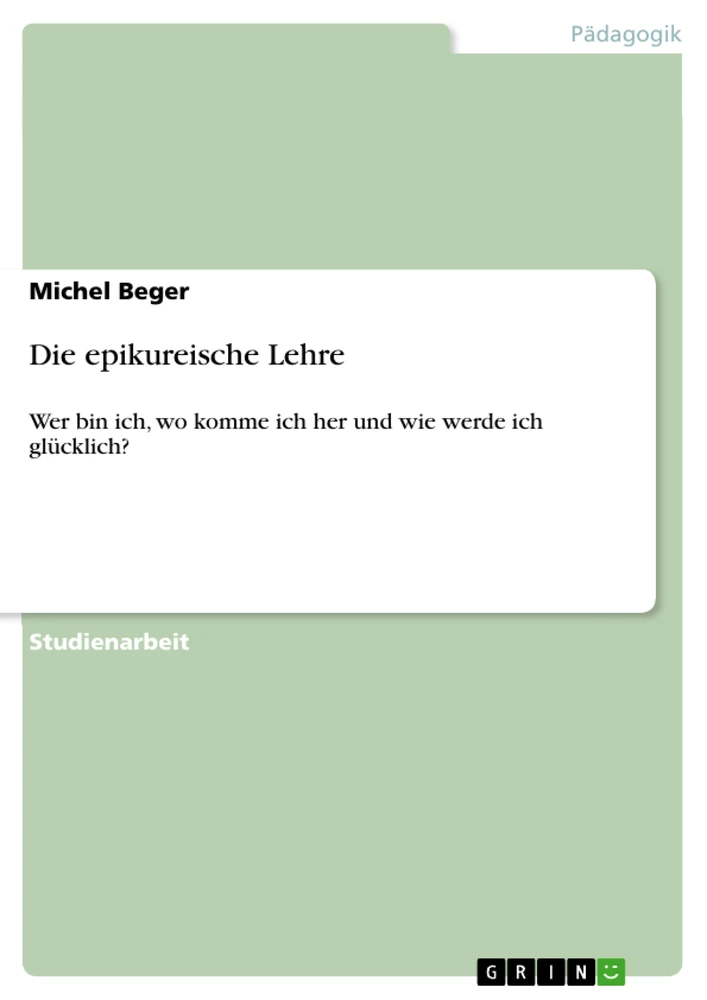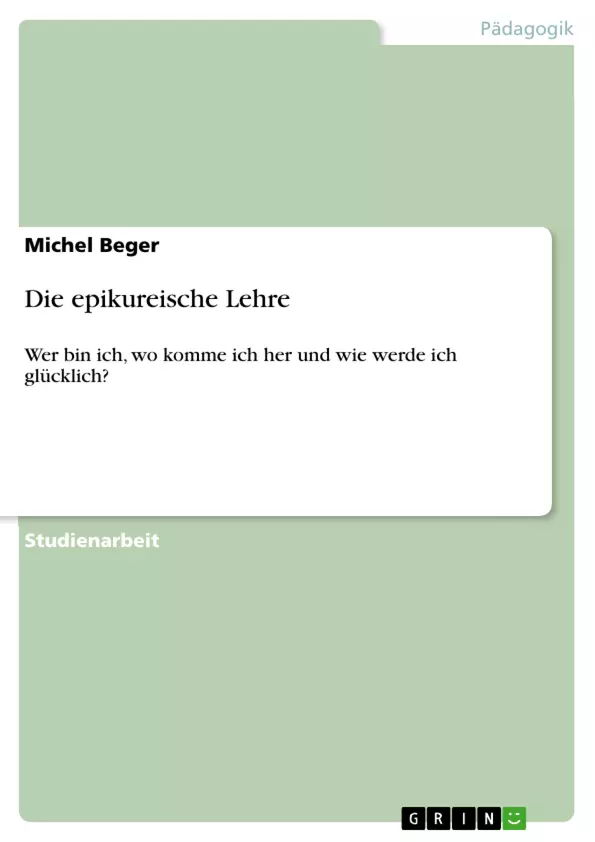Was bedeutet glücklich sein? Was heißt eigentlich Glück und worin besteht es? Diese Fragen sind ohne jeden Zweifel äußerst subjektiv zu betrachten. Das Glück stellt sich für jeden Men-schen anders dar. Für den Einen ist es die Familie, für den Anderen der Lottogewinn, für den Einen sei es das wiedergefundene Portemonnaie, für den Anderen ein gerade noch abgewehr-ter Unfall. Empirische Erhebungen zum Thema „Was ist Glück?“ hätten daher auch nur wenig Aussagekraft. Eine wesentlich höhere Aussagekraft hat allerdings die Frage „Wer war Epikur?“. In einer eigens durchgeführten Befragung anhand zufällig ausgewählter Passanten wurde festgestellt, dass gerade einmal zwei von 37 Befragten diesen Namen kennen. Auf die Frage „Woher?“, fiel zum einen die Antwort „Das ist doch so eine Elektroband auf Youtu-be.“, welche nicht wirklich etwas mit dem Thema zu tun hat. Zum anderen ergab sich verblüf-fenderweise dann doch noch die Antwort “Griechischer Philosoph; Lustprinzip; kenne ich aus der Schule.“. Diese Antwort hätte man sich von der Mehrheit wünschen können, doch an-scheinend ist dieser Name weniger bekannt, als es sein Einfluss auf die heutige Zeit ist. Das Thema der Lust ist dabei in unserer Gesellschaft, in welcher der Verkaufsschlager nun einmal Sex heißt, mannigfaltig integriert. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll jedoch nicht nur auf dem Lustkalkül, sondern vielmehr auf der Betrachtung des Glückes im Allgemeinen liegen: Wie und wodurch gelangt der Mensch zum Glück? Das ist die Frage, die versucht werden soll, beantwortet zu werden. Um diesen Punkt auch nur in Ansätzen diskutieren zu können, sind andere Aspekte essentiell. Daher beschäftigt sich diese Arbeit zunächst mit Epikurs Naturphilosophie und geht dabei im speziellen auf den Aufbau des Ganzen und die drei Wahrheitskriterien ein. Dies ist notwendig, da die Naturphilosophie Epikurs eine systematische Vorbedingung der ethischen Frage nach dem Glück ist. Abschließend soll – begründet durch die fatale Umfrage – ein Versuch getätigt werden, in dem veranschaulicht werden soll, dass der Epikureismus moderner ist, als geglaubt wird. Nicht zuletzt soll auch die Frage beantwortet werden „Wer bin ich, wo komme ich her und wie werde ich glücklich?“.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- Die Lehre Epikurs
- Das Bild der Wirklichkeit
- Die Grundsätze
- Der Aufbau des Ganzen
- Über Begierden und Lust
- Der Versuch einer Modernisierung des Epikureismus
- Das Bild der Wirklichkeit
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Epikurs Lehre und ihre Relevanz für die Frage nach dem Glück. Sie beleuchtet Epikurs Naturphilosophie, insbesondere den Aufbau der Welt und seine Wahrheitskriterien, um die ethische Frage nach dem Glück zu erörtern. Schließlich wird versucht, die Aktualität des Epikureismus im modernen Kontext aufzuzeigen.
- Epikurs Definition von Glück und seine Relevanz für die heutige Zeit
- Analyse der epikureischen Naturphilosophie und ihrer drei Wahrheitskriterien
- Der Aufbau des Ganzen nach Epikur: Atome, Leere und Bewegung
- Epikurs Konzeption von Begierden und Lust
- Der Versuch einer Modernisierung des Epikureismus
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Einführung: Diese Einleitung beleuchtet die subjektive Natur des Glücks und stellt die Frage nach Epikurs Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Anhand einer Umfrage wird die geringe Bekanntheit Epikurs im Kontrast zu seinem Einfluss auf das Verständnis von Lust und Glück hervorgehoben. Die Arbeit kündigt ihre Auseinandersetzung mit Epikurs Naturphilosophie als Grundlage für die ethische Frage nach dem Glück an und plant einen Versuch der Modernisierung des Epikureismus.
Die Lehre Epikurs: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über das Leben und Wirken Epikurs, von seinen philosophischen Anfängen bis zur Gründung seiner Schule in Athen. Es thematisiert die spärlichen Quellen zu Epikurs Philosophie und nennt wichtige Überlieferer seiner Gedanken. Der Fokus liegt auf der Darstellung der biographischen Entwicklung des Philosophen und der verfügbaren Quellenlage zur Rekonstruktion seines Werks.
Das Bild der Wirklichkeit: Dieses Kapitel beschreibt Epikurs vier grundlegende Prinzipien, die sein Weltbild prägen: Nichts entsteht aus dem Nichts, nichts vergeht ins Nichts, das Universum ist einzigartig und unveränderlich, und es besteht aus Atomen und Leere. Es werden die einzelnen Grundsätze im Detail erläutert und ihre Bedeutung für Epikurs Philosophie herausgestellt. Die Unteilbarkeit der Atome, ihre ständige Bewegung im leeren Raum und das Zusammenspiel dieser Elemente werden als grundlegend für das Verständnis der epikureischen Kosmologie dargestellt.
Über Begierden und Lust: (Anmerkung: Da der Text an dieser Stelle endet, kann keine Zusammenfassung dieses Kapitels erstellt werden.)
Der Versuch einer Modernisierung des Epikureismus: (Anmerkung: Da der Text an dieser Stelle endet, kann keine Zusammenfassung dieses Kapitels erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Epikur, Epikureismus, Glück, Lust, Naturphilosophie, Atome, Leere, Wahrheitskriterien, Modernisierung, Antike Philosophie
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Epikurs Lehre und ihre Relevanz für die Frage nach dem Glück
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Lehre Epikurs und ihre Relevanz für die Frage nach dem Glück. Sie beleuchtet Epikurs Naturphilosophie, insbesondere den Aufbau der Welt und seine Wahrheitskriterien, um die ethische Frage nach dem Glück zu erörtern. Schließlich wird versucht, die Aktualität des Epikureismus im modernen Kontext aufzuzeigen. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Darstellung der Lehre Epikurs (inkl. Weltbild, Begierden und Lust), und einen Versuch einer Modernisierung des Epikureismus. Leider ist der bereitgestellte Text unvollständig und enthält keine vollständigen Kapitelzusammenfassungen für die Kapitel "Über Begierden und Lust" und "Der Versuch einer Modernisierung des Epikureismus".
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Epikurs Definition von Glück und seine Relevanz für die heutige Zeit; Analyse der epikureischen Naturphilosophie und ihrer drei Wahrheitskriterien; Der Aufbau des Ganzen nach Epikur (Atome, Leere und Bewegung); Epikurs Konzeption von Begierden und Lust; und den Versuch einer Modernisierung des Epikureismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Zur Einführung; Die Lehre Epikurs (inkl. Unterkapitel: Das Bild der Wirklichkeit, Über Begierden und Lust, Der Versuch einer Modernisierung des Epikureismus); und Zusammenfassung und Fazit.
Was sind die Schlüsselwörter der Arbeit?
Die Schlüsselwörter der Arbeit sind: Epikur, Epikureismus, Glück, Lust, Naturphilosophie, Atome, Leere, Wahrheitskriterien, Modernisierung, Antike Philosophie.
Wie wird Epikurs Naturphilosophie dargestellt?
Epikurs Naturphilosophie wird anhand seiner vier grundlegenden Prinzipien erläutert: Nichts entsteht aus dem Nichts, nichts vergeht ins Nichts, das Universum ist einzigartig und unveränderlich, und es besteht aus Atomen und Leere. Die Unteilbarkeit der Atome, ihre ständige Bewegung im leeren Raum und das Zusammenspiel dieser Elemente werden als grundlegend für das Verständnis der epikureischen Kosmologie dargestellt.
Welche Bedeutung hat die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Lehre Epikurs einer modernen Leserschaft zugänglich zu machen und ihre Relevanz für die heutige Zeit aufzuzeigen, insbesondere im Hinblick auf die Frage nach dem Glück. Sie untersucht, inwiefern Epikurs Konzepte auch heute noch aktuell und relevant sind.
Ist der Text vollständig?
Nein, der bereitgestellte Text ist unvollständig. Die Kapitelzusammenfassungen zu "Über Begierden und Lust" und "Der Versuch einer Modernisierung des Epikureismus" sind nicht enthalten, da der Text an dieser Stelle endet.
- Quote paper
- B. A. Bildungs- und Erziehungswissenschaften Michel Beger (Author), 2010, Die epikureische Lehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192471