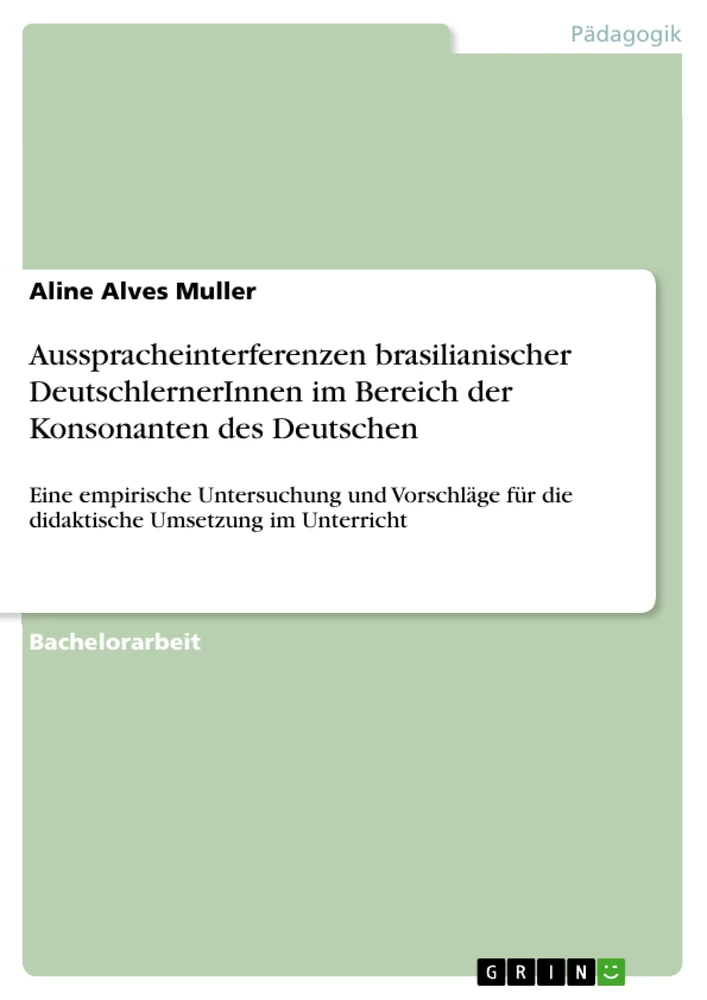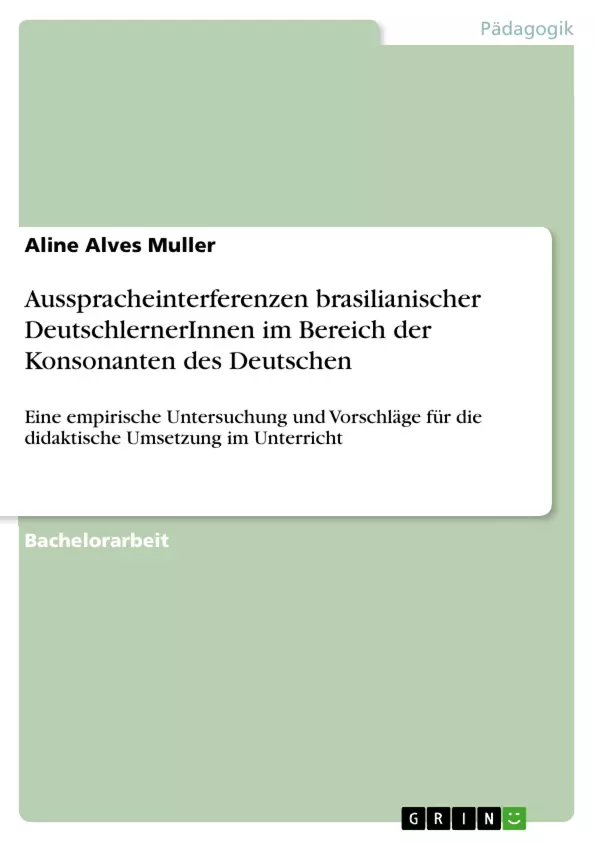Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Phonetiksystem des Brasilianischen Portugiesisch (BP) und des Deutschen. Zu Beginn liegt dabei der Fokus auf einer kontrastiven
phonetischen Analyse beider Sprachen, welche die Basis für die gesamte weitere Arbeit bildet. Bei der kontrastiven phonetischen Analyse beschränke ich mich auf den segmentalen Bereich, präziser die Konsonanten. Der Schwerpunkt, BP als Vergleichssprache zum Deutschen, wurde bewusst gewählt, da in den letzten Jahren das Interesse an der deutschen Sprache in Brasilien stark gestiegen ist. Die deutsche Sprache ist derzeit die viert meist gelernte Fremdsprache in Brasilien. Ziel dieser Arbeit ist es, die häufigsten Fehlerquellen im Bereich der Konsonanten bei brasilianischen DaF-LernerInnen und deren Ursache zu identifizieren, um aufbauend darauf Unterrichtsmaterialien sowie Lehrempfehlungen speziell für diesen Lernerkreis zu entwickeln, welche die problematischsten Abweichungen aufgreifen und korrigieren. Es ist ebenso beabsichtigt herauszuarbeiten, inwieweit das Thema Konsonantismus als ein wichtiges Lernziel im Phonetik-Unterricht für brasilianische DaF-LernerInnen zu betrachten ist. Diese Fragestellung fußt darauf, dass dieses Thema innerhalb des Faches Phonetik eine
unterrepräsentierte Rolle zu haben scheint.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeines
- 2.1 Das brasilianische Portugiesisch
- 2.2 DaF-Unterricht in Brasilien
- 2.3 Stellenwert der Phonetik in Brasilien
- 3. Theoretischer Teil
- 3.1 Thematische Eingrenzung
- 3.2 Gegenüberstellung der Konsonanteninventare des Deutschen und des BP
- 3.2.1 Frikative
- 3.2.2 Plosive
- 3.2.3 Nasale
- 3.2.4 Laterale
- 3.2.5 Affrikaten
- 3.3 Phonotaktik des BP und des Deutschen
- 3.4 Fehlerprognose für brasilianische DaF-LernerInnen
- 4. Empirischer Teil
- 4.1 Forschungsdesign
- 4.1.1 Zu den Probanden
- 4.1.2 Zur Auswahl der Textmaterialien
- 4.1.3 Zum Ablauf der Tonaufnahmen
- 4.1.4 Zum Auswertungsverfahren der Ausspracheabweichungen
- 4.2 Darstellung der Ausspracheabweichungen
- 4.2.1 Frikative
- 4.2.2 Plosive
- 4.2.3 Nasale
- 4.2.4 Laterale
- 4.2.5 Affrikaten
- 4.2.6 Konsonantenhäufungen
- 4.3 Häufigste Ausspracheabweichungen
- 4.4 Bezug zur Fehlerprognose
- 5. Didaktischer Teil
- 5.1 Die Rolle der Phonetik in DaF-Lehrwerken in Brasilien
- 5.2 Phonetische Übungen und Empfehlungen für den DaF-Unterricht
- 5.2.1 R-Laute
- 5.2.2 Laute [] und [s] in
/ - 5.2.3 Konsonantenhäufungen
- 5.2.4 Ang-Laut
- 5.3 Erprobung der Aufgaben
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung von Ausspracheinterferenzen brasilianischer DeutschlernerInnen im Bereich der Konsonanten des Deutschen. Das Ziel ist es, die häufigsten Fehlerquellen zu identifizieren und deren Ursache zu analysieren, um darauf aufbauend effektive Unterrichtsmaterialien und Lehrempfehlungen für diesen Lernerkreis zu entwickeln. Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich des phonetischen Systems des Brasilianischen Portugiesisch (BP) und des Deutschen, um so die Ursachen für Aussprachefehler zu verstehen. Darüber hinaus beleuchtet die Arbeit die Rolle der Phonetik im DaF-Unterricht in Brasilien und setzt sich mit der Frage auseinander, inwiefern der Konsonantismus ein wichtiges Lernziel für brasilianische DeutschlernerInnen darstellt.
- Kontrastive phonetische Analyse des Konsonantismus im BP und im Deutschen
- Identifizierung der häufigsten Aussprachefehler von brasilianischen DeutschlernerInnen
- Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und Lehrempfehlungen für den DaF-Unterricht in Brasilien
- Bedeutung des Konsonantismus im Phonetik-Unterricht für brasilianische DeutschlernerInnen
- Integration der Muttersprache (BP) als unterstützendes Mittel im Ausspracheerwerbsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Thematik der Bachelorarbeit eingeführt und der Fokus auf den kontrastiven Vergleich des phonetischen Systems des BP und des Deutschen gelegt. Die Relevanz dieser Arbeit wird anhand der zunehmenden Beliebtheit der deutschen Sprache in Brasilien unterstrichen. Das zweite Kapitel gibt einen allgemeinen Überblick über das BP, den DaF-Unterricht und die Rolle der Phonetik in Brasilien. Kapitel drei widmet sich dem theoretischen Vergleich der beiden Konsonantensysteme. Hier werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Konsonanten im BP und im Deutschen herausgearbeitet, um so die Grundlage für die Fehlerprognose im empirischen Teil zu schaffen. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse der Fehleranalyse von drei brasilianischen Probanden vorgestellt. Hier werden die häufigsten Aussprachefehler der Probanden im Bereich der Konsonanten identifiziert und systematisch analysiert. Kapitel fünf befasst sich mit dem didaktischen Teil der Arbeit. Anhand der Ergebnisse der Fehleranalyse werden didaktische Empfehlungen und phonetische Übungen entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse brasilianischer DeutschlernerInnen zugeschnitten sind. Hier werden die häufigsten Aussprachefehler aufgegriffen und mithilfe von Übungen und Aufgaben korrigiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Ausspracheinterferenzen, kontrastive Phonetik, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch als Fremdsprache, DaF-Unterricht in Brasilien, Konsonantismus, Fehleranalyse, Didaktik, phonetische Übungen und Ausspracheerwerb.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Brasilianer Schwierigkeiten mit deutschen Konsonanten?
Ursache sind phonetische Interferenzen aus dem Brasilianischen Portugiesisch (BP), das ein anderes Konsonanteninventar und eine andere Phonotaktik besitzt.
Welche Konsonanten sind besonders problematisch?
Häufige Fehlerquellen liegen bei den Frikativen (z. B. "ich"- und "ach"-Laut), Plosiven und den verschiedenen R-Lauten.
Was ist das Problem bei Konsonantenhäufungen?
Deutsch erlaubt komplexe Konsonantenkombinationen (z. B. "st", "spr"), die im BP oft durch das Einfügen von Vokalen (Epenthese) vereinfacht werden.
Wie wichtig ist Phonetik im DaF-Unterricht in Brasilien?
Phonetik wird oft unterrepräsentiert, obwohl sie entscheidend für die Verständlichkeit ist. Die Arbeit plädiert für eine stärkere Integration in Lehrwerke.
Welche Übungen helfen bei den R-Lauten?
Die Arbeit empfiehlt spezifische didaktische Übungen, die den Kontrast zwischen dem brasilianischen und deutschen R-System verdeutlichen.
- Arbeit zitieren
- Aline Alves Muller (Autor:in), 2011, Ausspracheinterferenzen brasilianischer DeutschlernerInnen im Bereich der Konsonanten des Deutschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192575