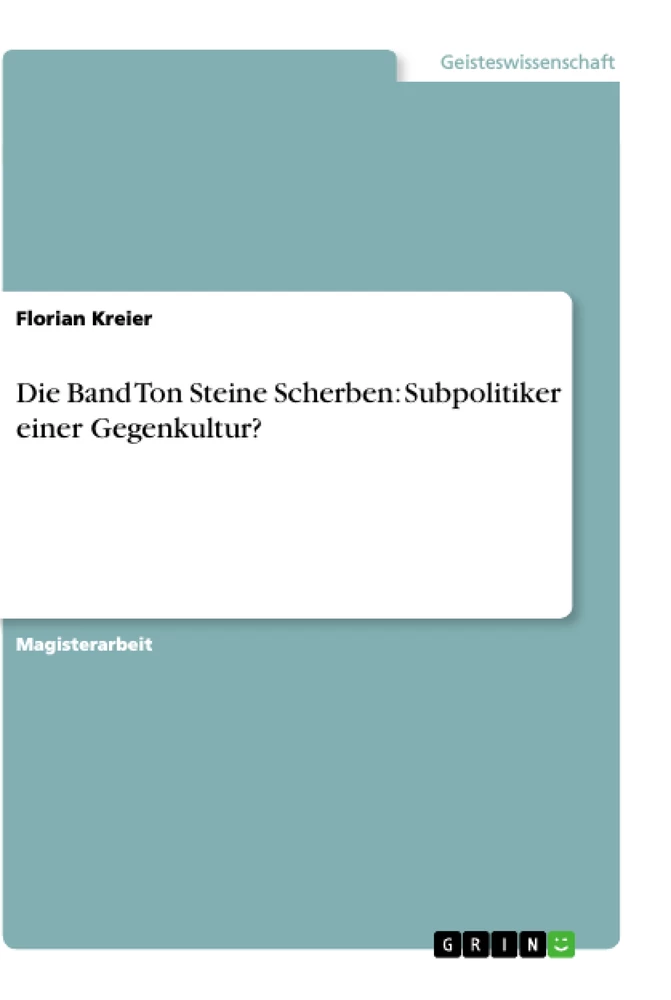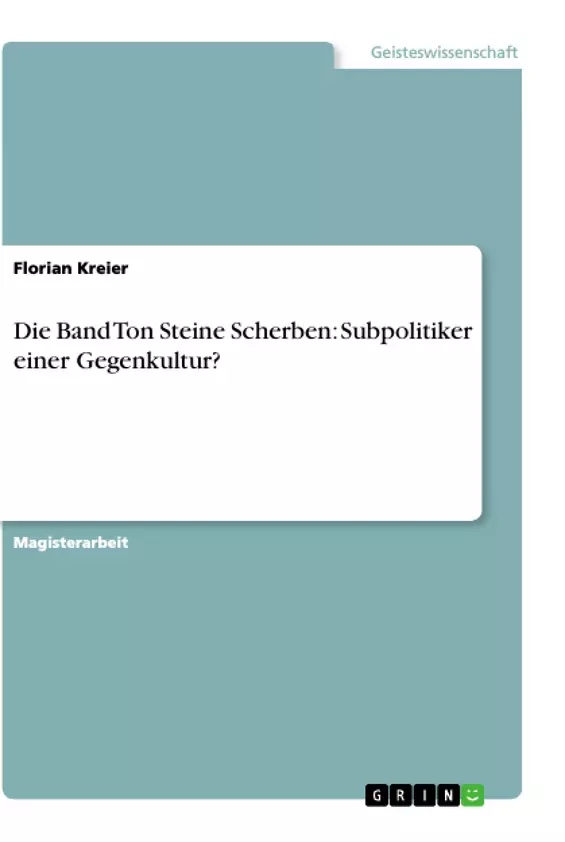Wie konnte die politische Arbeit von TON STEINE SCHERBEN aussehen? Wieso verbreiteten sich ihre radikalen, schlagwortartigen Parolen blitzartig durch den deutschsprachigen Raum? Wie traten sie wofür ein, mit welchen Inhalten, Zielen und Methoden? Aus welchem Grund stieg die Band abseits klassisch-wirtschaftlicher Strukturen in kürzester Zeit zu einer der bekanntesten westdeutschen Gruppen auf – ohne Plattenlabel oder Vermarktungsstrategie? Woher stammte überhaupt die Idee oder der Glaube daran, mit Musik Politik machen zu können? Politik für oder gegen welche politischen, gesellschaftlichen oder kulturellen Ansichten und Gruppen – und vor allem weshalb? Diese Fragen sollen in der vorliegenden Arbeit beantwortet werden. Eine grundlegende These ist dabei, dass Ton Steine Scherben maßgeblich von den Ansichten, Formen und Auswirkungen der 68-Kulturrevolution beeinflusst waren. In einem theoretischen Teil werden dazu verschiedene Theorie- und Analysemodelle der Bereiche Kultur, Sub- und Gegenkultur betrachtet, um Ton Steine Scherben und ihr Verhältnis zur gegenkulturellen 68-Bewegung gesellschaftlich, sozial und kulturell einordnen zu können. Der von Ulrich Beck entwickelte Begriff der Subpolitik soll anschließend eine politische Analyse des Phänomens in Ausrichtung, Wirkung und historischem Zusammenhang ermöglichen. Daraufhin wird zuerst das historische Setting betrachtet, in dem die gegenkulturelle Bewegung als Subkultur und daraufhin die Gegenkultur entstanden. Weiter werden die Hauptaspekte und -komponenten der gegenkulturellen Bewegung sowie der Gegenkultur ausgeführt und anschließend analysiert. Auf Grundlage dessen wird die Entstehung, Entwicklung und Ausrichtung von Ton Steine Scherben dargelegt und nach gegenkulturellen Aspekten analysiert – im Anschluss auch die Gründe für die inhaltliche Veränderung der Band und ihrer Flucht aus der West-Berliner Gegengesellschaft. Die Zusammensetzung dieses in vielerlei Hinsicht extremen Milieus wird ebenfalls betrachtet, sowie die Interkation der Band mit dieser Gegengesellschaft. Eine weitere These ist dabei, dass Ton Steine Scherben von einer allgemeinen Radikalisierung erfasst wurden, die sich in West-Berlin aufgrund regionaler und kultureller Besonderheiten besonders ausgeprägt zur Gegengesellschaft verstetigte und als dessen Sprachrohr und subpolitisch-aktive Vertreter die Band fungierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsleitende Fragen und Hypothesen
- Forschungsstand und Literatur
- Zum Begriff der Kultur
- Kultur und Gesellschaft
- Aspekte des Kulturbegriffs
- Zum Verhältnis von Kultur und Subkultur
- Zum Begriff der Subkultur
- Das Suffix sub
- Begriffsgeschichte Subkultur
- Kriminalistische Ansätze
- Strukturelle Ansätze
- Theorie der Subkultur
- Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS)
- Stil und Bricolage
- Weitere subkulturelle Deutungskonzepte
- Alternative Konzepte
- Jugendkultur vs. Subkultur
- Szene vs. Subkultur
- Zusammenfassung
- Subpolitik
- Auf- und Ablösung der Industriemoderne
- Subpolitische Akteure und Komponenten
- Beck's Politikverständnis
- Subpolitik in der Rezeption
- Vorgehen der vorliegenden Arbeit
- Methodik
- Verwendung von Subpolitik
- Analytischer Fahrplan
- Historisches Setting der 60er
- Sozioökonomischer Wandel der 60er Jahre
- Massenwohlstand
- Steigerung der Freizeit
- Medialisierung
- Internationalisierung
- Jugend und Juvenialisierung
- Zuspitzung der politischen Situation
- Kulturelle und gesellschaftliche Auswirkungen
- Generationenkonflikt
- Wertewandel
- Kultureller Wandel
- Protest und gegenkulturelle Bewegungen - Die BRD im Umbruch
- „1968“ - Deutungsansätze einer Legende
- Akteure der 68er-Bewegung
- Sozialistischer Deutscher Studentenbund
- Außerparlamentarische Opposition
- Politisierung und Radikalisierung
- Zusammensetzung der gegenkulturellen Bewegung
- Kultureller Konsens der gegenkulturellen Bewegung
- Wohnsituation und Sexualität
- Die Rolle der Musik
- Grenzerfahrungen und Bewusstseinserweiterung durch Drogen
- Subpolitische Kultur
- Konzentrat der gegenkulturellen Bewegung: Die Gegenkultur
- Vorläufer der westdeutschen Gegenkultur
- Beat-Generation
- Hippies
- Provo-Bewegung
- Gammlerbewegung
- Gegenöffentlichkeit
- Freiräume der Gegenkultur
- Gegenkultureller Nährboden und Zentrum der Gegenkultur: West-Berlin
- Die gegenkulturelle Bewegung als Subkultur
- Von der Sub- zur Gegenkultur
- Gemeinsame Basis der Sub- und Gegenkultur: Die Utopie der Veränderbarkeit
- Ton Steine Scherben
- Bandmitglieder von Ton Steine Scherben
- Bandmitglieder
- Scherben-Family
- Entstehung
- Vorläufer: Hoffmanns Comic Teater, Beatopern und Rote Steine
- Zwischen Rote Steine und Ton Steine Scherben
- Entwicklung der Scherben zur linken Jukebox
- Wohn- und Arbeitsgemeinschaft: T-Ufer
- Rückzugsort: Fresenhagen
- Ton Steine Scherben im gegenkulturellen Berlin der 70er
- Die militante Fraktion: Blues, Haschrebellen, Tupamaros und RAF
- Ton Steine Scherben und die dogmatische Linke
- Rausch- und Suchtkultur
- Aspekte der Gegenkultur bei Ton Steine Scherben
- Wohnen und Arbeiten
- Sexualität
- Rausch und Drogen
- Musik als Ausdrucksform der Gegenkultur
- Experimental-, Polit- und Krautrock: Die gegenkulturellen Musikszenen der BRD
- Musik und Songs von Ton Steine Scherben
- Warum geht es mir so dreckig? - 1971
- Keine Macht für Niemand - 1972
- Wenn die Nacht am tiefsten... - 1975
- Ästhetische Inhalte der Musik
- Ton Steine Scherben als Sprachrohr der Gegenkultur
- Sprache als Stilelement
- Inhaltliche Bricolage
- Feindbilder und Stereotypen
- Utopie der Gegenkultur bei Ton Steine Scherben
- Unabhängigkeit und Selbstorganisation
- David Volksmund Produktion
- Auf- und Abstieg mit der Gegenkultur
- Ton Steine Scherben und Medien
- Fernsehen
- Radio
- Printmedien
- Gegenkultur und Subpolitik bei Ton Steine Scherben
- Einordnung der Scherben als gegenkulturelles Phänomen
- Delinquenz und Gegenkultur
- Kulturelle Muster und Praktiken
- Versuch einer Typologisierung von Ton Steine Scherben
- Ton Steine Scherben - Subpolitiker einer Subkultur?
- Formen und Strukturen der Subpolitik bei Ton Steine Scherben
- Inhalte und Programme: Subpolicy bei Ton Steine Scherben
- Subpolitische Mittel und subpolitischer Effekt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Subkultur und Subpolitik, am Beispiel der deutschen Rockband Ton Steine Scherben. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Band als gegenkulturelles Phänomen und die Frage, inwieweit die Band als subpolitischer Akteur innerhalb der Subkultur der 1970er Jahre in West-Berlin betrachtet werden kann.
- Die Entstehung und Entwicklung der Subkultur in den 1960er und 1970er Jahren
- Die gegenkulturellen Bewegungen und deren Einfluss auf die Musiklandschaft
- Die Rolle von Ton Steine Scherben als Sprachrohr der Gegenkultur
- Die Analyse der Band als subpolitischer Akteur
- Die Verbindung zwischen Subkultur und Subpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsleitenden Fragen und Hypothesen der Arbeit vor. Sie setzt sich mit dem Forschungsstand und der relevanten Literatur auseinander.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff der Kultur, insbesondere dem Verhältnis von Kultur und Gesellschaft sowie Aspekten des Kulturbegriffs. Es wird auf die Unterscheidung von Kultur und Subkultur eingegangen.
Das dritte Kapitel beleuchtet den Begriff der Subkultur und untersucht die Begriffsgeschichte. Verschiedene Ansätze, wie kriminalistische und strukturelle Ansätze, werden vorgestellt.
Kapitel vier erörtert den Begriff der Subpolitik und beleuchtet verschiedene Ansätze, wie die Theorie der Subkultur, das Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) und das Konzept von Stil und Bricolage. Es wird auch auf alternative Konzepte zur Subkultur eingegangen.
Kapitel fünf erläutert das Vorgehen der vorliegenden Arbeit, die Methodik, die Verwendung des Subpolitik-Begriffs und den analytischen Fahrplan.
Kapitel sechs beschreibt das historische Setting der 1960er Jahre, den sozioökonomischen Wandel und die kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen, die durch den Generationenkonflikt, den Wertewandel und den kulturellen Wandel geprägt waren.
Kapitel sieben beleuchtet die Protest- und gegenkulturellen Bewegungen in der BRD im Umbruch. Es werden die „1968“-Bewegung und deren Deutungsansätze sowie Akteure wie der Sozialistischer Deutscher Studentenbund (SDS) und die Außerparlamentarische Opposition (APO) näher betrachtet.
Kapitel acht stellt die Band Ton Steine Scherben vor und beleuchtet die Bandmitglieder, die Entstehung der Band und deren Entwicklung zur linken Jukebox.
Kapitel neun betrachtet die Band im Kontext des gegenkulturellen Berlins der 1970er Jahre und analysiert die militante Fraktion sowie die Rolle der Band gegenüber der dogmatischen Linken und der Rausch- und Suchtkultur.
Kapitel zehn untersucht Aspekte der Gegenkultur bei Ton Steine Scherben, insbesondere Wohnen und Arbeiten, Sexualität, Rausch und Drogen. Es analysiert die Musik als Ausdrucksform der Gegenkultur, die Band als Sprachrohr der Gegenkultur und die Utopie der Gegenkultur bei Ton Steine Scherben.
Schlüsselwörter
Subkultur, Subpolitik, Gegenkultur, Ton Steine Scherben, 1968, West-Berlin, Protest, Musik, Rockmusik, Kultur, Gesellschaft, Politik, Wertewandel, Jugend, Medien, Sprachrohr, Bricolage, Utopie.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Ton Steine Scherben in der 68er-Bewegung?
Die Band fungierte als Sprachrohr der Gegenkultur und radikalisierte die politische Stimmung durch ihre Musik und Parolen in West-Berlin.
Was bedeutet der Begriff „Subpolitik“ im Zusammenhang mit der Band?
Nach Ulrich Beck beschreibt Subpolitik politisches Handeln außerhalb des klassischen Parteiensystems. Die Band nutzte Musik als Mittel zur gesellschaftlichen Einflussnahme.
Wie verbreiteten sich die Parolen der Band ohne klassische Vermarktung?
Durch die starke Vernetzung in der Gegenöffentlichkeit, alternative Medien und die Identifikation der Szene mit den radikalen Inhalten der Texte.
Was war die „Scherben-Family“?
Es handelte sich um die Wohn- und Arbeitsgemeinschaft der Bandmitglieder, die das Ideal der Selbstorganisation und Unabhängigkeit von wirtschaftlichen Strukturen lebte.
Warum zog sich die Band später nach Fresenhagen zurück?
Der Rückzug war eine Flucht aus der extremen Berliner Gegengesellschaft und der damit verbundenen Radikalisierung sowie dem Konsumdruck der Szene.
- Citation du texte
- Florian Kreier (Auteur), 2011, Die Band Ton Steine Scherben: Subpolitiker einer Gegenkultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193184