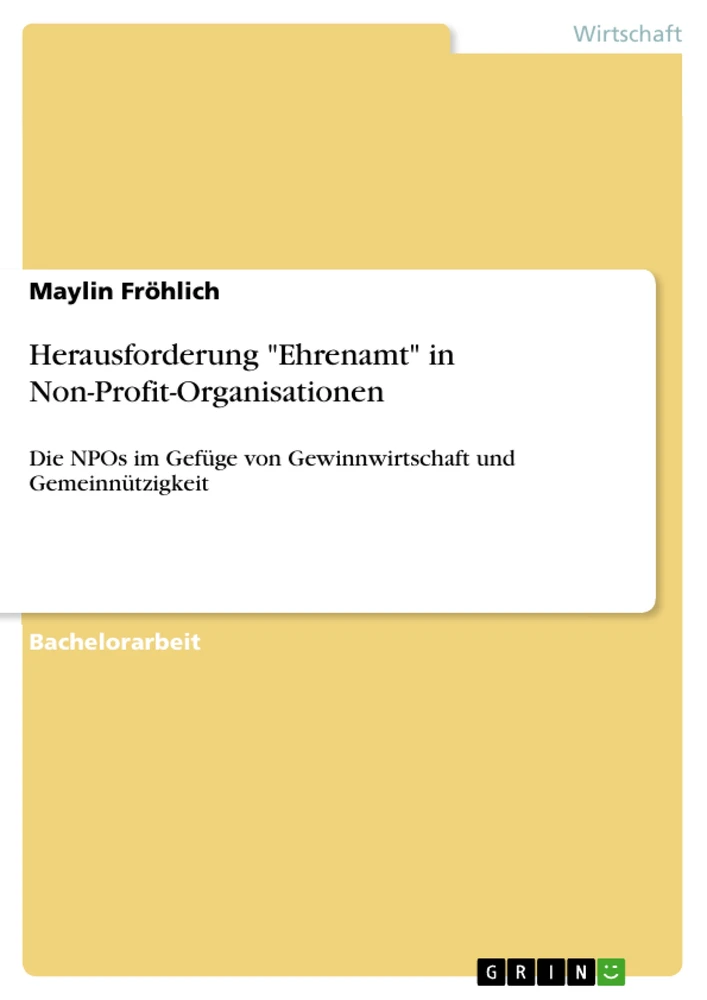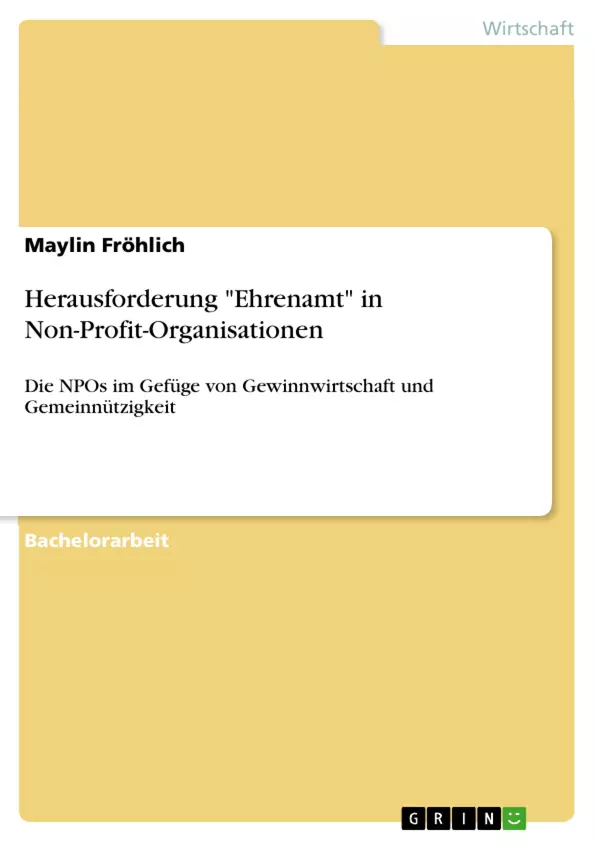Egal, ob es sich um eine gewinnorientierte Unternehmung handelt, die mit dem Verkauf von Brötchen und Kaffee ihr Geld verdient oder um eine Non-Profit-Organisation (im folgenden NPO), die ein ge-meinnütziges Ziel verfolgt: die Begründungen in der aktuellen Literatur, warum es gerade jetzt so wichtig ist, mit „neuen“ Erfolgsfaktoren wie der Unternehmenskultur die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Unternehmung zu sichern oder zumindest zu verbessern, laufen im allgemeinen auf das Gleiche hinaus. Häufig genannt werden die sich immer weiter verstärkende Globalisierung, die Finanzkrise mit all ihren Folgen, die Kürzung von staatlichen Geldern und vor allen Dingen der vermehrte Rückzug des Staates aus der sozialen Verantwortung.
Um diesen Szenarien nicht nach einiger Zeit zu erliegen, ist es zu einer der Hauptaufgaben jeglicher Organisation geworden eine Resistenz gegenüber außerbetrieblichen Einflüssen zu entwickeln. Bereits in den 80er Jahren waren wissenschaftliche Untersuchungen in diesem Themenbereich in den Betrachtungswinkel von einigen Autoren aufgenommen worden und auch heute ist die Thematik nicht mehr wegzudenken. Jedoch besteht bezüglich der NPOs immer noch ein Rückstand des wissenschaftlichen Standards. Es bietet sich geradezu an die Unternehmenskultur mit all ihren Facetten speziell in dieser Organisationsform zu analysieren, da sich nur hier diese Art der Mitgliederstruktur finden lässt, welche den Faktor Mensch wesentlich in den Mittelpunkt der Unternehmung stellt.
Im Rahmen dieser Arbeit soll davon ausgegangen werden, dass eine auf den Menschen ausgerichtete Unternehmenskultur und Führung langfristig die Grundlage für den unternehmerischen Erfolg bilden. Dadurch wird außerdem eines der grundlegende Ziele avisiert, eine Unternehmung aufzubauen, die trotz instabilen und schwierigen äußeren Rahmenbedingungen ihre eigene innere Stabilität und Kontinuität nicht verliert und so an langfristiger Überlebensfähigkeit gewinnt.
Welchen Stellenwert die Unternehmenskultur in einer Non-Profit-Organisation einnehmen kann, und welche Rolle dabei das einzusetzende Personal übernimmt, soll anhand der folgenden Forschungsfrage genauer untersucht werden:
Lassen sich Auswirkungen durch den gleichzeitigen Einsatz von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in Non-Profit-Organisationen im Bereich der Unternehmenskultur feststellen?
Zur praxisnahen Verdeutlichung der theoretischen Untersuchungen wird das Technische Hilfswerk als Beispielorganisation dienen....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Methodik/Aufbau der Arbeit
- Teil 1: Die Non-Profit-Organisation
- 1.1 Zum Begriff der NPO's
- 1.2 Eine spezifische Problemstellung: Der Einsatz von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
- 1.2.1 Hauptamtlichkeit
- 1.2.2 Ehrenamtlichkeit
- 1.2.3 Mögliche Konflikte
- 1.3 Das Technische Hilfswerk
- Teil 2: Die Unternehmenskultur
- 2.1 Begrifflichkeit und Wirkungsweise
- 2.2 Entstehung und Einführung - Eine Auswahl an Methoden
- 2.3 Unterstützende Instrumente
- 2.3.1 Leitbild, Mission, Vision
- 2.3.2 Angewandte Instrumente im THW
- 2.4 Das Führungsverhalten als Determinante der Unternehmenskultur
- 2.4.1 Rahmenbedingungen
- 2.4.2 Kontrolle versus Vertrauen - zwei Alternativen für die Führungsriege
- Teil 3: Schlussbetrachtung: Manifestation der Zusammenhänge
- Teil 4: Persönliche Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Auswirkungen des gleichzeitigen Einsatzes von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern auf die Unternehmenskultur in Non-Profit-Organisationen. Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Beschäftigungsformen und den Merkmalen einer starken und nachhaltigen Unternehmenskultur zu analysieren. Dabei soll die Bedeutung des Faktors "Mensch" in einer Organisation, die auf gemeinnützige Ziele ausgerichtet ist, hervorgehoben werden.
- Die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Wettbewerbsfähigkeit von Non-Profit-Organisationen
- Die Herausforderungen, die sich durch die Kombination von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Unternehmenskultur ergeben
- Die Rolle des Führungsverhaltens und der Führungskultur bei der Gestaltung einer positiven Unternehmenskultur in Non-Profit-Organisationen
- Die Analyse der spezifischen Situation im Technischen Hilfswerk (THW) als Fallbeispiel
- Die Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Unternehmenskultur in Non-Profit-Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Problemstellung dar und erklärt die Relevanz der Thematik. Sie setzt den Fokus auf die Bedeutung der Unternehmenskultur für Non-Profit-Organisationen und die besonderen Herausforderungen, die sich aus der Kombination von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ergeben.
- Teil 1: Die Non-Profit-Organisation: Dieser Teil befasst sich mit den charakteristischen Merkmalen von Non-Profit-Organisationen und der spezifischen Problemstellung, die sich aus dem gleichzeitigen Einsatz von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern ergibt. Dabei werden die Begriffe Hauptamtlichkeit, Ehrenamtlichkeit und mögliche Konflikte zwischen den beiden Beschäftigungsformen erläutert.
- Teil 2: Die Unternehmenskultur: Dieser Teil definiert den Begriff der Unternehmenskultur und beschreibt ihre Wirkungsweise. Es werden verschiedene Methoden zur Entstehung und Einführung von Unternehmenskulturen vorgestellt sowie unterstützende Instrumente wie Leitbilder, Missionen und Visionen erläutert. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Führungsverhalten als Determinante der Unternehmenskultur und die Bedeutung von Vertrauen in der Führungsriege.
Schlüsselwörter
Non-Profit-Organisationen, Unternehmenskultur, Hauptamtlichkeit, Ehrenamtlichkeit, Führungsverhalten, Leitbild, Mission, Vision, Technische Hilfswerk (THW), Wettbewerbsfähigkeit, Gemeinnützigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen?
Unterschiedliche Motivationen, Qualifikationen und Zeitbudgets können zu Konflikten führen, die die Unternehmenskultur einer NPO maßgeblich beeinflussen.
Was ist das Besondere an der Mitgliederstruktur einer Non-Profit-Organisation (NPO)?
NPOs stellen den Faktor Mensch und das gemeinnützige Ziel in den Mittelpunkt, wobei die Einbindung von Freiwilligen eine zentrale organisatorische Säule darstellt.
Warum ist die Unternehmenskultur für NPOs so wichtig?
Eine starke Kultur schafft innere Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen wie Finanzkürzungen oder dem Rückzug des Staates aus der sozialen Verantwortung.
Welche Rolle spielt das Führungsverhalten in einer NPO?
Führungskräfte müssen die Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen finden, um sowohl die Professionalität der Hauptamtlichen als auch die Motivation der Ehrenamtlichen zu wahren.
Welche Instrumente unterstützen die Unternehmenskultur im Technischen Hilfswerk (THW)?
Die Arbeit analysiert Instrumente wie Leitbilder, Missionen und Visionen, die speziell im THW zur Förderung des Zusammenhalts eingesetzt werden.
Wie kann eine NPO ihre langfristige Überlebensfähigkeit sichern?
Durch eine auf den Menschen ausgerichtete Führung und eine Unternehmenskultur, die Kontinuität und Resistenz gegenüber instabilen Rahmenbedingungen bietet.
- Citation du texte
- Maylin Fröhlich (Auteur), 2011, Herausforderung "Ehrenamt" in Non-Profit-Organisationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193603