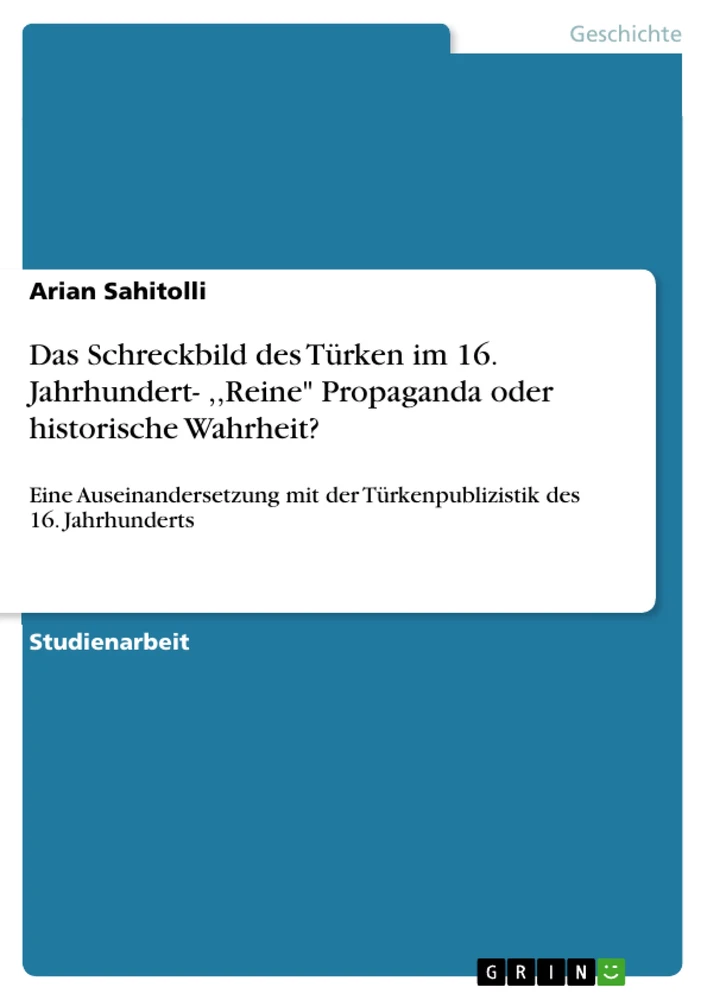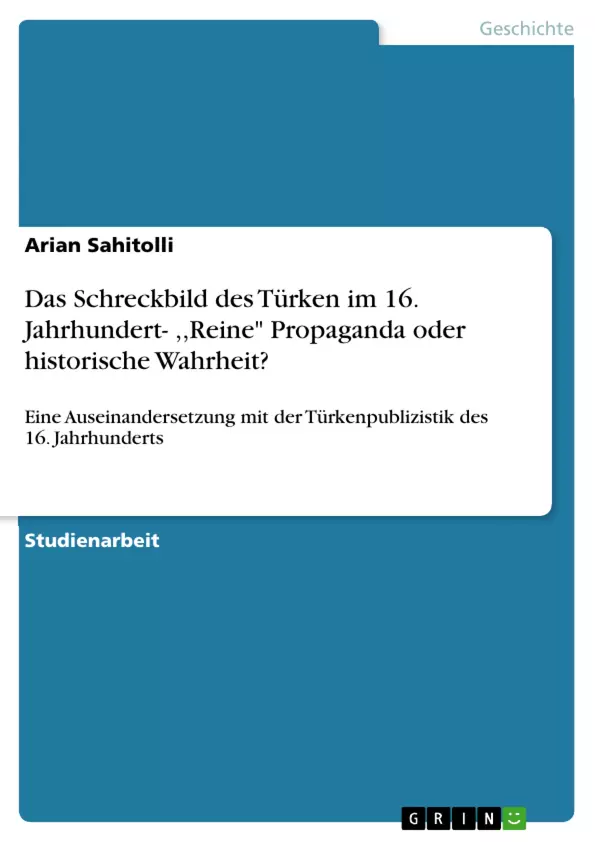Die These des französischen Staatstheoretikers Jean Bodin, ,,[…] einen [äußeren] Feind zu haben, dem man die Stirn bieten kann, [ist] das beste Mittel […], den Staat zu schützen und vor Aufständen, Unruhen und Bürgerkriegen zu bewahren und unter den Untertanen für Eintracht zu sorgen“ , wird innerhalb der geschichtswissenschaftlichen Forschung immer wieder aufgegriffen und kritisch beäugt. Vom 14. bis zum 17. Jahrhundert gab es hierbei nicht nur für einen Herrscher oder einem Reich, sondern für das gesamte Abendland einen äußeren Feind: Das Osmanische Reich. Erzielte dieser Feind aber genau die von Bordin beschriebenen Effekte?Erst im 16. Jahrhundert wurde den mitteleuropäischen Herrschern die evidente Bedrohung von Seiten der Osmanen bewusst. Das Osmanische Reich stand unter Sultan Süleyman I. am Zenit seiner Macht. Nach dem Sieg in der Schlacht von Mohács 1526 wurde der ungarische Feudalstaat nicht nur für Jahrhunderte zum Spielball des Osmanischen Reiches und der der Habsburger. Vielmehr hämmerten die Türken nun bedrohlich an die Tore der habsburgischen Erblande und des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. So wurde gerade mit der Ersten Türkenbelagerung Wiens im Jahre 1529 ,,die noch eben aus der Ferne dräuende [sic!] Gefahr […] zu einem in der Nähe tobenden Unwetter“. Und tatsächlich, der Ruf nach concordia, nach einer konfessions-, standes- und grenzübergreifenden Einigkeit, wurde im 16. Jahrhundert lautstärker denn je artikuliert.
Dem Verfasser dieser Arbeit stach bei der Lektüre der zeitgenössischen und überlieferten Publizistik jedoch unmittelbar eine unglaubliche ,,Verteufelung des Osmanische Reiches und der Türken“ ins Auge, so dass man die Frage nach der Objektivität und Sachlichkeit immer wieder artikulieren musste. Diese Feindschaft zwischen der lateinischen Christenheit des Abendlandes und dem islamisch geprägten Osmanischem Reich wird in dieser wissenschaftlichen Arbeit daher als Grundlage der näheren und vor allem differenzierten Betrachtung genommen. Dreh- und Angelpunkt wird dabei die Fragestellung sein, ob das Schreckbild des Türken im 16. Jahrhundert reine Propaganda war oder doch einen historischen Wahrheitsgehalt beanspruchen kann. Diese Leitfrage, die sich der Verfasser gestellt hat und am Ende dieser Arbeit beantworten möchte, ist dabei auf zwei Ebenen angesiedelt, die –und das wird sich im Laufe der Arbeit zeigen- stark voneinander abhängig sind...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Der äußere Feind als Identitätsstifter
- 2. Das Osmanische Reich und der Aufstieg einer Weltmacht
- 2.1 Die Eroberung Konstantinopels 1453 - Der Beginn der „Türkengefahr“?
- 2.2 1529 - Sultan Süleyman vor den Toren des Goldenen Apfels
- 3. „Imago Turci“ - Ein farbenprächtiges Panorama
- 3.1 Die straftheologische Deutung der Türkengefahr – Ein Akt zur ,,Sozialdisziplinierung“?
- 3.2 Die Türkentopik - Ein Fass voller Stereotypen...
- 3.3 Die „Türkenhoffnung“ - Die positive Kehrseite der propagandistischen Medaille
- 4. Fazit: Die Türkengefahr - Mehr Recht als Unheil!?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion des "Schreckbildes des Türken" im 16. Jahrhundert und beleuchtet die Frage, inwiefern dieses Bild auf Propaganda oder historische Wahrheit beruht. Sie analysiert die Türkenpublizistik des 16. Jahrhunderts, um zu verstehen, wie der "äußere Feind" als Mittel zur Identitätsbildung und zur sozialen Disziplinierung eingesetzt wurde. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Darstellung des Osmanischen Reiches in den Texten und der Analyse der darin verwendeten Stereotype. Dabei wird die Frage gestellt, ob die „Türkengefahr“ eine reale Bedrohung für Europa darstellte oder ob es sich eher um ein von den Herrschenden konstruiertes Bild handelte, das der eigenen Macht festigte.
- Die Rolle des Osmanischen Reiches als "äußerer Feind" im 16. Jahrhundert
- Die Analyse der Türkenpublizistik als Mittel der Identitätsbildung und sozialen Disziplinierung
- Die Darstellung des Osmanischen Reiches in der Türkenpublizistik und die darin verwendeten Stereotype
- Die Frage nach der historischen Wahrheit des "Schreckbildes des Türken"
- Der Einfluss der Türkengefahr auf die europäische Politik und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 befasst sich mit der einleitenden These, dass ein "äußerer Feind" im 16. Jahrhundert als Mittel zur Stärkung der staatlichen Macht und zur Vermeidung von Aufständen diente. Das Osmanische Reich wird als "der Feind" des Abendlandes dargestellt und die Frage gestellt, ob es die von Jean Bodin beschriebenen Effekte hervorrief. Kapitel 2 betrachtet den Aufstieg des Osmanischen Reiches als Weltmacht und analysiert die Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 als mögliches Ereignis, das die "Türkengefahr" einleitete. Außerdem wird die Belagerung Wiens im Jahre 1529 als entscheidender Wendepunkt in der europäischen Geschichte betrachtet. Kapitel 3 untersucht die Darstellung des Osmanischen Reiches in der Türkenpublizistik. Es wird die Frage diskutiert, ob die "Türkengefahr" ein Mittel zur "Sozialdisziplinierung" war und die Türkentopik als Quelle von Stereotypen betrachtet.
Schlüsselwörter
Türkengefahr, Osmanisches Reich, Türkenpublizistik, Imago Turci, Stereotypen, Propaganda, Identitätsbildung, soziale Disziplinierung, Europa, Abendland, Konstantinopel, Belagerung Wiens, Habsburger, historische Wahrheit.
Häufig gestellte Fragen
War das Schreckbild des Türken im 16. Jahrhundert reine Propaganda?
Die Arbeit untersucht, ob die Darstellung der Osmanen als „Erbfeind der Christenheit“ auf historischer Wahrheit beruhte oder als Mittel zur Identitätsstiftung und sozialen Disziplinierung konstruiert wurde.
Was war die Bedeutung der Belagerung Wiens 1529?
Die erste Türkenbelagerung Wiens unter Sultan Süleyman I. machte die osmanische Bedrohung für Mitteleuropa unmittelbar greifbar und löste eine Flut an Türkenpublizistik aus.
Was versteht man unter „Imago Turci“?
Es beschreibt das in Europa vorherrschende Bild vom Türken, das oft durch Stereotype, religiöse Deutungen (als „Strafe Gottes“) und Verteufelung geprägt war.
Diente der äußere Feind der Einigkeit im Abendland?
Ja, Herrscher nutzten die „Türkengefahr“, um zur concordia (Einigkeit) aufzurufen und von inneren Unruhen oder konfessionellen Konflikten abzulenken.
Was ist die „Türkenhoffnung“?
Interessanterweise gab es auch eine positive Kehrseite: Unterdrückte Bevölkerungsschichten hofften teilweise auf die Türken als Befreier von der harten Herrschaft eigener Adliger.
- Citation du texte
- Arian Sahitolli (Auteur), 2012, Das Schreckbild des Türken im 16. Jahrhundert- ,,Reine" Propaganda oder historische Wahrheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193793