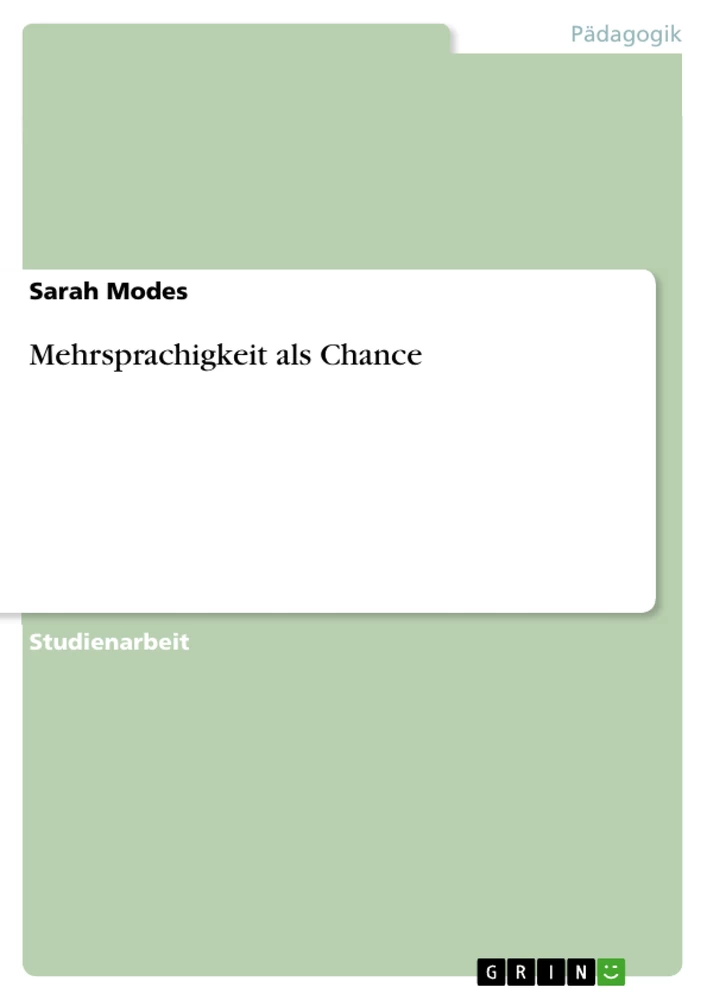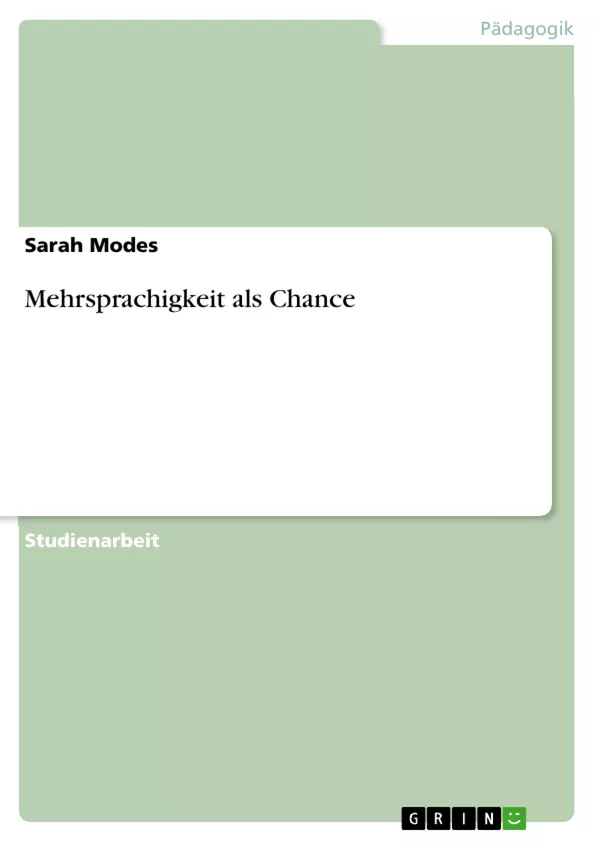Sprache ist ein lebenswichtiger Bereich des menschlichen Lebens. Das Sprach- und Kommunikationsvermögen unterscheidet den Menschen deutlich von anderen Lebewesen. Sie lässt uns am gesellschaftlichen Leben teilhaben und ermöglicht uns den Austausch mit anderen Menschen. Doch nicht für die Kommunikation ist Sprache ein unerlässliches Werkzeug. Sie erlaubt uns auch unsere Gefühle und Emotionen, Gedanken und Wünsche zu äußern, auszudrücken und mitzuteilen.
Die Sprache befähigt uns, sich über sprachliche und kulturelle Grenzen hinwegzusetzen und zu verständigen. Daher sollte die sprachliche Vielfalt als Chance wahrgenommen werden.
Eine generelle Sprachkompetenz wird vorwiegend in den ersten Lebensjahren erworben. Innerhalb kürzester Zeit erlernen Kinder ihre Muttersprache. Bei mehrsprachigen Kindern können sogar zwei oder drei Sprachen nahezu vollständig und perfekt beherrscht werden.
Die Arbeit soll zunächst die verschiedenen Spracherwerbstheorien erläutern und daraufhin auf die jeweiligen Vorteile, die sich durch eine frühe Mehrsprachigkeit ergeben eingehen. Es werden die Chancen für das Individuum an sich und für den Unterricht an Schulen näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Spracherwerb
- 2. Spracherwerbstheorien
- 2.1 Behaviorismus
- 2.2 Nativismus
- 2.3 Kognitivismus
- 2.4 Interaktionismus
- 2.5 Fazit
- 3. Mehrsprachigkeit - individuelle Chancen
- 3.1 Begriffsklärung Mehrsprachigkeit
- 3.2 Wann ist ein Mensch mehrsprachig?
- 3.3 Mehrsprachigkeit aus neurologischer Sicht
- 3.4 Individuelle Vorteile bei Mehrsprachigkeit
- 4. Chancen für den Unterricht
- 4.1 Generelle und konkrete Ziele für den Unterricht
- 4.2 Möglichkeiten der Einbindung von Mehrsprachigkeit im Unterricht
- 4.3 Folgerungen für das Bildungssystem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Erläuterung verschiedener Spracherwerbstheorien und deren Implikationen für den Erwerb von Mehrsprachigkeit. Dabei wird der Fokus auf die Vorteile gelegt, die sich durch eine frühe Mehrsprachigkeit für das Individuum und den Unterricht ergeben. Ziel ist es, die Chancen von Mehrsprachigkeit aufzuzeigen und für die Bedeutung einer frühen Mehrsprachigkeit zu werben.
- Spracherwerbstheorien und ihre Implikationen für den Erwerb von Mehrsprachigkeit
- Individuelle Vorteile von Mehrsprachigkeit
- Chancen für den Unterricht durch Mehrsprachigkeit
- Bedeutung einer frühen Mehrsprachigkeit
- Folgerungen für das Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Sprache im menschlichen Leben heraus und führt in die Thematik der Mehrsprachigkeit als Chance ein. Kapitel 1 beschäftigt sich mit dem Spracherwerbsprozess und den verschiedenen Phasen der Sprachentwicklung bei Kindern. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Spracherwerbstheorien, darunter der Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus und Interaktionismus. Kapitel 3 befasst sich mit dem Begriff der Mehrsprachigkeit, den neurologischen Aspekten und den individuellen Vorteilen, die sich aus Mehrsprachigkeit ergeben. Kapitel 4 untersucht die Chancen von Mehrsprachigkeit für den Unterricht und die Bedeutung einer frühen Mehrsprachigkeit für das Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Spracherwerb, Spracherwerbstheorien, Mehrsprachigkeit, individuelle Vorteile von Mehrsprachigkeit, Chancen für den Unterricht, Bildungssystem und frühe Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bietet frühe Mehrsprachigkeit?
Frühe Mehrsprachigkeit fördert die kognitive Flexibilität, die interkulturelle Kompetenz und bietet neurologische Vorteile bei der Sprachverarbeitung.
Was besagt der Nativismus zum Spracherwerb?
Diese Theorie geht davon aus, dass dem Menschen eine angeborene Fähigkeit zum Spracherwerb (Universalgrammatik) innewohnt.
Wie können Schulen Mehrsprachigkeit einbinden?
Durch die Wertschätzung von Herkunftssprachen, bilingualen Unterricht und die Förderung des Bewusstseins für sprachliche Vielfalt.
Ist Mehrsprachigkeit neurologisch nachweisbar?
Ja, die Arbeit thematisiert Mehrsprachigkeit aus neurologischer Sicht und wie das Gehirn verschiedene Sprachen strukturell verarbeitet.
Welche Spracherwerbstheorien werden verglichen?
Verglichen werden Behaviorismus, Nativismus, Kognitivismus und Interaktionismus.
- Arbeit zitieren
- Sarah Modes (Autor:in), 2012, Mehrsprachigkeit als Chance, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/193864