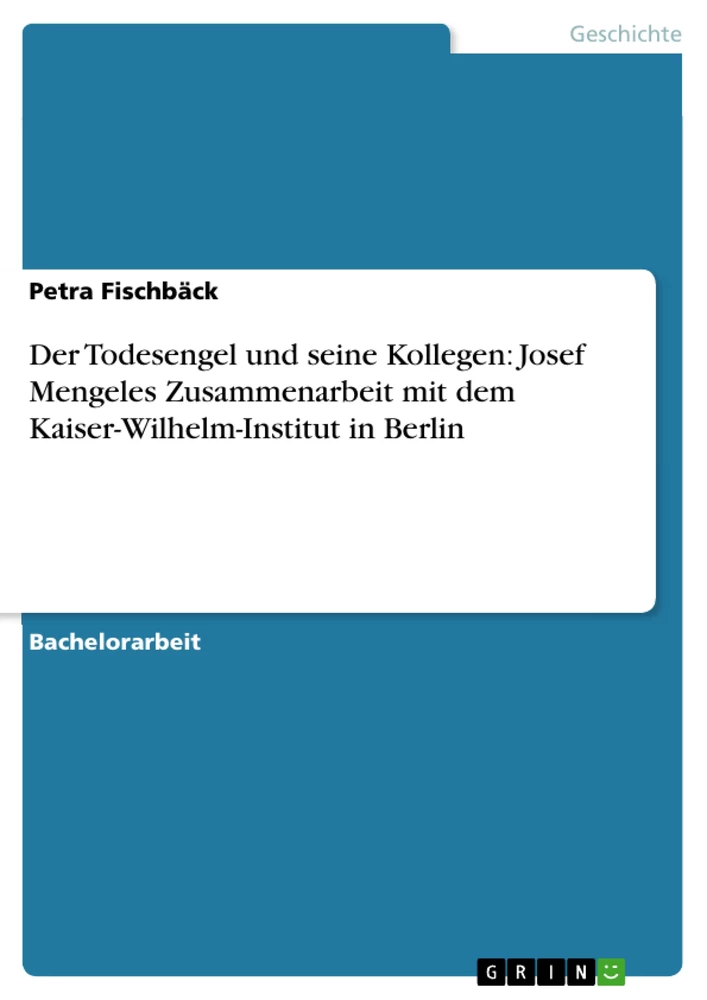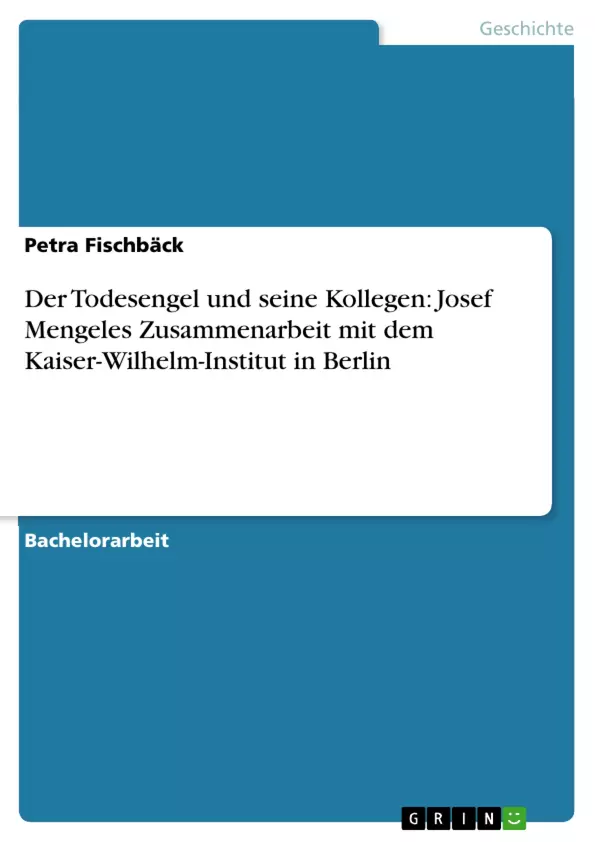Josef Mengele ist zu einer weltweit bekannten Symbolfigur für die Menschenversuche im Dritten Reich geworden. Oft wird allerdings der Eindruck erweckt, dass Mengele wahllos Eingriffe an Häftlingen vornahm, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrten. Dabei wird übersehen, dass Mengele in Kontakt mit Wissenschaftlern außerhalb des Lagers stand und teilweise in deren Auftrag handelte. Die vorliegende Arbeit untersucht diese Zusammenhänge.
Dies soll nicht einer Rechtfertigung von Mengeles Taten dienen. Die Zusammenarbeit mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin verringert ja nicht Mengeles Schuld, sondern erweitert den Kreis derer, die sich schuldig gemacht haben. Die Schuldfrage ist jedoch nicht Thema dieser Arbeit.
Zunächst wird die Quellenlage dargestellt. Es ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, Mengeles Versuche und seine Zusammenarbeit mit dem KWI zu rekonstruieren, da nahezu der gesamte Schriftverkehr hierzu vernichtet worden ist. Nur durch die Einbeziehung von Zeugenaussagen und Sekundärquellen ergibt sich schließlich ein Gesamtbild.
Mengeles Lebensweg wird kurz zusammengefasst, um so den vielen legendenhaften Darstellungen, die sich in den Medien zu seiner Person finden, eine Rekonstruktion der Fakten entgegenzusetzen. Auch die Entwicklung des Kaiser-Wilhelm-Instituts, die Entstehung der neuen akademischen Fächer „Rassenkunde“ und „Eugenik“ sowie die Rolle von Mengeles Doktorvater Otmar von Verschuer werden kurz behandelt.
Im eigentlichen Hauptteil der Arbeit werden Mengeles Versuche in Auschwitz systematisch dargestellt. Wo immer sich aus den Quellen Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit dem KWI ergeben, werden diese hier aufgeführt. Auch die Frage nach den Ergebnissen von Mengeles Versuchen wird behandelt.
Inhalt
1. Einleitung
2. Quellenlage
3. Biografie Mengeles
4. Entwicklung der „Rassenkunde“ und Eugenik
5. Das Kaiser-Wilhelm-Institut und Otmar von Verschuer
6. Mengeles Experimente in Auschwitz
6.1. Zwillingsforschung
6.2. Projekte „Spezifische Eiweißkörper“ und „Tuberkulose“
6.3. Projekt „Augenfarbe“
6.4. Experimentelle Therapie
6.5. Eigene Weiterbildung
6.6. Sammlung von Anomalien
7. Ergebnisse von Mengeles Versuchen
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
In welchem Verhältnis stand Josef Mengele zum Kaiser-Wilhelm-Institut?
Mengele handelte in Auschwitz teilweise im direkten Auftrag von Wissenschaftlern des KWI in Berlin und stand in engem Kontakt mit seinem Doktorvater Otmar von Verschuer.
Welche Arten von Experimenten führte Mengele in Auschwitz durch?
Schwerpunkte waren die Zwillingsforschung, Projekte zu „spezifischen Eiweißkörpern“, Tuberkulose, Augenfarben-Experimente sowie die Sammlung von körperlichen Anomalien.
Warum ist die Quellenlage zu Mengeles Versuchen so schwierig?
Nahezu der gesamte Schriftverkehr zwischen Mengele und dem KWI wurde vernichtet. Die Rekonstruktion muss daher über Zeugenaussagen und Sekundärquellen erfolgen.
Was waren „Rassenkunde“ und „Eugenik“ im Dritten Reich?
Es handelte sich um akademische Fächer, die eine pseudowissenschaftliche Grundlage für die NS-Rassenideologie lieferten und Mengeles Taten legitimierten.
Diente Mengeles Arbeit einem wissenschaftlichen Zweck?
Die Arbeit zeigt auf, dass Mengele nicht wahllos agierte, sondern seine grausamen Menschenversuche in einen Rahmen einbettete, den er und seine Auftraggeber als „wissenschaftlich“ ansahen.
- Quote paper
- Petra Fischbäck (Author), 2012, Der Todesengel und seine Kollegen: Josef Mengeles Zusammenarbeit mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194360