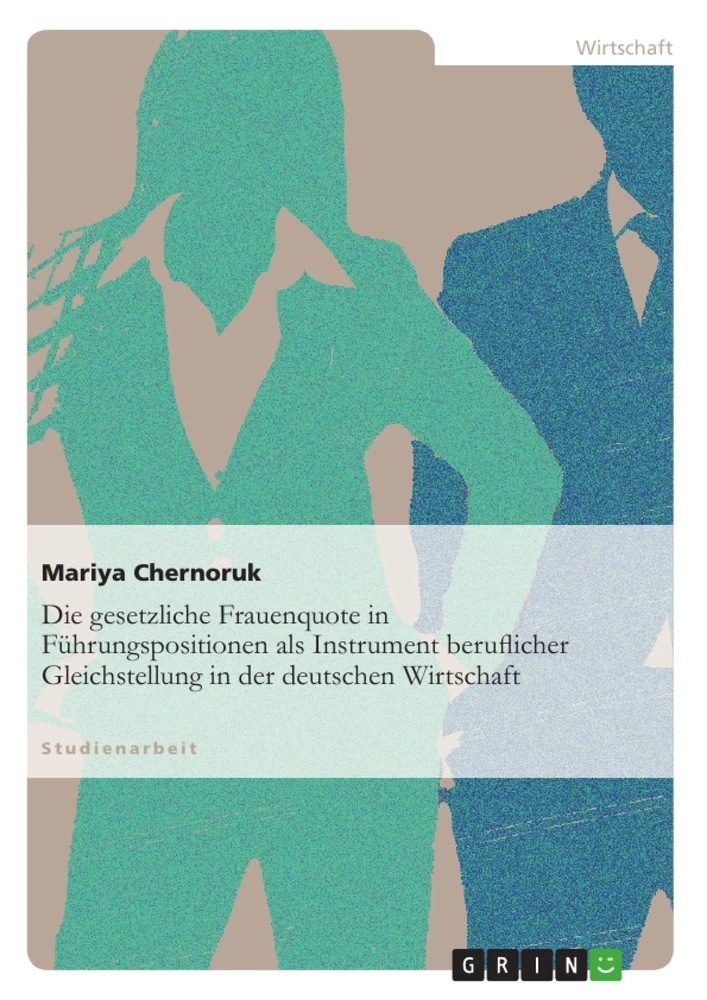„Das ist der Status Quo, in dem die Gleichberechtigungsbewegung feststeckt wie ein Karren im Dreck: Ja, Frauen können an die Spitze gelangen - wenn sie mehr leisten als Männer und wenn sie ihr Familienleben zurückstellen.
Noch immer ist Frausein ein Handicap für die Karriere, und von den wenigen weiblichen Spitzenkräften denkt man weiterhin, sie hätten es "trotzdem" geschafft.“ Diese Sichtweise beschreibt die Situation von Frauen in Führungspositionen sehr treffend. Obwohl Frauen in Deutschland im Durchschnitt besser ausgebildet sind als Männer, ehrgeizig und zielstrebig obendrein, gibt es bisher nur wenige Frauen in Führungspositionen deutscher börsennotierter Unternehmen und Konzerne.
Die Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen ist seit Jahrzehnten ein wesentliches gleichstellungspolitisches Ziel, das jetzt wieder in den Vordergrund der öffentlichen Diskussion gerückt ist. Stärker denn je wird die Einführung einer gesetzlichen Quotenregelung erwogen, die qualifizierten Frauen den Weg in die Führungsverantwortung ebnen soll. Zwar existieren bereits freiwillige Vereinbarungen seit Ende 2001 zwischen Vertretern der deutschen Privatwirtschaft und der Bundesregierung, diese haben aber kaum zu Veränderungen geführt. Die Quotendiskussion ist eine Reaktion darauf.
Viele Unternehmen kritisieren die Pläne der Politik und wehren sich vehement gegen eine gesetzliche Frauenquote, weil diese einen Eingriff in die Unternehmenspolitik darstelle und männerdiskriminierend sei. Darüber hinaus würde eine starre Quote eine Ungleichbehandlung der Branchen bedeuten.
Die vorliegende Arbeit greift die aktuelle Diskussion auf und versucht herauszufinden, ob eine Frauenquote in der deutschen Wirtschaft wirklich notwendig ist. Neben der Erläuterung der zentralen Begriffe, erfolgt hierzu in Kapitel 3 zunächst eine Betrachtung der aktuellen Situation von Frauen in Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft sowie der bislang existierenden Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen. Dabei wird sowohl die Lage in Deutschland als auch in Europa beleuchtet, um die Situation in Deutschland besser einordnen zu können. In Kapitel 4 werden vorherrschende Einwände gegen die Einführung einer Frauenquote aufgegriffen und hinterfragt. Kapitel 5 widmet sich kurz einer möglichen Ausgestaltung der Frauenquote bezogen auf Quotenart und Quotenhöhe, wonach Kapitel 6 mit einem Fazit schließt.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Begriffsdefinition
2.1 Führungsposition
2.2 Frauenquote
3 Status Quo – Frauen in Führungspositionen
3.1 Situation in Deutschland
3.2 Situation in der Europäischen Union
4 Einwände gegen die gesetzliche Quotenregulierung
4.1 Eingriff in die Auswahlprozesse
4.2 Vernachlässigung der Branchenunterschiede
4.3 Diskriminierung von Männern
5 Mögliche Ausgestaltung einer gesetzlichen Quotenregelung
6 Fazit
Quellenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Warum wird eine gesetzliche Frauenquote in Deutschland diskutiert?
Trotz besserer Ausbildung sind Frauen in Führungspositionen börsennotierter Unternehmen unterrepräsentiert. Da freiwillige Vereinbarungen kaum Wirkung zeigten, wird eine gesetzliche Regelung als Instrument zur Gleichstellung erwogen.
Was sind die Hauptargumente gegen eine Frauenquote?
Kritiker sehen darin einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit, eine mögliche Diskriminierung von Männern und die Gefahr, dass Branchenunterschiede nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Wie ist der Status Quo in der EU?
Auch auf EU-Ebene gibt es Bestrebungen, den Frauenanteil in Führungsetagen zu erhöhen, wobei einige Mitgliedstaaten bereits eigene Quotenregelungen eingeführt haben, um den Fortschritt zu beschleunigen.
Was versteht man unter dem Begriff „Gläserne Decke“?
Obwohl Frauen qualifiziert sind, stoßen sie oft an eine unsichtbare Barriere („Gläserne Decke“), die den Aufstieg in die obersten Führungspositionen verhindert, oft aufgrund tradierter Rollenmuster.
Welche Arten von Quotenregelungen gibt es?
Es wird zwischen weichen Quoten (Zielvorgaben ohne Sanktionen) und harten Quoten (gesetzlich fixierte Prozentsätze mit Sanktionsmöglichkeiten) unterschieden.
- Quote paper
- Mariya Chernoruk (Author), 2012, Die gesetzliche Frauenquote in Führungspositionen als Instrument beruflicher Gleichstellung in der deutschen Wirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194476