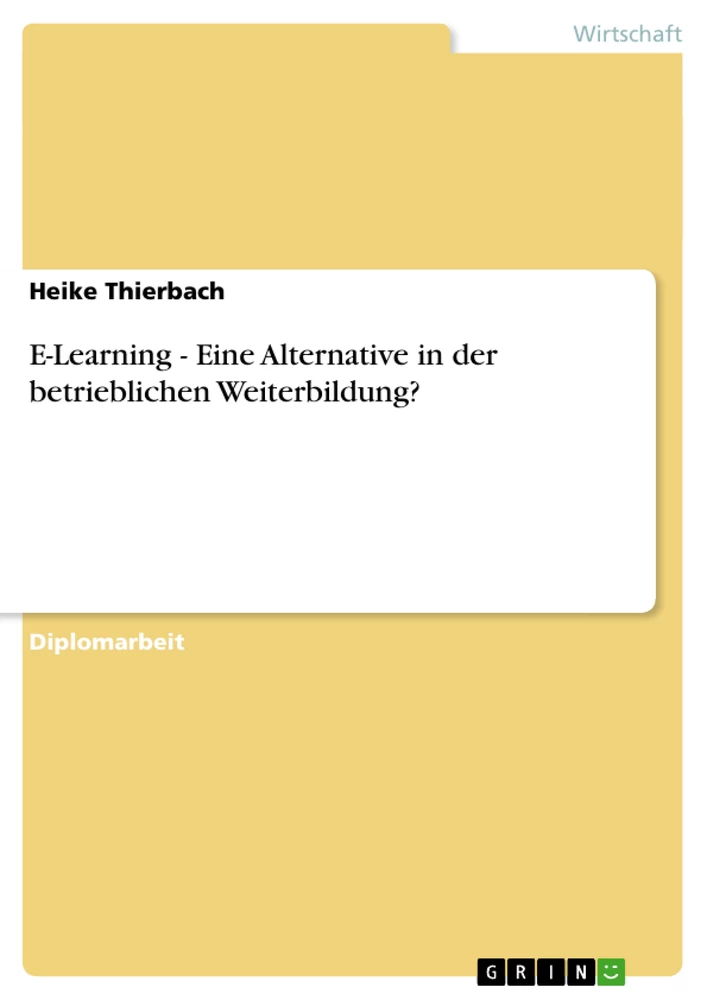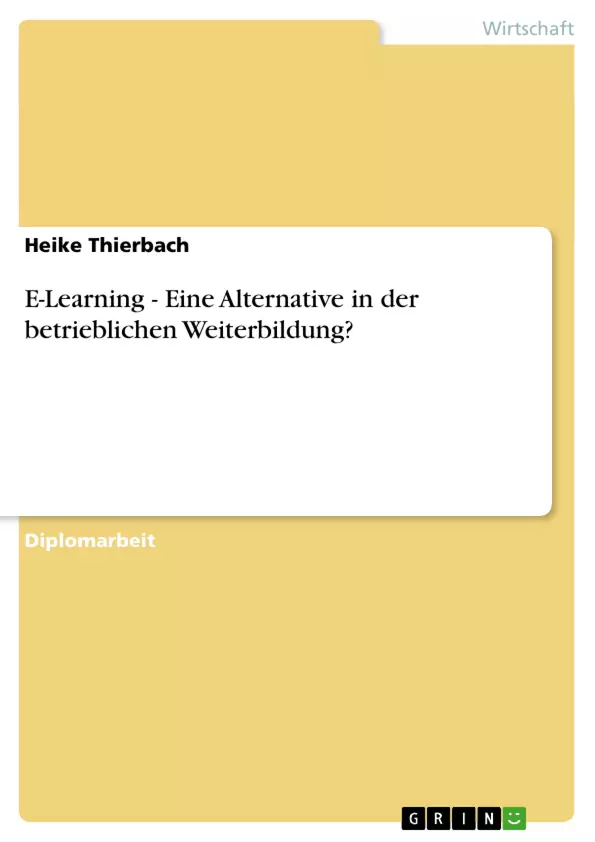Unternehmen häufen im Laufe der Jahre einen beeindruckenden
Wissensberg an. Durch die Entwicklung der Informationstechnologie
explodiert die Masse an menschlichem Wissen geradezu.1 Unsere
Gesellschaft ist auf dem Weg, sich von einer Informationsgesellschaft
zu einer Wissensgesellschaft zu transformieren.
1.1 Problemstellung
Auch Unternehmen, die ein Teil dieser Gesellschaft sind, müssen
dieser Dynamik der Wissensentstehung Rechnung tragen und ihre
Mitarbeiter dementsprechend fördern.2 Die Förderung der Mitarbeiter
fällt dabei in den Aufgabenbereich der Weiterbildung. Die Kompetenzen
der Mitarbeiter, ihre Einstellungen und Werte rücken in den
Vordergrund. Die Wissensgesellschaft braucht gut informierte Bürger,
die ihre Entscheidungen aufgrund ihres umfangreichen Wissens
treffen.3
Aus dieser Entwicklung heraus resultiert die Notwendigkeit eines
umfassend organisierten Wissensmanagements als Teilbereich der
Unternehmenskultur.4 Heute ist es unmöglich, mit einer einmal
absolvierten Ausbildung auf Dauer eine marktfähige Arbeitskraft zu
sein. Die Halbwertzeit des Wissens ist so hoch, dass das Wissen
ganzer Berufs-zweige innerhalb von zehn Jahren völlig veraltet.5
Das Wissensmanagement wird im Unternehmen eingesetzt, um Wissen
bedarfsgerecht verfügbar zu machen und verstreutes Wissen im
Unternehmen zu verwalten.6 Gezielter Erwerb von Wissen bietet Unternehmen, laut dem Institut der deutschen Wirtschaft, ein enormes
Potential an Zeit- und Kostenersparnis.7
Die Entwicklung des Wissensmanagements entstand aus der
Erkenntnis, dass Lernen kein einmaliges Ereignis ist, sondern einen
permanenten Prozess darstellt. Das Unternehmensnetzwerk wird zu
einem Wissensnetzwerk, in das auch andere Stakeholder des
Unternehmens wie Kunden und Lieferanten miteinbezogen werden.8 [...]
1 Vgl. Schwuchow, Karlheinz, (Wissensmanagement und E-Learning 2001/2002), S.43.
2 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Gabi/Mandl, Heinz (Virtuelle Seminare 2001), S.11.
3 Vgl. Reinmann-Rothmeier, Gabi/Mandl, Heinz (Virtuelle Seminare 2001), S.11
4 Vgl. Müller, Gabriele, (Weiterbildung und Wissens-Management 2000), S.57.
5 Vgl. Magnus, Stephan, (E-Learning 2001), S.29.
6 Vgl. Herbst, Dieter, (Erfolgsfaktor Wissensmanagement 2000), S.12.
7 Vgl. Schwuchow, Karlheinz, (Wissensmanagement und E-Learning 2001/2002), S.43.
8 Vgl. Herbst, Dieter, (Erfolgsfaktor Wissensmanagement 2000), S.12.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- GRUNDLAGEN DER BETRIEBLICHEN WEITERBILDUNG
- Begriffsdefinition Betriebliche Weiterbildung
- Stellung der Weiterbildung im Unternehmensprozess
- Ziele der Weiterbildung
- Arten der Weiterbildung
- Training off the Job
- Training on the Job
- Auswahl der Weiterbildungsart
- Themen der klassischen Weiterbildung
- Kosten der klassischen Weiterbildung
- Faktoren der Weiterbildungsbeteiligung
- Beurteilung der jetzigen Situation
- E-LEARNING
- Definition E- Learning
- E-Learning in der betrieblichen Weiterbildung
- Entstehung des E-Learning-Konzeptes
- Computer-Based-Training (CBT)
- Web-Based-Training (WBT)
- Kritische Betrachtung der Ansätze
- BILDUNGSMAẞNAHMEN BEIM E-LEARNING
- Der Lernprozess
- Aufbau von Bildungsmaßnahmen beim E-Learning
- Lernmethoden
- Übungs- und Trainingsprogramme
- Tutorienprogramme
- Simulationen und Planspiele
- Performance-Support-System
- Chatrooms, Foren, Diskussionsräume
- Anwendung der Lernprogramme
- Struktur von Bildungsmaßnahmen
- Kommunikationsformen des E-Learning
- Synchrone Kommunikation
- Vorteile synchronen Kommunikation
- Nachteile synchronen Kommunikation
- Asynchrone Kommunikation
- Vorteile asynchronen Kommunikation
- Nachteile asynchronen Kommunikation
- Kommunikationsstil beim E-Learning
- Inhalte von E-Learning-Programmen
- Allgemeindidaktische Kriterien
- Fachdidaktische Kriterien
- Ethische und juristische Aspekte
- Klassische Inhalte des E-Learning
- Zertifizierung der Bildungsmaßnahme
- Einsatz der Bildungsmaßnahmen
- LERNUMGEBUNGEN
- Web-Based-Lernplattform
- Kosten bei der Web-Based-Lernplattform
- Praxisbeispiel Web-Based-LernplattformSABA
- Stärken der Web-Based-Lernplattform
- Schwächen der Web-Based-Lernplattform
- Application-Service-Providing-Modell (ASP)
- Kosten ASP
- Praxisbeispiel ASP: BMW AG
- Stärken ASP
- Schwächen ASP
- Inhouse-Lösungen
- Kosten einer Inhouse-Lösung
- Praxisbeispiel Inhouse-Lösung: Commerzbank
- Stärken einer Inhouse-Lösung
- Schwächen einer Inhouse-Lösung
- Corporate University(CU)
- Kosten einer Corporate University
- Praxisbeispiel: IBM
- Praxisbeispiel Fernuniversität Hagen
- Stärken einer Corporate University
- Schwächen einer Corporate University
- EINFÜHRUNG DES E-LEARNING-KONZEPTES IM UNTERNEHMEN
- Analyse und Konzeptphase
- Problem- und Bedarfsanalyse
- Zielgruppenanalyse
- Struktur- und Ressourcenanalyse
- Einsatzkontextanalyse
- Pilotprojekt
- Einführung im gesamten Unternehmen
- PRAXISBEISPIELE FÜR ERFOLGREICHE E-LEARNING-KONZEPTE
- Lufthansa „Learnway“
- Allianz-Versicherungs-AG
- „Allianz-Lern-Forum“
- „Learning-Network-Allianz“
- Beurteilung der Praxisbeispiele
- Allgemeine Praxissituation in Deutschland
- KRITISCHE BETRACHTUNG VON E-LEARNING
- Potentiale des E-Learning-Konzeptes
- Problematiken des E-Learning-Konzeptes
- Schlussbetrachtung
- Grundlagen der betrieblichen Weiterbildung
- E-Learning in der betrieblichen Weiterbildung
- Bildungsmaßnahmen im E-Learning-Kontext
- Lernumgebungen im E-Learning
- Einführung von E-Learning in Unternehmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, ob E-Learning eine Alternative in der Weiterbildung darstellt. Die Arbeit analysiert die Grundlagen der betrieblichen Weiterbildung, untersucht die Funktionsweise und die Potenziale von E-Learning im Unternehmenskontext und betrachtet kritisch die Herausforderungen und Chancen des Konzepts.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition der betrieblichen Weiterbildung und beleuchtet deren Bedeutung im Unternehmensprozess. Es werden die Ziele, Arten und Themen der Weiterbildung sowie die Kosten und Faktoren der Weiterbildungsbeteiligung erläutert.
Im Anschluss wird das E-Learning-Konzept definiert und in Bezug zur betrieblichen Weiterbildung gesetzt. Die Entstehung des E-Learning-Konzeptes wird betrachtet und kritisch beleuchtet.
Die Arbeit analysiert detailliert Bildungsmaßnahmen im E-Learning-Kontext. Der Lernprozess, die Struktur von Bildungsmaßnahmen, Lernmethoden und Kommunikationsformen werden untersucht. Es werden die Inhalte von E-Learning-Programmen betrachtet und die Zertifizierung von Bildungsmaßnahmen behandelt.
Darüber hinaus werden verschiedene Lernumgebungen im E-Learning vorgestellt, darunter Web-Based-Lernplattformen, Application-Service-Providing-Modelle (ASP), Inhouse-Lösungen und Corporate Universities (CU). Die Arbeit erläutert die Kosten, Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle anhand von Praxisbeispielen.
Die Arbeit untersucht die Einführung des E-Learning-Konzeptes in Unternehmen, beginnend mit der Analyse- und Konzeptphase bis hin zur Einführung im gesamten Unternehmen. Es werden Praxisbeispiele für erfolgreiche E-Learning-Konzepte präsentiert und die allgemeine Praxissituation in Deutschland betrachtet.
Abschließend werden die Potentiale und Problematiken des E-Learning-Konzeptes kritisch betrachtet. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung, die die Erkenntnisse der Analyse zusammenfasst und die Frage nach der Alternative des E-Learning in der Weiterbildung beantwortet.
Schlüsselwörter
E-Learning, betriebliche Weiterbildung, Lernumgebung, Bildungsmaßnahme, Lernprozess, Web-Based-Lernplattform, Application-Service-Providing-Modell (ASP), Inhouse-Lösung, Corporate University (CU), Kommunikation, Inhalte, Zertifizierung, Einführung, Potentiale, Problematiken.
Häufig gestellte Fragen
Ist E-Learning eine echte Alternative zur klassischen betrieblichen Weiterbildung?
Die Arbeit untersucht, ob E-Learning angesichts der hohen Halbwertszeit von Wissen und der Anforderungen der Wissensgesellschaft eine effiziente und kostensparende Alternative darstellt.
Was ist der Unterschied zwischen CBT und WBT?
CBT steht für Computer-Based-Training (lokal), während WBT (Web-Based-Training) über das Internet oder Firmennetzwerke stattfindet und oft aktuellere Inhalte bietet.
Welche Lernumgebungen werden im Unternehmen unterschieden?
Die Arbeit stellt Web-Based-Lernplattformen, Inhouse-Lösungen, Corporate Universities und das Application-Service-Providing-Modell (ASP) vor.
Was sind Vorteile der asynchronen Kommunikation beim E-Learning?
Asynchrone Formate wie Foren erlauben zeitversetztes Lernen und bieten Flexibilität, während synchrone Formate wie Chatrooms den direkten Austausch fördern.
Welche Praxisbeispiele für erfolgreiches E-Learning werden genannt?
Die Arbeit analysiert Konzepte von Unternehmen wie Lufthansa („Learnway“), Allianz („Allianz-Lern-Forum“), BMW und IBM.
- Citar trabajo
- Heike Thierbach (Autor), 2002, E-Learning - Eine Alternative in der betrieblichen Weiterbildung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19461