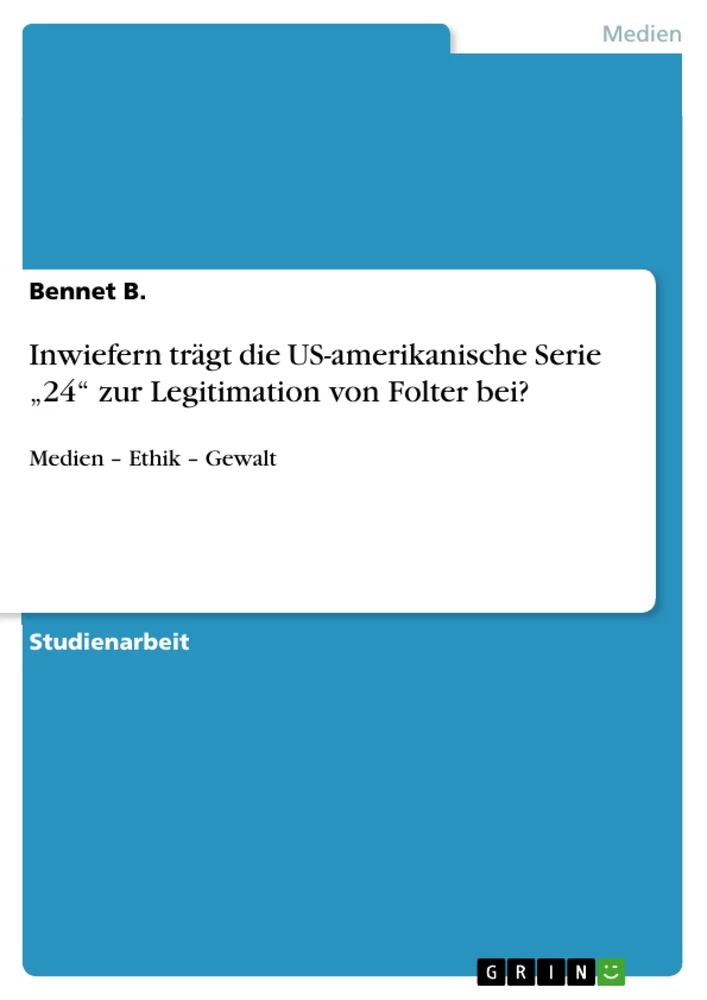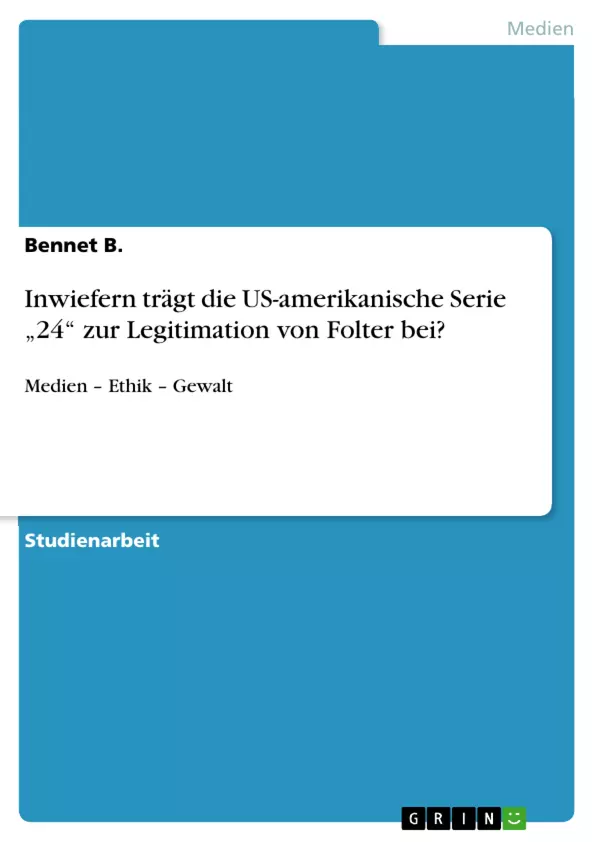Um die Frage nach der Auswirkung der Folterdarstellungen in „24“ auf die Gefühle und Meinungen der Rezipienten beantworten zu können, entschloss sich die Forschungsgruppe für eine empirische Untersuchung anhand eines quantitativen Fragebogens und drei moderierten qualitativen Gruppendiskussionen.
Mit Hilfe des Fragebogens sollen vor dem Einsatz des Stimulusmaterials – nämlich eine ausgewählte Folge der Serie „24“ - Informationen über das allgemeine Rezeptionsverhalten sowie über die persönliche Einstellung der Probanden gegenüber der Legitimation von Folter eingeholt werden. Anschließend wurde das Stimulusmaterial eingesetzt und moderierte Gruppendiskussionen durchgeführt. Diese wurden für die Transkription per Videokamera aufgezeichnet.
Zunächst werden die Ergebnisse einer quantitativen Auswertung der Fragebögen präsentiert, bevor eine qualitative Auswertung der Fragebögen im Rahmen der späteren Diskussionsgruppen dargelegt wird. Auf die ermittelten Daten wird in einer anschließenden Ergebnisinterpretation der einzelnen Gruppendiskussion zurückgegriffen. Dabei wurde nicht nur auf die spezifische Zusammensetzung der Gruppen, sondern auch auf die jeweilige Gruppendynamik geachtet. Um der Präsentation der Aussagen der Probanden eine Systematik aufzuerlegen, wurden die Diskussionen aller drei Gruppen nach Hauptthemengebieten strukturiert und anschließend analysiert. In eine abschließende Gesamtanalyse fließen alle zentralen Ergebnisse der zuvor durchgeführten Auswertungen und Interpretationen. Dabei versucht das Forschungsteam, die Ausgangsfragen anhand der Ergebnisse aus den Gruppen zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorieteil
- 2.1. Sichtweise Folter in Deutschland und den USA
- 2.1.1 Definition Folter
- 2.1.2. Folter in Deutschland
- 2.1.3. Folter in den U.S.A.
- 2.1.4. Gegenüberstellung der Folter in Deutschland und den USA
- 2.2. Die Serie „24“
- 2.2.1. Motive der Produzenten
- 2.2.2. Inhaltsanalyse der Serie
- 2.2.3. Reaktion im amerikanischen und deutschsprachigen Raum
- 2.1. Sichtweise Folter in Deutschland und den USA
- 3. Beschreibung des Experiments „24“
- 3.1. Begründung der Methodik
- 3.2. Steckbrief des Forschungsexperiments
- 3.3. Der Fragebogen
- 3.3.1. Aufbau des Fragebogens
- 3.4. Stimulusmaterial für die Gruppendiskussion
- 3.4.1. Inhaltsangabe der gezeigten Folge 12 der Staffel 2
- 3.4.2. Begründung für die Wahl der Folge
- 3.5. Die Gruppendiskussion
- 3.6 Aufbau des Moderations-Leitfadens
- 4. Analyse des Experiments „24“
- 4.1. Quantitative Fragenbogenauswertung gesamt
- 4.2. Analyse Gruppendiskussionen
- 4.2.1. Gruppe 1
- 4.2.2. Gruppe 2
- 4.2.3. Gruppe 3
- 4.3. Analyse der Kategorien aus der Gruppendiskussionen
- 4.3.1. Medienrezeption
- 4.3.2. Serie „24“
- 4.3.3. Übertragung der Debatte auf Amerika
- 4.3.4. Aufnahme der Folterdebatte
- 4.3.5. Gesellschaftlicher Blick
- 4.4. Analyse des Experiments
- 5. Fazit
- 6. Erfahrungsbericht
- 6.1 Themenwahl und Vorbereitung
- 6.2 Vorbereitung des Experiments
- 6.3 Verlauf der Gruppendiskussionen, Auswertung der Fragebögen
- 6.4 Transkription
- 6.5 Auswertung der Fragebögen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit die US-amerikanische Fernsehserie „24“ zur Legitimation von Folter beiträgt. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Werden Rezipienten die dargestellte Folter auf ihre Wahrnehmung von Folter in der Realität übertragen und die Argumentation der Serie in Diskussionen übernehmen? Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit einer empirischen Untersuchung mittels Fragebogen und Gruppendiskussionen.
- Definition und historische Entwicklung von Folter in Deutschland und den USA
- Inhaltsanalyse der Serie „24“ und die Motive der Produzenten
- Reaktionen auf „24“ im amerikanischen und deutschsprachigen Raum
- Empirische Untersuchung der Rezipientenreaktionen auf die Folterdarstellungen
- Einfluss der Serie auf den öffentlichen Diskurs über Folter
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der Serie „24“ auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Folter. Sie hebt die kontroverse Rolle der Serie im Kontext von realen Folterpraktiken der US-Armee hervor und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der sowohl theoretische als auch empirische Methoden kombiniert.
2. Theorieteil: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Er definiert den Begriff der Folter und beleuchtet die unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen Perspektiven auf Folter in Deutschland und den USA. Weiterhin wird eine detaillierte Inhaltsanalyse der Serie „24“ vorgenommen, die die dramaturgischen Mittel und die Motive der Produzenten analysiert. Abschließend werden die Reaktionen auf die Serie in beiden Ländern untersucht, um den Kontext für die folgende empirische Untersuchung zu schaffen.
3. Beschreibung des Experiments „24“: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Begründung für die Wahl von quantitativen Fragebögen und qualitativen Gruppendiskussionen als Forschungsmethoden. Der Aufbau des Fragebogens und der Ablauf der Gruppendiskussionen werden detailliert dargestellt, inklusive der Auswahl und Begründung des verwendeten Stimulusmaterials (eine Folge von „24“).
4. Analyse des Experiments „24“: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert und analysiert. Die quantitative Auswertung der Fragebögen wird ebenso dargestellt wie die qualitative Auswertung der Gruppendiskussionen. Die Analyse betrachtet verschiedene Kategorien wie Medienrezeption, die Serie „24“, die Übertragung der Debatte auf Amerika, die Aufnahme der Folterdebatte und den gesellschaftlichen Blick auf das Thema.
Schlüsselwörter
Folter, Terrorismus, Medienethik, Fernsehserie „24“, Medienrezeption, Empirische Medienforschung, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden, Gruppendiskussion, Fragebogen, USA, Deutschland, öffentlicher Diskurs, Legitimation von Gewalt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Der Einfluss der Fernsehserie „24“ auf die Wahrnehmung von Folter
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die US-amerikanische Fernsehserie „24“ zur Legitimation von Folter beiträgt. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Werden Rezipienten die dargestellte Folter auf ihre Wahrnehmung von Folter in der Realität übertragen und die Argumentation der Serie in Diskussionen übernehmen?
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit einer empirischen Untersuchung. Die empirische Untersuchung nutzt quantitative Fragebögen und qualitative Gruppendiskussionen, um die Rezipientenreaktionen auf die Folterdarstellungen in „24“ zu analysieren.
Welche Aspekte werden im Theorieteil behandelt?
Der Theorieteil definiert den Begriff der Folter, beleuchtet historische und gesellschaftliche Perspektiven auf Folter in Deutschland und den USA, analysiert die Serie „24“ (Inhaltsanalyse und Motive der Produzenten) und untersucht die Reaktionen auf die Serie in beiden Ländern.
Wie wurde das Experiment aufgebaut?
Das Experiment besteht aus quantitativen Fragebögen und qualitativen Gruppendiskussionen. Der Fragebogen erfasst die Einstellungen der Teilnehmer. Die Gruppendiskussionen verwenden einen Stimulus: eine ausgewählte Folge der Serie „24“, um Diskussionen über Folter anzuregen. Die Methodik wird im Detail beschrieben, inklusive der Begründung der Methodenwahl und des Stimulusmaterials.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse umfassen die quantitative Auswertung der Fragebögen und die qualitative Auswertung der Gruppendiskussionen. Die Analyse betrachtet Kategorien wie Medienrezeption, die Serie „24“, die Übertragung der Debatte auf Amerika, die Aufnahme der Folterdebatte und den gesellschaftlichen Blick auf das Thema. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus der Kombination der theoretischen und empirischen Ergebnisse, bezüglich des Einflusses von „24“ auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Folter und die Übernahme der Argumentation der Serie in Diskussionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Folter, Terrorismus, Medienethik, Fernsehserie „24“, Medienrezeption, Empirische Medienforschung, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden, Gruppendiskussion, Fragebogen, USA, Deutschland, öffentlicher Diskurs, Legitimation von Gewalt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von einem Theorieteil, der Beschreibung des Experiments, der Analyse des Experiments, einem Fazit und einem Erfahrungsbericht zur Durchführung der Arbeit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist verfügbar.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, welches sich mit den Themen Folter, Medienrezeption und dem Einfluss von Medien auf den öffentlichen Diskurs auseinandersetzt.
- Citation du texte
- Bennet B. (Auteur), 2010, Inwiefern trägt die US-amerikanische Serie „24“ zur Legitimation von Folter bei?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194818