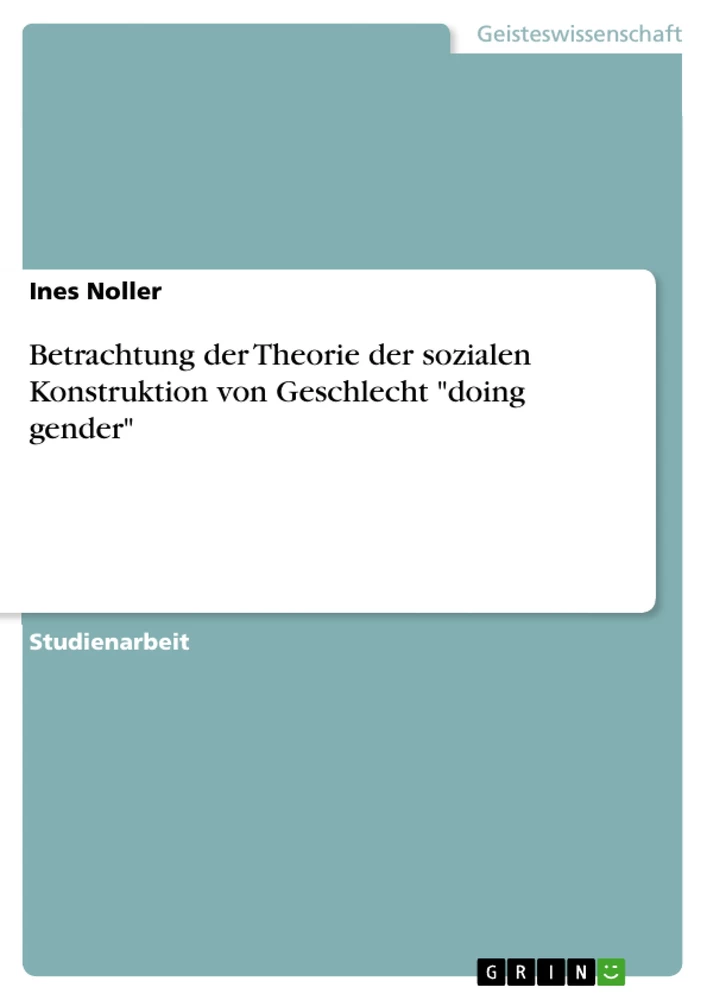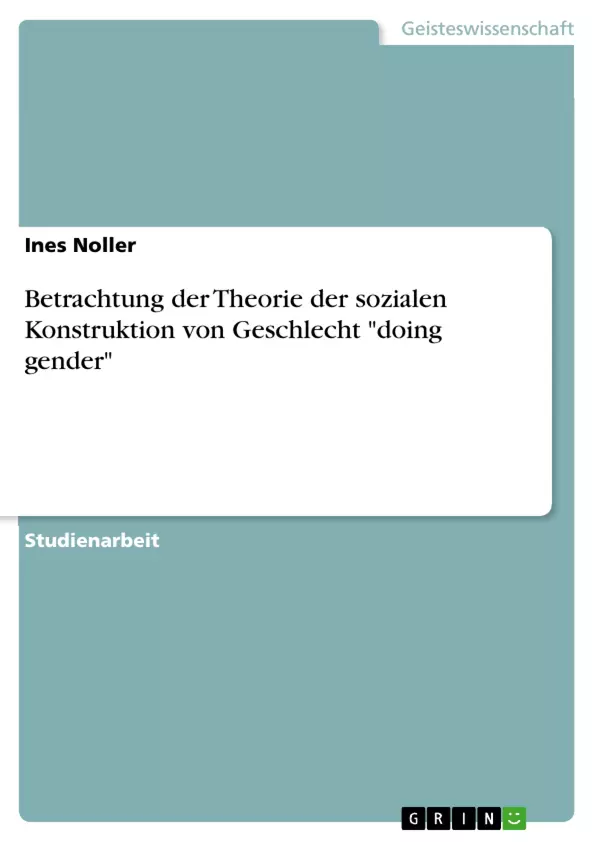Die westliche Gesellschaft kennt zwei und nur zwei Geschlechter, das weibliche und das männliche Geschlecht. Das Wissen um die Zweigeschlechtlichkeit der Menschheit gehört zum Alltagswissen der Mitglieder unserer Gesellschaft. Die Geschlechtszugehörigkeit ist eindeutig an den Genitalien bestimmbar und steht von Geburt an fest. Der Mensch muss also einem der beiden Geschlechter angehören. Diese genannten Tatsachen gehören zur Basis der sozialen Wirklichkeit unserer Gesellschaft und werden als ein „natürlicher, biologisch eindeutig bestimmbarer Tatbestand“ verstanden. Konzepte der sozialen Konstruktion von Geschlecht, stellen dieses Alltagswissen jedoch in Frage und sehen das biologische Geschlecht eines Menschen „nicht als (die) Basis, sondern als Effekt sozialer Praxis“ .
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Kurzer historischer Abriss der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen
3 Soziale Konstruktion von Geschlecht: "doing gender"
3.1 Die Darstellung von Geschlecht
3.2 Geschlechtliche Fixierung von Individuen
4 Schlussbemerkung
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die westliche Gesellschaft kennt zwei und nur zwei Geschlechter, das weibliche und das männliche Geschlecht. Das Wissen um die Zweigeschlechtlichkeit der Menschheit gehört zum Alltagswissen der Mitglieder unserer Gesellschaft. Die Geschlechtszugehörigkeit ist eindeutig an den Genitalien bestimmbar und steht von Geburt an fest. Der Mensch muss also einem der beiden Geschlechter angehören.[1] Diese genannten Tatsachen gehören zur Basis der sozialen Wirklichkeit unserer Gesellschaft und werden als ein „natürlicher, biologisch eindeutig bestimmbarer Tatbestand“[2] verstanden. Konzepte der sozialen Konstruktion von Geschlecht, stellen dieses Alltagswissen jedoch in Frage und sehen das biologische Geschlecht eines Menschen „nicht als (die) Basis, sondern als Effekt sozialer Praxis“[3].
2 Kurzer Historischer Abriss der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen
Erst ab den 18. Und 19. Jahrhundert gewinnt das Wissen um die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen deutliche Konturen. Zur Teildisziplin von Biologie und Medizin wird es jedoch erst ab dem 20. Jahrhundert. Bis zum 18. Jahrhundert herrscht in der Medizin noch das antike Ein-Geschlechter-Modell, das die weiblichen Genitalien noch als die nach innen gewendeten Version der männlichen sah, vor. Dieses wird nun jedoch von einem Zwei-Geschlechter-Modell abgelöst, das Männer und Frauen als grundlegend verschieden definiert und von biologischen Merkmalen abhängig macht. Dieses Modell bezieht sich jedoch nicht nur auf die Verzweigeschlechtlichung des Menschen, sondern auch auf die gesamte Natur. Auch Pflanzen werden Geschlechter zugeschrieben und weibliche Tiernamen vergeben.[4] Die Molekularbiologie des 20. Jahrhunderts macht deutlich, dass
„nicht nur die zweigeschlechtliche Klassifikation, sondern die grundlegenden Denkmodelle der Biologie (sind) der Sozialwelt der und dem jeweils zeitgenössischen Alltagswissen entnommen [sind]. Die Geschlechterdifferenz und mit ihr ggfs. historisch variable Geschlechterstereotype werden aus der Gesellschaft in die Wissenschaft und von der Wissenschaft in die Natur transferiert – nicht umgekehrt.[5]
Die Produktion wissenschaftlichen Wissens ist also ebenfalls als eine Art der Geschlechterkonstruktion zu verstehen.
3 Soziale Konstruktion von Geschlecht: „doing gender“
Ein erster Schritt der die feste Verkoppelung von Natur und Geschlecht zu trennen vermochte war die Unterteilung in „sex“ und „gender“ in den 50er Jahren. Unter „sex“ wurde nun das biologische Geschlecht verstanden unter dem man unter anderem die Anatomie des Körpers, seine Morphologie und seine Physiologie zusammenfasste. Unter „gender“ verstand man nun ein soziales Geschlecht, „im Sinne seiner sozialen und kulturellen Prägung“[6].
Das Konzept der sozialen Konstruktion von Geschlecht hat sich erst mit Beginn der 90er Jahre in der Geschlechterforschung etabliert.[7] „Doing gender“ ist eine Perspektive dieses Konzepts. Es zielt darauf ab, jene sozialen Prozesse zu betrachten, in denen „Geschlecht als sozial folgenreiche Unterscheidung hervorgebracht und reproduziert wird“[8]. Geschlechtsmerkmale werden also nicht als Eigenschaft oder Merkmal einer Person gesehen. Zentrale Frage des „doing gender“ ist es, wie es zu einer Zweiteilung der Geschlechter in Mann und Frau kommt. Wobei die soziale Ungleichheit der Geschlechter im Kontext sozio-kultureller Normierungen nicht als Folge körperlicher Differenz betrachtet wird. Geschlecht ist historisch nicht biologisch begründet und somit wandelbar.
3.1 Die Darstellung von Geschlecht
Es ist, in einer Gesellschaft die auf der Polarisierung der Geschlechter beruht, unmöglich sich eine Identität außerhalb eines Geschlechterbezugs anzueignen. In unserem Kulturkreis herrscht die Annahme der Dichotomizität vor, unser Alltagswissen geht von der Ablesbarkeit des Geschlechts am Körper aus.
[...]
[1] Vgl. Angelika Wetterer: Konstruktion von Geschlecht, S. 126
[2] Ebd.
[3] Ebd.
[4] Vgl. Angelika Wetterer: Konstruktion von Geschlecht, S. 130
[5] Angelika Wetterer: Konstruktion von Geschlecht, S. 131
[6] Sylvia Marlene Wilz: Geschlechterdifferenzen-Geschlechterdifferenzierungen, S. 167
[7] Sylvia Marlene Wilz: Geschlechterdifferenzen-Geschlechterdifferenzierungen, S. 169
[8] Sylvia Marlene Wilz: Geschlechterdifferenzen-Geschlechterdifferenzierungen, S. 167
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept „doing gender“?
„Doing gender“ beschreibt Geschlecht nicht als angeborene Eigenschaft, sondern als ein Ergebnis kontinuierlicher sozialer Prozesse und Praktiken, durch die Geschlechtsidentität erst hergestellt wird.
Was ist der Unterschied zwischen „sex“ und „gender“?
„Sex“ bezieht sich auf das biologische Geschlecht (Anatomie, Physiologie), während „gender“ das soziale und kulturell geprägte Geschlecht bezeichnet.
Seit wann gibt es das Modell der strikten Zweigeschlechtlichkeit?
Obwohl es heute als „natürlich“ gilt, gewann das Modell der Zweigeschlechtlichkeit erst im 18. und 19. Jahrhundert an Konturen und löste ältere Modelle (wie das Ein-Geschlechter-Modell) ab.
Ist Geschlecht biologisch oder sozial begründet?
Das Konzept der sozialen Konstruktion geht davon aus, dass das biologische Geschlecht oft erst durch soziale Praxis und wissenschaftliche Denkmodelle als eindeutige Basis definiert wird.
Warum ist es schwer, sich außerhalb eines Geschlechtsbezugs zu identifizieren?
Da unsere Gesellschaft auf der Polarisierung der Geschlechter beruht, ist unser Alltagswissen auf die Ablesbarkeit des Geschlechts am Körper angewiesen, was eine geschlechtsneutrale Identität erschwert.
- Quote paper
- Ines Noller (Author), 2011, Betrachtung der Theorie der sozialen Konstruktion von Geschlecht "doing gender", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195128