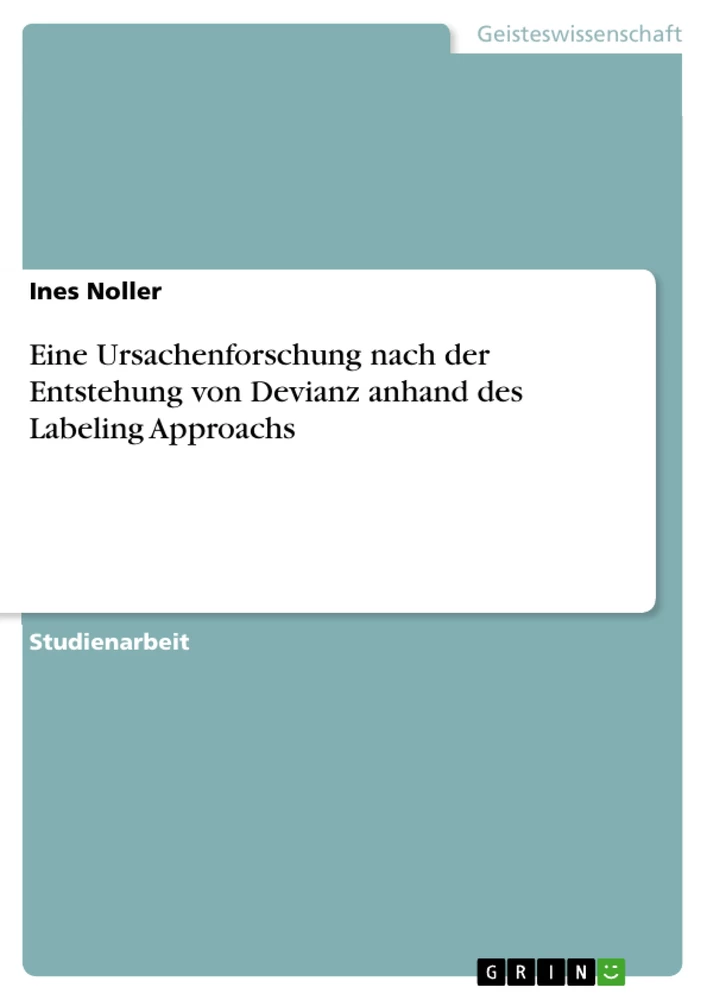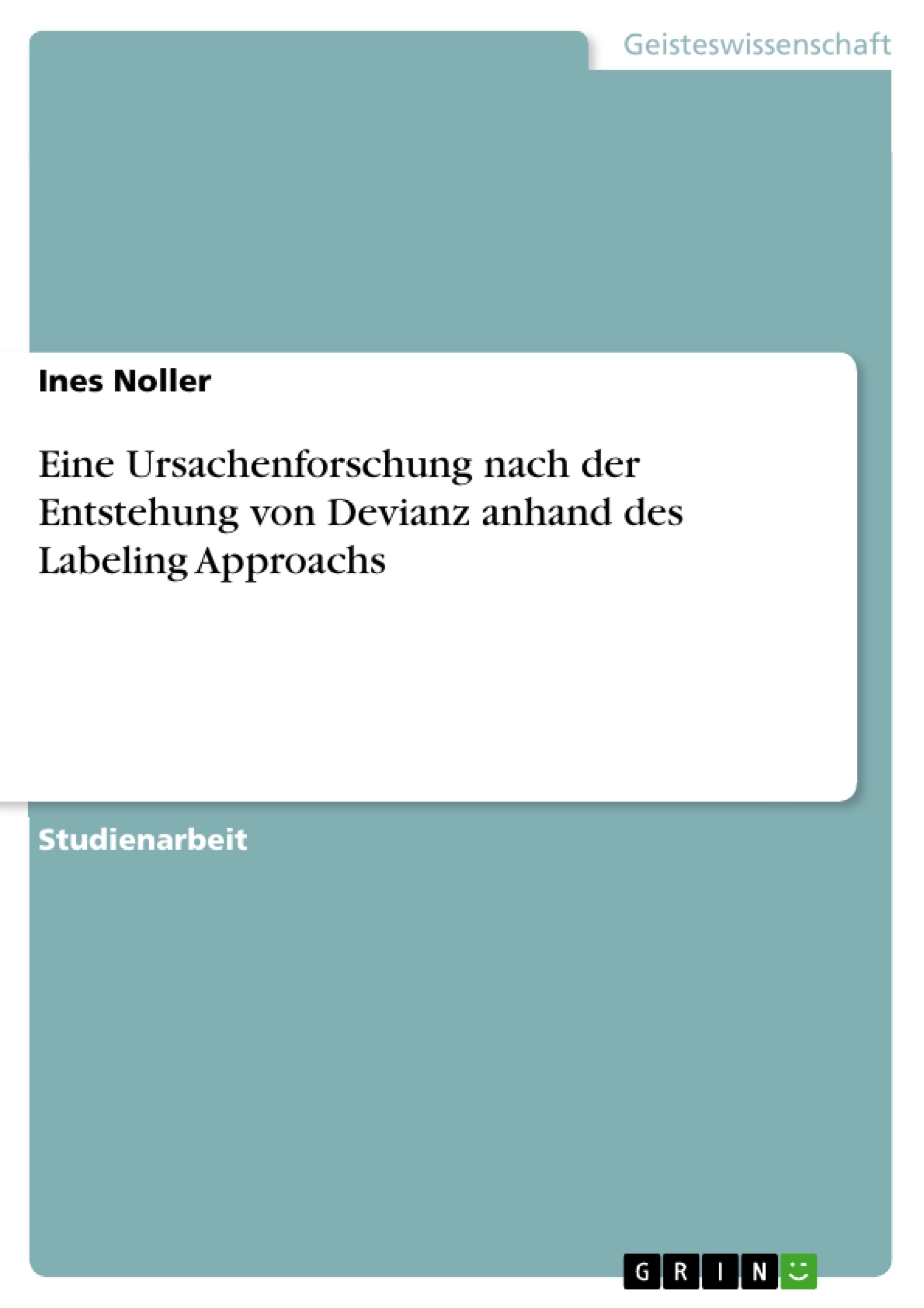Aufgrund des zunehmenden kriminellen Verhaltens junger Menschen wird die Frage nach den Ursachen für Delinquenz in der Gesellschaft immer gegenwärtiger. Viele Kriminalsoziologische Theoretiker befassen sich mittlerweile damit die Gründe der Täter zu untersuchen. Die konformen Gesellschaftsmitglieder möchten verstehen können was in den oftmals minderjährigen Tätern vor sich geht und was sie dazu bewegt so brutal zu handeln, wie es im Februar 2011 der Fall war. Am Berliner U-Bahnhof Lichtenberg wurde ein 30 jähriger Mann von Jugendlichen, im Alter zwischen 14 und 17 Jahren ins Koma geprügelt. Die jungen Täter hatten es auf die Wertgegenstände des Opfers abgesehen und schränkten ihre Gewalt auch dann nicht ein, als dieses bereits wehrlos am Boden lag.
Mit sozialpsychologischen Ansätzen versuchen nun viele Ansätze der Kriminalsoziologie die inneren Beweggründe der Täter zu ergründen. Im Folgenden soll jedoch die Entwicklung von Devianz im Allgemeinen, nach ihren Ursachen außerhalb des Individuums, mit Hilfe des Labeling Approachs untersucht werden. Dieser soziologisch relativ junge Ansatz der Ursachenforschung von abweichendem Verhalten, fasst den „Täter weniger als Subjekt denn als ein Wesen (…), dessen Verhalten letztlich ein Produkt von Zuschreibung ist“ , auf.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Abweichendes Verhalten
2.1 Die normativorientierte Definition
2.2 Die erwartungsorientierte Definition
2.3 Die sanktionsoientierte Definition
3 Die Theorie des Labeling Aproach zur Entstehung von Devianz
3.1 Der Etikettierungs- oder Reaktionsansatz
3.2 Primäre und sekundäre Devianz
3.3 Modell der abweichenden Karriere
3.4 Makro- und mikrosoziologische Prozessaspekte
4 Schlussbemerkung
5 Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des Labeling Approachs?
Der Labeling Approach (Etikettierungsansatz) besagt, dass abweichendes Verhalten nicht primär eine Eigenschaft der Tat ist, sondern das Ergebnis von Zuschreibungen und Reaktionen der Gesellschaft.
Was unterscheidet primäre von sekundärer Devianz?
Primäre Devianz ist der ursprüngliche Regelverstoß. Sekundäre Devianz entsteht, wenn die Person das Etikett „Abweichler“ in ihr Selbstbild übernimmt und daraufhin weiter delinquent handelt.
Was versteht man unter einer „abweichenden Karriere“?
Es beschreibt den Prozess, bei dem ein Individuum durch wiederholte Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung immer tiefer in kriminelle Strukturen gerät.
Wie definiert die Kriminalsoziologie abweichendes Verhalten?
Es gibt verschiedene Definitionen: normativorientiert (Regelbruch), erwartungsorientiert (Enttäuschung von Erwartungen) und sanktionsorientiert (Reaktion der Umwelt).
Welche Rolle spielt die Gesellschaft bei der Entstehung von Kriminalität laut diesem Ansatz?
Die Gesellschaft (bzw. Instanzen der sozialen Kontrolle) „schafft“ Devianz erst durch ihre Definitionen und die Stigmatisierung von Tätern.
- Quote paper
- Ines Noller (Author), 2011, Eine Ursachenforschung nach der Entstehung von Devianz anhand des Labeling Approachs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195132