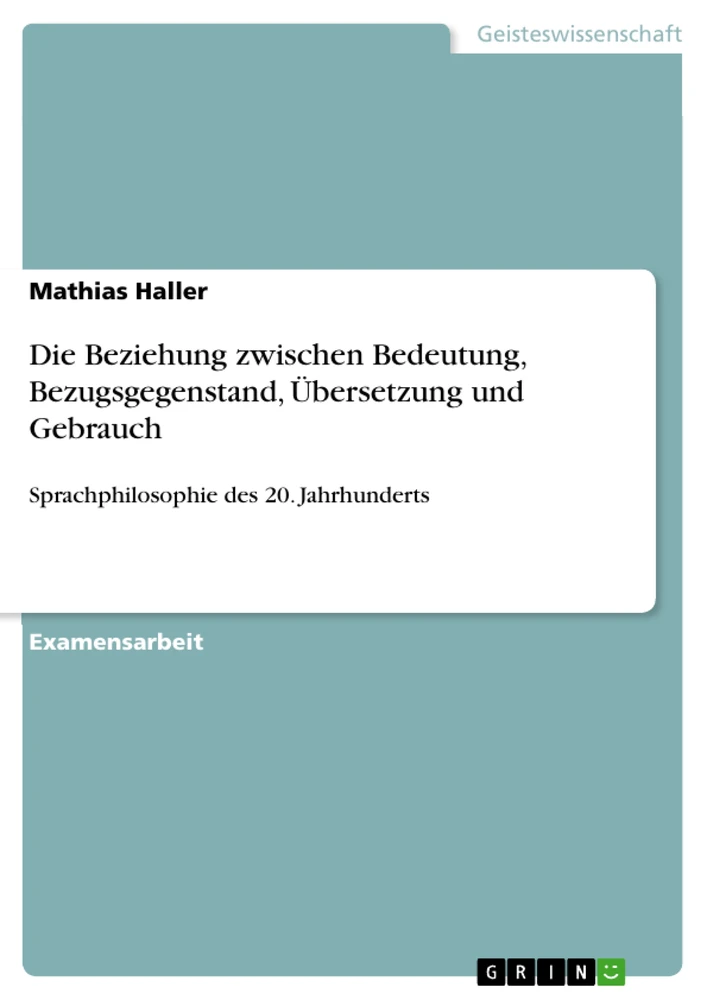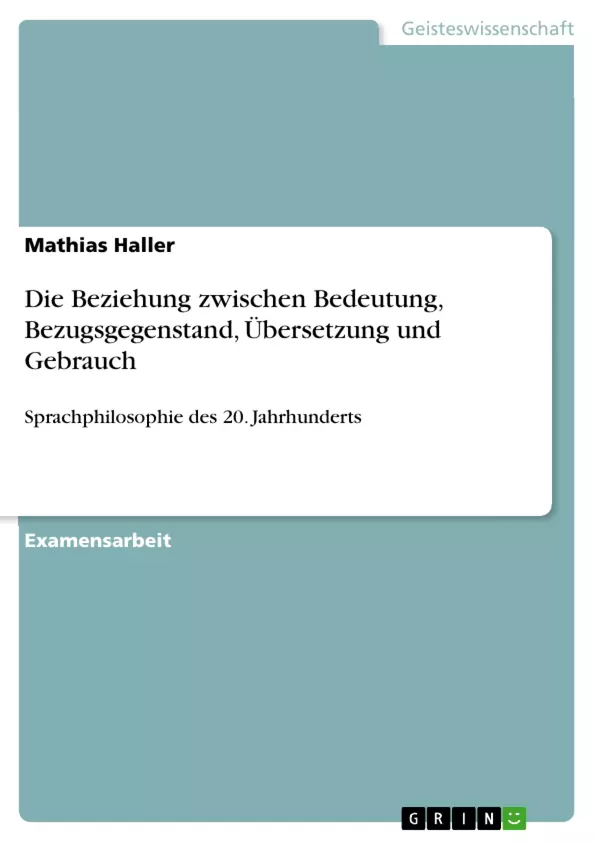Bedeutung ist einer der zentralen Begriffe in der Auseinandersetzung mit Sprache. Jedoch handelt es sich um einen äusserst schillernden Begriff. Sowohl in der Alltagssprache als auch in der wissenschaftlichen Diskussion ist die Bedeutung von „Bedeutung“ schwierig zu bestimmen (vgl. Ogden/Richards 1923, 185-208). Um erklären zu können, wie Sprache funktioniert, muss die erste fundamentale Frage demnach lauten: Was sind Bedeutungen, und auf welche weniger unscharf bestimmten Begriffe können wir Bedeutung zurückführen? Drei „Kandidaten“, die dafür in Frage kommen, sind die Begriffe Bezugsgegenstand, Übersetzung und Gebrauch. In der vorliegenden Arbeit soll anhand sprachphilosophischer Positionen des 20. Jahrhunderts gezeigt werden, wie der Bedeutungsbegriff mit den besagten Begriffen in Beziehung gebracht werden kann.
Im ersten Kapitel wird gezeigt, welche Probleme entstehen, wenn man Bedeutung einfach mit Bezugsgegenstand identifiziert. Im Anschluss daran soll mit der mentalistischen Konzeption der Bedeutung eine mögliche Alternative aufgezeigt werden. Die im Folgenden behandelten Positionen Putnams, Quines und Wittgensteins richten sich jeweils gegen diese mentalistische Auffassung von Bedeutung. Sie verfolgen in ihrer Kritik jedoch unterschiedliche Strategien, die zu verschiedenen Bestimmungen von Bedeutung führen. Während Putnam den Begriff des Stereotyps hinzuzieht, um Bedeutungen zu erklären, plädiert Quine im Rückgriff auf den Übersetzungsbegriff dafür, den Bedeutungsbegriff fallen zu lassen. Wittgenstein hingegen zeigt, dass, zumindest in vielen Fällen, Bedeutung durch Gebrauch ersetzt werden kann. Ziel der Arbeit ist es, in den einzelnen vorgestellten Theorien den Bedeutungsbegriff zu klären.
Im letzten Kapitel sollen mögliche Berührungspunkte zwischen den angesprochenen Positionen grob skizziert werden, um dadurch den Zusammenhang zwischen Bedeutung, Bezugsgegenstand, Übersetzung und Gebrauch noch klarer hervortreten zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung als Bezugsgegenstand
- Einwand I: Leere Bezeichner
- Einwand II: Gleicher Bezugsgegenstand bei verschiedener Bedeutung
- Einwand III: Nicht alle Ausdrücke sind Namen
- Mentalistische Bedeutungskonzeption
- Putnams Kritik an der mentalistischen Konzeption
- Bedeutung und Übersetzung bei Quine
- Bedeutung als regelgemässer Gebrauch bei Wittgenstein
- Vermittlungsversuch zwischen den einzelnen Positionen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem fundamentalen Begriff der Bedeutung und untersucht, wie er sich zu den Begriffen Bezugsgegenstand, Übersetzung und Gebrauch verhält. Anhand sprachphilosophischer Positionen des 20. Jahrhunderts werden die verschiedenen Beziehungen zwischen diesen Begriffen aufgezeigt.
- Die Problematik der Identifizierung von Bedeutung mit dem Bezugsgegenstand
- Die mentalistische Konzeption von Bedeutung und ihre Kritik
- Die Bedeutungstheorien von Putnam, Quine und Wittgenstein im Vergleich
- Mögliche Berührungspunkte zwischen den verschiedenen Positionen
- Klärung des Begriffs der Bedeutung in den einzelnen Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik des Begriffs „Bedeutung“ ein und stellt die drei zentralen Begriffe Bezugsgegenstand, Übersetzung und Gebrauch vor, auf die sich die Arbeit konzentriert.
Kapitel 2 untersucht die Schwierigkeit, Bedeutung mit dem Bezugsgegenstand zu identifizieren. Es werden drei Einwände gegen die Referenztheorie dargestellt, die von Russell formuliert wurden: leere Bezeichner, der Fall gleicher Bezugsgegenstände bei verschiedener Bedeutung und die Tatsache, dass nicht alle Ausdrücke Namen sind.
Kapitel 3 stellt die mentalistische Konzeption von Bedeutung vor, die eine Alternative zur Referenztheorie darstellt.
Kapitel 4 befasst sich mit Putnams Kritik an der mentalistischen Konzeption von Bedeutung und seinem Vorschlag, den Begriff des Stereotyps zur Erklärung von Bedeutung heranzuziehen.
Kapitel 5 behandelt Quines Auffassung von Bedeutung im Zusammenhang mit Übersetzung. Quine plädiert dafür, den Bedeutungsbegriff ganz fallen zu lassen und stattdessen den Übersetzungsbegriff in den Vordergrund zu stellen.
Kapitel 6 analysiert Wittgensteins Bedeutungstheorie, die Bedeutung als regelgemässen Gebrauch definiert.
Kapitel 7 versucht, mögliche Berührungspunkte zwischen den einzelnen Positionen zu finden, um den Zusammenhang zwischen Bedeutung, Bezugsgegenstand, Übersetzung und Gebrauch zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Bedeutung, Bezugsgegenstand, Übersetzung, Gebrauch, Referenztheorie, mentalistische Konzeption, Putnam, Quine, Wittgenstein, sprachphilosophische Positionen, 20. Jahrhundert.
- Quote paper
- Mathias Haller (Author), 2011, Die Beziehung zwischen Bedeutung, Bezugsgegenstand, Übersetzung und Gebrauch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195859