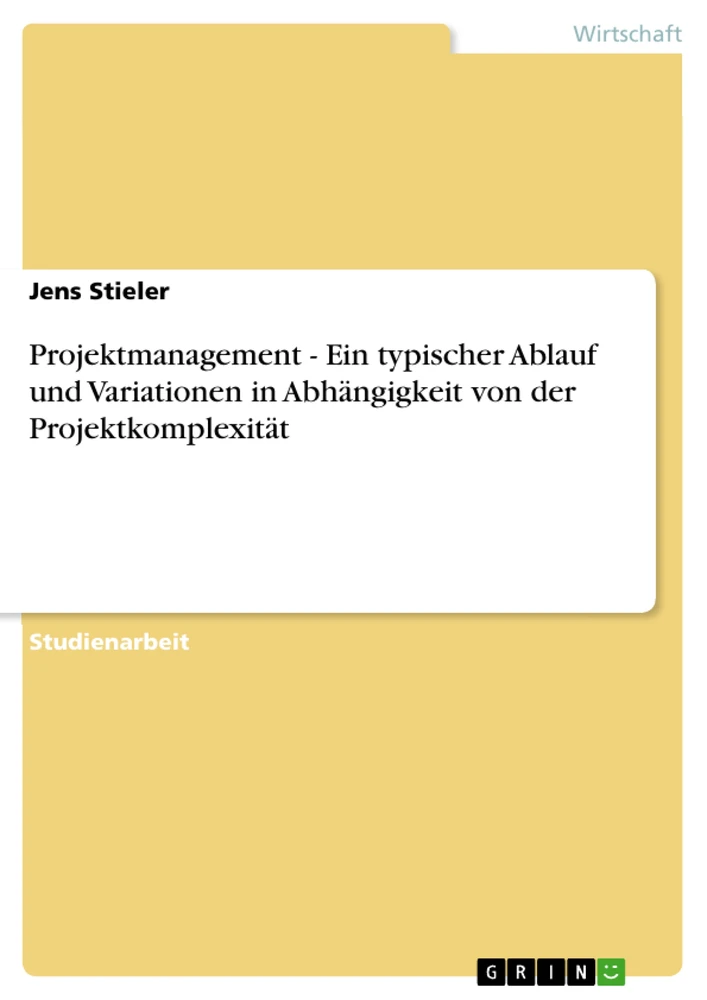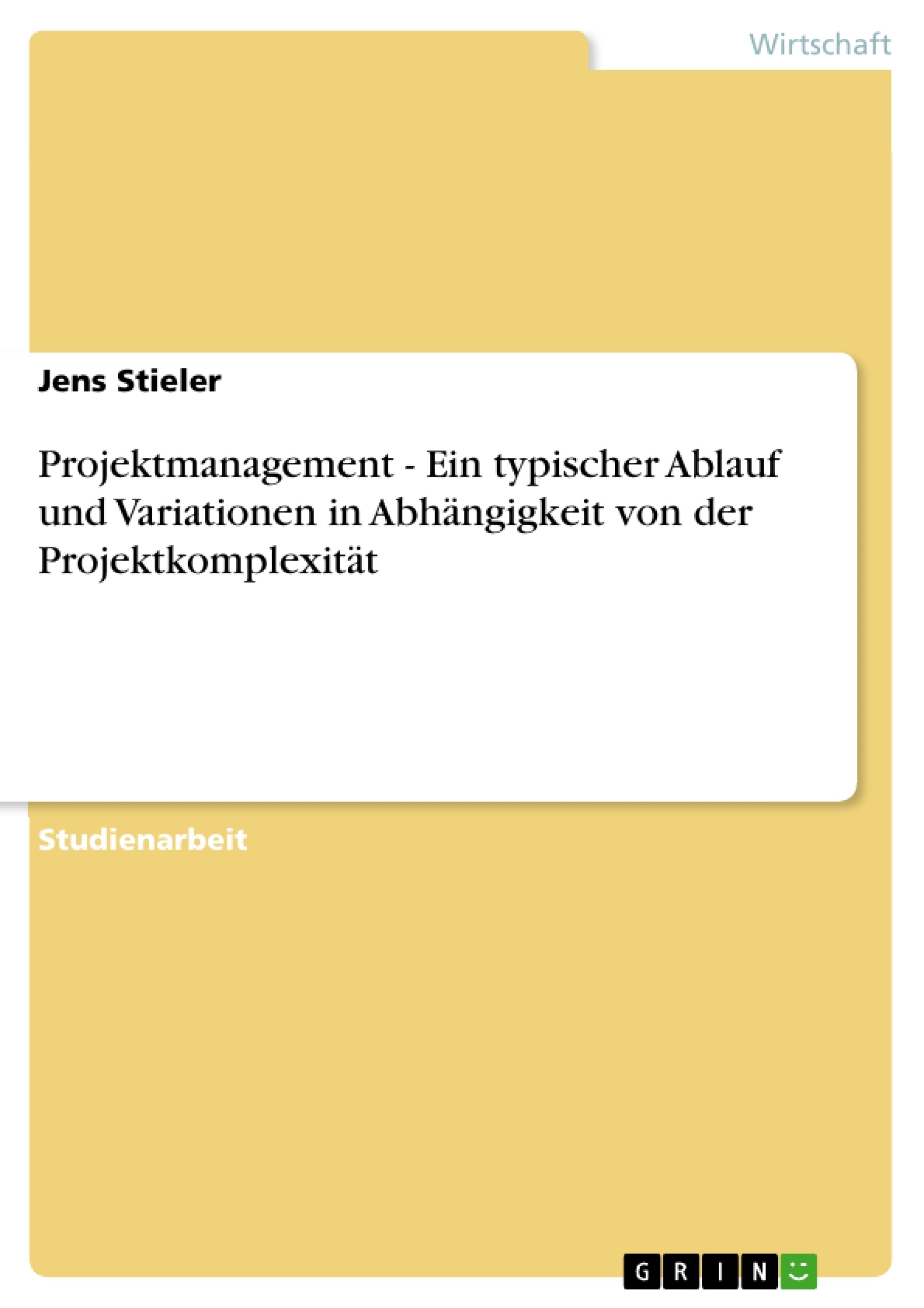In dieser Ausarbeitung werden nach der Schilderung des typischen Ablaufs eines Projektes mit seinen unterschiedlichen Phasen, deren Bedeutung in Abhängigkeit von der Projektkomplexität untersucht. Anschließend erfolgt eine kritische Betrachtung des Projektnutzens unter Berücksichtigung des dafür benötigten Aufwandes. Sie eignet sich insbesondere für den Personenkreis, der sich schnell über Projektmanagement und die typischen Instrumente einen Überblick verschaffen will. Ferner ist der Abwandlung eines typischen Ablaufs in Hinblick auf komplexe bzw. weniger komplexe Projekte ein eigenes Kapitel gewidmet. Viel Spaß beim Lesen!
Einleitung „Grünes Licht für „Stuttgart 21"
Der Lenkungskreis des Großprojekts "Stuttgart 21" hat grünes Licht für den Bau des Infrastrukturprojekts gegeben. […] Die Kosten für das Projekt belaufen sich nach der neuen Kalkulation auf 4,1 Milliarden Euro - die bisherige Kalkulation sah Kosten von 3,1 Milliarden Euro vor. Die Mehrkosten…“ So oder so ähnlich liest man fast tagtäglich Nachrichten über Großprojekte, wie auch bei der Einführung der LKW-Maut oder dem Bau der neuen Landebahn des Frankfurter Flughafens. Wenn trotz professionellen Managements die Kosten explodieren und Termine um mehrere Jahre verschoben werden, scheinen Vorbehalte durchaus berechtigt. Daher kann man nachvollziehen, dass einige Auftraggeber und Projektmitglieder ein professionelles Projektmanagement oft für überflüssig oder für zu zeitaufwändig halten. Man muss jedoch beachten, dass Projekte meist in die Wege geleitet werden um auf Veränderungen zu reagieren oder an diesen teilzuhaben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Phasen eines typischen Vorgehensmodells
- Vorphase
- Planungsphase
- Durchführungsphase
- Projektabschluss
- Bedeutung der Phasen in Relation zur Projektkomplexität
- Kritische Betrachtung von Kosten und Nutzen des Projektmanagements
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung untersucht die Bedeutung eines professionellen Projektmanagements in Abhängigkeit von der Projektkomplexität und beleuchtet den Nutzen, den professionelles Projektmanagement für die Projekterreichung bringt.
- Erläuterung der Schritte und Phasen eines typischen Projektmanagements
- Bedeutung der einzelnen Phasen in Relation zur Projektkomplexität
- Kritische Betrachtung von Kosten und Nutzen des Projektmanagements
- Bedeutung des Projektmanagements für die Bewältigung von Projekt-Risiken
- Verdeutlichung der Wichtigkeit eines strukturierten Vorgehensmodells bei der Projektdurchführung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung erläutert die Problematik, dass viele Auftraggeber und Projektmitglieder professionelles Projektmanagement als überflüssig oder zu zeitaufwändig ansehen. Es wird betont, dass Projekte meist in die Wege geleitet werden, um auf Veränderungen zu reagieren oder an diesen teilzuhaben. Das Hauptproblem bei der Planung innovativer Projekte liegt darin, Unvorhersehbares vorherzusehen. Die Einleitung definiert außerdem den Begriff „Projekt“ und „Projektmanagement“ anhand von Standards wie DIN 69901 und ICB IPMA Competence Baseline (ICB).
2. Phasen eines typischen Vorgehensmodells
Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Modelle für die Projektdurchführung, wobei ein Phasenmodell mit den typischen Teilabschnitten eines Projektes im Vordergrund steht. Der Abschnitt definiert den Begriff „Projektphase“ und erläutert die vier Phasen: Vorphase, Planungsphase, Durchführungsphase und Projektabschluss.
2.1 Vorphase
Dieser Abschnitt behandelt die Vorphase als erste Phase des Projektmanagements. Er beleuchtet die Bedeutung der Auftragsklärung, der Festlegung von Zielen (SMART), der Schätzung von Ressourcen und der Organisation des Projektteams. Auch das „magische Dreieck“ des Projektmanagements, das die Abhängigkeit von Zeit, Kosten und Qualität verdeutlicht, wird in diesem Abschnitt eingeführt.
2.2 Planungsphase
Die Planungsphase wird im Detail beschrieben. Dieses Kapitel beleuchtet wichtige Elemente der Planungsphase wie den Projektstrukturplan, den Ressourcen- und Kostenplan, den Ablauf- und Zeitplan, die Risikoanalyse und die Festlegung von Verantwortlichkeiten.
2.3 Durchführungsphase
Dieser Abschnitt behandelt die Durchführungsphase, die sich auf die Umsetzung der Planung konzentriert. Die wichtigen Punkte der Durchführungsphase sind die Kontrolle und Anpassung des Projektplans, die Koordination der Projektmitarbeiter, die Überwachung des Fortschritts und die Bewältigung von Problemen.
2.4 Projektabschluss
Der Projektabschluss wird hier beleuchtet. Die Beendigung des Projekts wird in diesem Kapitel besprochen, einschließlich der Dokumentation der Ergebnisse, der Abnahme des Projekts, der Evaluation des Projekts und der Auflösung der Projektorganisation.
Schlüsselwörter
Projektmanagement, Projektphasen, Projektkomplexität, Kosten, Nutzen, Risiko, Zeit, Qualität, Ressourcen, Stakeholder, Planung, Durchführung, Projektabschluss, DIN 69901, ICB, SMART, „magisches Dreieck“
- Quote paper
- Jens Stieler (Author), 2012, Projektmanagement - Ein typischer Ablauf und Variationen in Abhängigkeit von der Projektkomplexität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196189