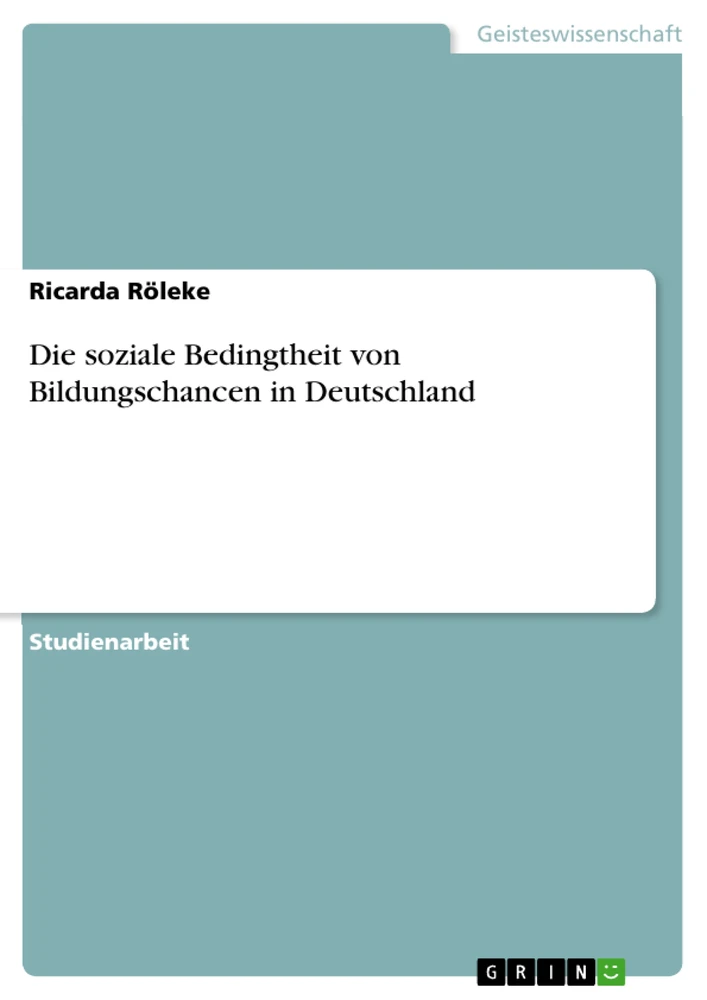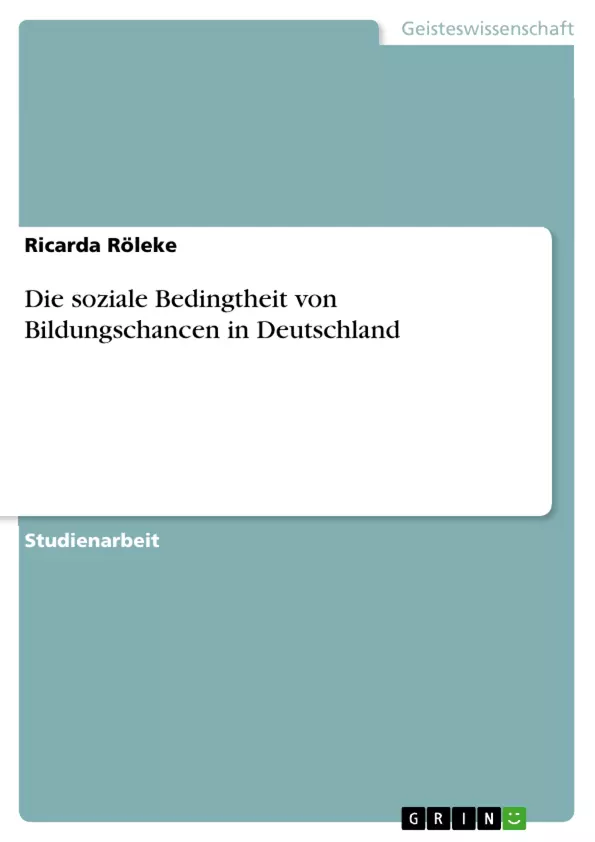Bildung spielt in der modernen Wissensgesellschaft eine immer wichtigere Rolle. Sie ist heute die zentrale Voraussetzung für eine Teilhabe am wirtschaftlichen, politischen und gesell-schaftlichen Leben. Bildung bedeutet dabei jedoch auch immer Auslese. Der vorherrschende Meritokratieansatz rechtfertigt diese mit den unterschiedlichen Begabungen der Schüler. Verschiedenste Untersuchungen dagegen belegen, dass Bildungschancen nicht nur von der kognitiven Leistungsfähigkeit eines Schülers, sondern auch von seiner sozialen Herkunft bestimmt werden. So unterstrich die letzte PISA-Studie, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Bildungserfolg in Deutschland so hoch ist, wie in kaum einem anderen OECD-Land (OECD 2007: 37).
Dass Bildungschancen sozial bedingt sind ist daher heute unumstritten. Über die genauen Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheiten im Bildungsbereich herrscht jedoch Uneinigkeit. Die folgende Arbeit wird versuchen, bestehende Chancenunterschiede im deutschen Bildungssystem anhand der durch Pierre Bourdieu entwickelten Konzepte von Habitus und Kapital zu erklären. Nach einer kurzen Charakterisierung dieser Kernelemente und einer Darstellung ihrer Auswirkungen auf die gesellschaftliche Ordnung, werden dabei zunächst Bourdieus eigene Erkenntnisse zur sozialen Bedingtheit von Bildungschancen näher betrachtet. Im späteren Verlauf soll dann untersucht werden, welchen Einfluss Habitus und familiäre Kapitalressourcen auf die Bildungschancen deutscher Schüler haben. Abschließend wird die Frage zu klären sein, in wie weit das Schulsystem zur Konservierung sozialer Ungleichheiten beiträgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pierre Bourdieu: Soziale Ungleichheit und das Bildungssystem
- Die Theorie sozialer Ungleichheit
- Kapital
- Habitus
- Habitus und Kapital im sozialen Raum
- Die soziale Bedingtheit von Bildungserfolg
- Die soziale Bedingtheit von Bildungschancen in Deutschland
- Die Entwicklung der Bildungschancen in Deutschland
- Die Ursachen bildungsbedingter Chancenungleichheiten
- Auswirkungen familiärer Ressourcen
- Habituell bedingte Einflüsse
- Das deutsche Schulsystem - Kompensator oder Konservator ungleicher Bildungschancen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die soziale Bedingtheit von Bildungschancen in Deutschland anhand der Theorien Pierre Bourdieus. Ziel ist es, die Mechanismen der Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich zu erklären und die Rolle von Habitus und Kapitalressourcen aufzuzeigen.
- Die Theorie sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
- Der Einfluss von Kapitalformen (ökonomisches, soziales, kulturelles) auf Bildungschancen
- Die Rolle des Habitus in der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Die Auswirkungen familiärer Ressourcen auf den Bildungserfolg
- Die Rolle des deutschen Schulsystems bei der Vermittlung oder Konservierung sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz von Bildung in der modernen Wissensgesellschaft dar und beleuchtet die Problematik sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich. Die Arbeit fokussiert sich auf die Erklärung von Chancenunterschieden im deutschen Bildungssystem durch Pierre Bourdieus Theorie von Habitus und Kapital.
- Pierre Bourdieu: Soziale Ungleichheit und das Bildungssystem: Dieses Kapitel erläutert Bourdieus Theorie sozialer Ungleichheit, die auf den Konzepten von Kapital und Habitus basiert. Es werden die verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, soziales, kulturelles) und ihre Bedeutung für die soziale Positionierung von Individuen vorgestellt. Der Habitus wird als inkorporierte Sozialstruktur beschrieben, die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata prägt und den Rahmen des sozial Möglichen vorgibt.
- Die soziale Bedingtheit von Bildungschancen in Deutschland: Das Kapitel untersucht die Entwicklung von Bildungschancen in Deutschland und die Ursachen für bildungsbedingte Chancenungleichheiten. Es werden insbesondere die Auswirkungen familiärer Ressourcen und die Bedeutung des Habitus für die Bildungskarriere von Schülern betrachtet.
- Das deutsche Schulsystem - Kompensator oder Konservator ungleicher Bildungschancen?: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des deutschen Schulsystems in Bezug auf die Reproduktion oder Kompensation sozialer Ungleichheit. Es wird untersucht, inwieweit das Schulsystem zur Bewältigung der Herausforderungen sozialer Ungleichheit im Bildungsbereich beitragen kann.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildung, Bildungschancen, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapital, Kapitalformen, ökonomisches Kapital, soziales Kapital, kulturelles Kapital, Reproduktion sozialer Ungleichheit, familiäre Ressourcen, deutsches Schulsystem, Kompensation, Konservierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen soziale Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland zusammen?
Untersuchungen wie die PISA-Studie belegen, dass der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Bildungserfolg in Deutschland besonders hoch ist.
Was bedeuten die Begriffe „Habitus“ und „Kapital“ nach Pierre Bourdieu?
Habitus beschreibt verinnerlichte Denk- und Handlungsmuster. Kapital umfasst ökonomische Mittel, soziale Netze und kulturelle Bildung (z.B. Bücher, Wissen).
Welche Kapitalformen beeinflussen die Bildungschancen?
Bourdieu unterscheidet ökonomisches Kapital (Geld), soziales Kapital (Beziehungen) und kulturelles Kapital (Bildungsabschlüsse, kulturelle Güter).
Fungiert das deutsche Schulsystem als Kompensator oder Konservator?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die Schule soziale Ungleichheiten ausgleicht oder sie durch die Bevorzugung bestimmter Habitus-Formen eher konserviert.
Was ist der Meritokratieansatz?
Das Prinzip, nach dem Erfolg allein auf individueller Begabung und Leistung basieren sollte, was durch die soziale Bedingtheit der Bildung jedoch oft infrage gestellt wird.
Wie beeinflussen familiäre Ressourcen die Bildungskarriere?
Familiäre Ressourcen prägen den Habitus eines Kindes und bestimmen den Zugang zu kulturellem Kapital, was den Erfolg im Bildungssystem maßgeblich vorzeichnet.
- Citar trabajo
- MSc Ricarda Röleke (Autor), 2008, Die soziale Bedingtheit von Bildungschancen in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196289