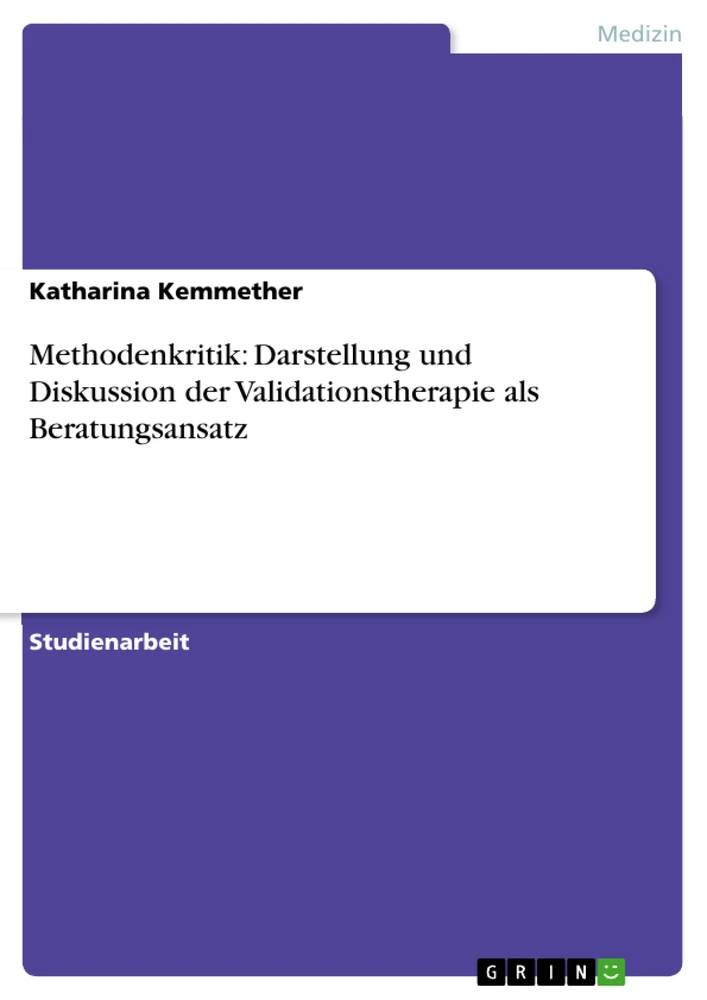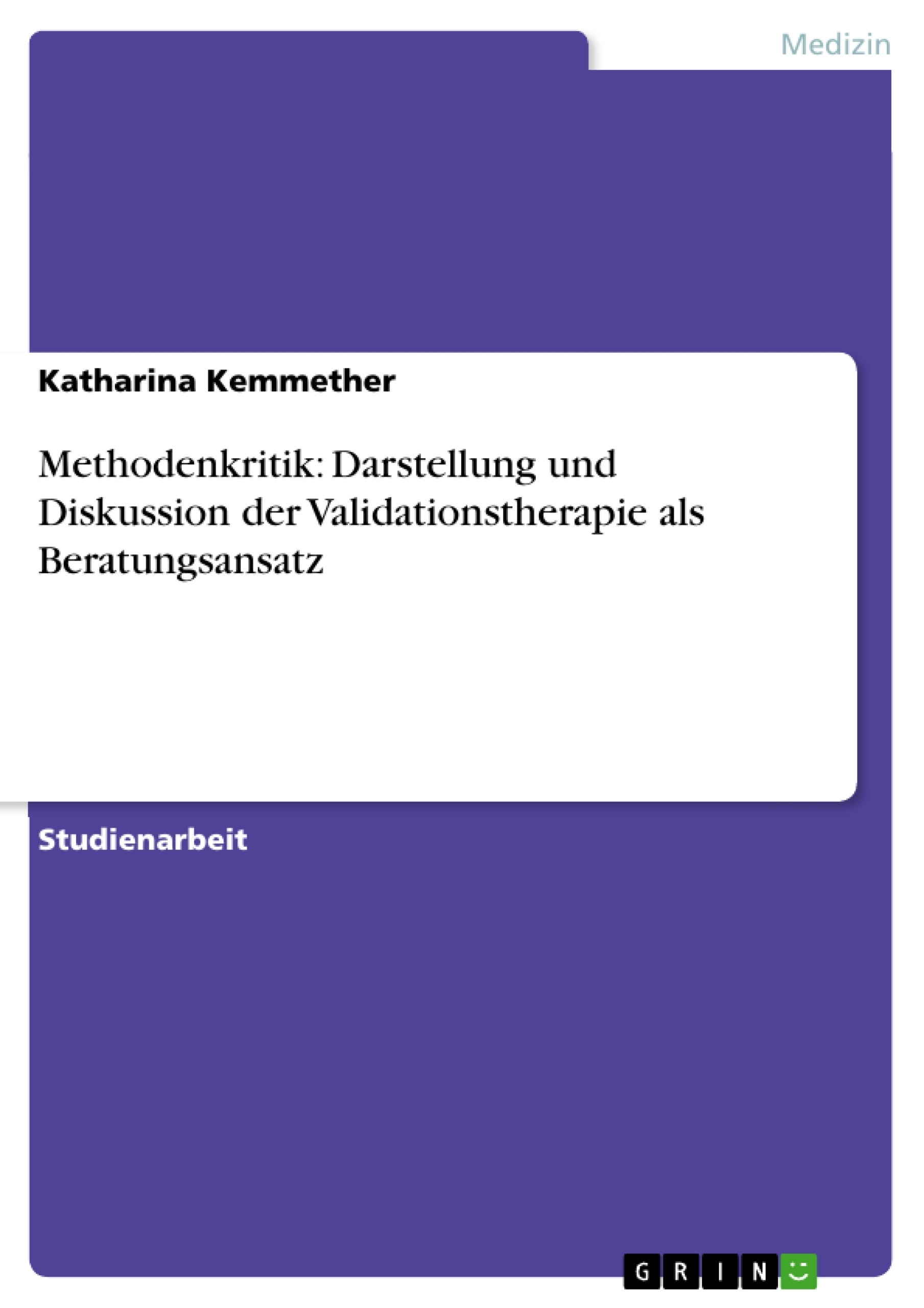Die Validationstherapie ist eine Technik, um sehr alten desorientierten Menschen mit Respekt zu begegnen und als Individuum wahrzunehmen. Im Fokus stehen hierbei „…the emotionals and psychological consequences of short-term memory loss” (MORTON, BLEATHMAN 1991, 327).
Mittels verinnerlichter Grundprinzipien und durch die Anwendung verschiedener Techniken und Methoden versucht der Validationsanwender Menschen mit Demenz im letzten Abschnitt ihres Lebens zu unterstützen und mit ihnen zu kommunizieren (vgl. KLERK-RUBIN 2006, 9).
Aufgrund weniger Studien mit geringen Fallzahlen kann der therapeutische Effekt der Validationstherapie nicht eindeutig belegt werden, weitere Forschung auf diesem Gebiet ist erforderlich (vgl. NOCON u.a. 2010, 188). „Fehlende Evidenz bedeutet in diesem Kontext jedoch nicht zwingend fehlende Wirksamkeit“ (RIECKMANN u.a. 2008, 4).
Ungeachtet der fehlenden wissenschaftlichen Absicherung findet das Konzept der Validation vor allem bei Pflegenden im Altenpflegesektor in Deutschland großen Anklang (vgl. GERSTER 1996, 172). Mittels der Validation sollen hier „…Frustration im Arbeitsalltag vermindert und sogar Burnout-Gefühle verhindert werden (VOGEL 2008, 27). Das von FEIL vermittelte Menschenbild, das den Menschen als das akzeptiert, was er ist und die über Validation konkret gebotenen Hilfestellungen im Umgang mit verwirrten alten Menschen kann im Pflegealltag die allmähliche Verschlechterung der Betroffenen verlangsamen helfen. Die Validationstherapie wird jedoch in diesem Kontext nicht als ein Beratungskonzept in der pflegerischen Praxis angesehen. Sie dient hier in erster Linie als eine Methode, um den psychischen und körperlichen Zustand der Hochbetagten zu verbessern wie z.B. durch Reduktion von Stressreaktionen oder Verbesserung des Gehvermögens (vgl. VOGEL 2008, 27). Betrachtet man die Validationstherapie als Beratungsansatz, ließe sich diese mit gewissen Einschränkungen auch als eine Möglichkeit zur Beratung von dementiellen Menschen nutzen. Bei der Diskussion der Validationstherapie als ein Beratungsansatz zeigt sich, dass einige Merkmale von Beratung durchaus auch auf die Validation zutreffen. Derzeit wird die Validationstherapie jedoch noch nicht im Kontext pflegerischer Beratung angewendet. Sie könnte aber für die pflegerische Beratung durchaus Impulse geben, die auch im Rahmen wissenschaftlicher Begleitforschung untersucht werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Zielgruppe der Validationstherapie
- 3. Grundprinzipien der Validationstherapie
- 4. Theorien als Grundlage der Grundprinzipien
- 5. Vier Phasen im Stadium der Aufarbeitung
- 5.1 Phase I – „Mangelhafte Orientierung (orientiert, aber unglücklich)
- 5.2 Phase II – „Zeitverwirrtheit“
- 5.3 Phase III – „sich wiederholende Bewegungen - sie ersetzen die Sprache“
- 5.4 Phase VI – „Vegetieren – totaler Rückzug nach innen“
- 6. Anwendung der Validation
- 7. Diskussion der Validationstherapie als Beratungsansatz
- 8. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit stellt die Validationstherapie als Beratungsansatz vor und diskutiert deren methodische Grundlagen. Ziel ist es, die Prinzipien der Validationstherapie zu erläutern, deren Zielgruppe zu definieren und kritisch zu hinterfragen.
- Die Entwicklung und die theoretischen Grundlagen der Validationstherapie
- Die Zielgruppe der Validationstherapie und die Ursachen der Desorientierung
- Die Grundprinzipien und Phasen der Validationstherapie
- Anwendung der Validationstherapie in der Praxis
- Kritische Diskussion der Validationstherapie als Beratungsansatz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beschreibt die Entstehung der Validationstherapie durch Naomi Feil, ihre Erfahrungen im Montefiore-Altersheim und den Kontrast zur damals üblichen Realitätsorientierungstherapie (ROT). Feil erkannte, dass die Fokussierung auf die objektive Realität bei desorientierten älteren Menschen nicht zielführend war und stattdessen die subjektive Erlebniswelt im Vordergrund stehen sollte. Die Validationstherapie als einfühlsamer Ansatz, der die Würde des Betroffenen achtet und seine emotionale Realität wertschätzt, wird als Gegenmodell zur ROT positioniert. Der Bezug zu personenzentrierten Ansätzen in der Psychologie wird hergestellt.
2. Zielgruppe der Validationstherapie: Dieses Kapitel definiert die Zielgruppe der Validationstherapie als desorientierte, hochbetagte Menschen, die ein sinnvolles Leben geführt haben und nun mit vielfältigen Verlusten konfrontiert sind. Feil's psychodynamische Sichtweise wird erläutert, die Desorientierung als Bewältigungsstrategie im Umgang mit unerträglichen Verlusten und Regression zu früheren Entwicklungsphasen interpretiert. Die verschiedenen Arten von Verlusten (körperlich, psychisch, sozial) werden kategorisiert, und die Bedeutung des individuellen Verhaltensrepertoires für die Bewältigung im Alter wird hervorgehoben.
3. Grundprinzipien der Validationstherapie: Hier werden die Grundprinzipien der Validationstherapie, primär aus Feil's praktischer Erfahrung entstanden, als Empathie, Wärme und Achtung beschrieben. Die Suche nach einer theoretischen Fundierung nachträglich wird erwähnt, wobei der Bezug zu humanistischen und psychoanalytischen Theorien hergestellt wird. Die Betonung liegt auf der einfühlsamen Begegnung mit dem desorientierten Menschen und dem Verständnis seiner subjektiven Realität.
Schlüsselwörter
Validationstherapie, Naomi Feil, Desorientierung, Demenz, Alter, Verlust, Bewältigungsstrategie, Empathie, Personzentrierter Ansatz, Realitätsorientierungstherapie (ROT), subjektive Realität, Würde.
Häufig gestellte Fragen zur Validationstherapie
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Validationstherapie. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der Prinzipien, der Zielgruppe und einer kritischen Auseinandersetzung mit der Validationstherapie als Beratungsansatz.
Wer ist die Zielgruppe der Validationstherapie?
Die Zielgruppe der Validationstherapie sind desorientierte, hochbetagte Menschen, die ein sinnvolles Leben geführt haben und nun mit vielfältigen Verlusten (körperlich, psychisch, sozial) konfrontiert sind. Desorientierung wird dabei als Bewältigungsstrategie im Umgang mit unerträglichen Verlusten und Regression zu früheren Entwicklungsphasen interpretiert.
Was sind die Grundprinzipien der Validationstherapie?
Die Grundprinzipien der Validationstherapie sind Empathie, Wärme und Achtung. Der Ansatz konzentriert sich auf die einfühlsame Begegnung mit dem desorientierten Menschen und das Verständnis seiner subjektiven Realität, anstatt auf die objektive Realität, wie es beispielsweise bei der Realitätsorientierungstherapie (ROT) der Fall ist.
Welche Phasen beinhaltet die Aufarbeitung in der Validationstherapie?
Die Aufarbeitung gliedert sich in vier Phasen: Phase I (Mangelhafte Orientierung), Phase II (Zeitverwirrtheit), Phase III (sich wiederholende Bewegungen als Ersatz für Sprache) und Phase IV (Vegetieren – totaler Rückzug nach innen).
Wie unterscheidet sich die Validationstherapie von der Realitätsorientierungstherapie (ROT)?
Im Gegensatz zur ROT, die sich auf die objektive Realität konzentriert, rückt die Validationstherapie die subjektive Erlebniswelt des desorientierten Menschen in den Vordergrund. Sie achtet auf die Würde des Betroffenen und wertschätzt seine emotionale Realität.
Welche theoretischen Grundlagen liegen der Validationstherapie zugrunde?
Die Validationstherapie basiert primär auf der praktischen Erfahrung von Naomi Feil. Nachträglich wurde versucht, eine theoretische Fundierung zu finden, wobei Bezüge zu humanistischen und psychoanalytischen Theorien hergestellt werden.
Wer hat die Validationstherapie entwickelt?
Die Validationstherapie wurde von Naomi Feil entwickelt, basierend auf ihren Erfahrungen im Montefiore-Altersheim.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Validationstherapie?
Schlüsselwörter sind: Validationstherapie, Naomi Feil, Desorientierung, Demenz, Alter, Verlust, Bewältigungsstrategie, Empathie, Personzentrierter Ansatz, Realitätsorientierungstherapie (ROT), subjektive Realität, Würde.
Wo finde ich weitere Informationen zur Validationstherapie?
Weitere Informationen finden sich in der wissenschaftlichen Literatur zur Gerontologie und Geriatrie sowie in Fachbüchern zur Validationstherapie.
- Quote paper
- Diplom-Pflegewirt FH Katharina Kemmether (Author), 2012, Methodenkritik: Darstellung und Diskussion der Validationstherapie als Beratungsansatz , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196607