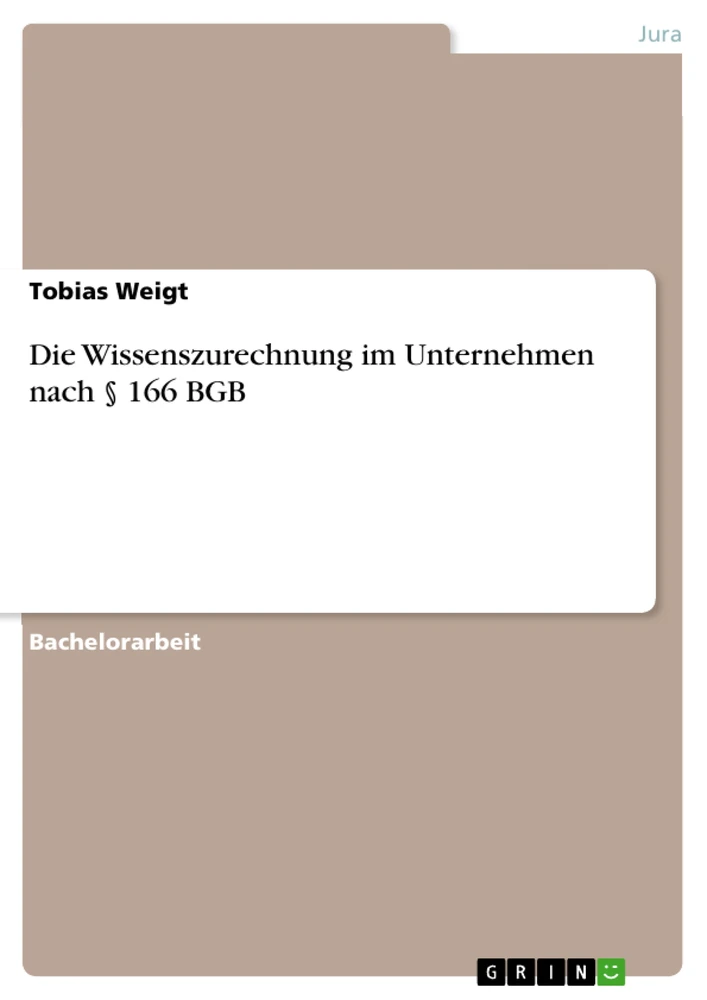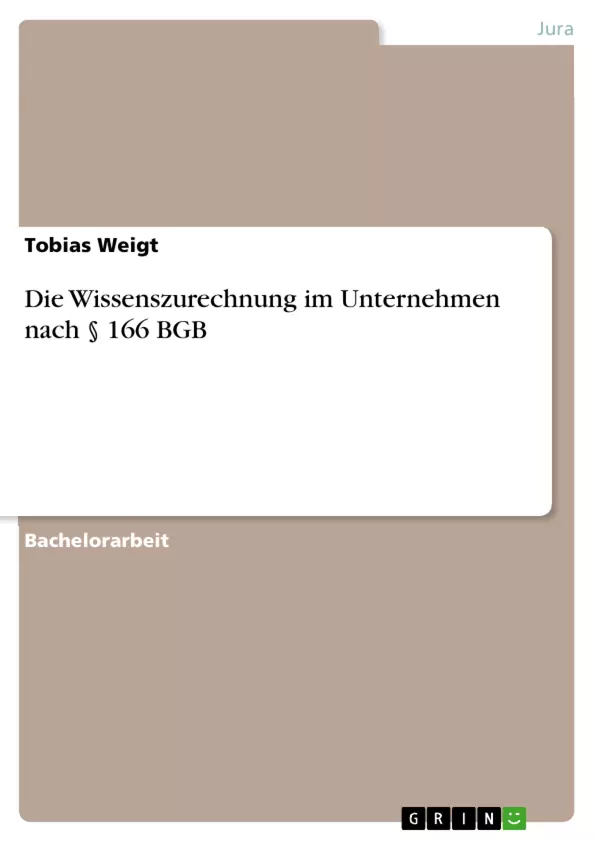Diese Arbeit befasst sich mit der Zurechenbarkeit von Wissen innerhalb von privatwirtschaftlichen Rechtsgebilden (Unternehmen). Der Schwerpunkt liegt vor allem auf der Fragestellung, in wieweit die im Rechtsverkehr erlangten Kenntnisse von natürlichen Personen, einer juristischen Person zuzuordnen sind, für die, die betreffende natürliche Person tätig ist. Auf einer nachfolgenden Ebene wird auch die Frage behandelt, ob das Wissen, welches hierdurch erlangt wurde, wiederum im gegenseitigen Verhältnis von Unternehmen untereinander zuzurechnen ist.
Es geht somit um –„Wissensverlagerungen“-, die als ein typisches Merkmal der heutigen arbeitsteiligen Gesellschaft anzusehen sind. In der Literatur wird die Wissenszurechnung weitläufig als nicht hinreichend durch den Gesetzgeber geregelt betrachtet, weshalb Rechtsprechung und Literatur versuchen, einheitliche Maßstäbe zur Behandlung dieses Themenkomplexes zu entwickeln und einheitliche Lösungsansätze für die vielfältigen Konstellationen zu liefern.
In dieser Arbeit werden zunächst die rechtlichen Grundlagen der Wissenszurechnung erläutert. Im deutschen Recht gibt es zahlreiche „Wissensnormen“ ,die sich nahezu über alle Rechtsgebiete erstrecken. Sie bilden die Grundlage für eine Wissenszurechnung. Die einzelnen Normen sehen jedoch keinen einheitlichen Maßstab für eine Zurechnung von Wissen vor. Vielmehr differieren die Voraussetzungen für die Zurechenbarkeit von Anwendungsgebiet zu Anwendungsgebiet. Dies ist vor allem mit den unterschiedlichen Schutzfunktionen der Wissensnormen zu begründen, die in erster Linie auf das Vertrauen des Rechtsverkehrspartners des jeweiligen Wissenden gerichtet sind.
Im Hauptteil geht es zunächst einmal um die einzelnen in Frage kommenden Wissensträger, von denen das Wissen im Zuge der Wissenszurechnung auf eine andere Person, aber vor allem auf eine juristische Person, zurechenbar ist. Auch die mögliche Zurechnung von Wissen zwischen Unternehmen, die in einem Konzernverhältnis zueinander stehen wird behandelt. Hierbei wird erkennbar, dass die unterschiedlichen möglichen Konstellationen, unterschiedliche Voraussetzungen der Zurechenbarkeit ergeben.
Hieran anschließend soll auf einzelne, ausgesuchte Rechtsfelder eingegangen werden, wobei auf die Perspektive desjenigen eingegangen wird bei dem das Wissen, das Wissenmüssen bzw. die einschlägigen Wissensteile für die Erfüllung der Voraussetzungen einer Zurechnung vorliegen oder nicht vorliegen.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlagen der Wissenszurechnung
- Einführung in die Problematik
- Der Begriff des Wissens und der Kenntnis
- Die Wissensnormen
- § 166 BGB als zentrale Zurechnungsnorm für Wissen
- Abgrenzung zur Verhaltenszurechnung
- Abgrenzung zur Erklärungszurechnung
- Wissenmüssen und das Wissen der Organisation
- Die Wissenszusammenrechnung
- Der Wissensvertreter
- Zusammenhang der Anwendung bei Unternehmen
- Wissensträger
- Das Organmitglied
- Das ausgeschiedene Organmitglied
- Der Gesellschafter und der Geschäftsführer
- Der Mitarbeiter
- Die im Unternehmen beschäftigte Privatperson
- Die externe Hilfsperson
- Das im Konzern verbundene Unternehmen
- Anwendungsfelder aus Perspektive des Wissenden
- Sachkauf
- Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensteilen
- Eingehung vorvertraglicher Schuldverhältnisse
- Anlageberatung und Finanzprodukte
- Versicherungsdienstleistungen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zurechnung von Wissen innerhalb von Unternehmen im Kontext des § 166 BGB. Die zentrale Fragestellung betrifft die Zuordnung von Wissen natürlicher Personen zu juristischen Personen, für die diese tätig sind, sowie die wechselseitige Zurechnung von Wissen zwischen Unternehmen. Die Arbeit analysiert die Wissensverlagerungen in arbeitsteiligen Gesellschaften und beleuchtet die bestehenden Lücken in der gesetzlichen Regelung der Wissenszurechnung.
- Die rechtlichen Grundlagen der Wissenszurechnung im deutschen Recht.
- Die verschiedenen Wissensnormen und deren unterschiedliche Schutzfunktionen.
- Die Zurechnung von Wissen im Verhältnis zwischen natürlichen und juristischen Personen.
- Die Zurechnung von Wissen zwischen verschiedenen Unternehmen.
- Anwendung der Wissenszurechnung in verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts.
Zusammenfassung der Kapitel
Grundlagen der Wissenszurechnung: Dieses Kapitel legt die rechtlichen Grundlagen der Wissenszurechnung dar. Es behandelt die Problematik der Zuordnung von Wissen in Unternehmen und die unzureichende gesetzliche Regelung im deutschen Recht. Es werden unterschiedliche Wissensnormen erläutert, die sich über alle Rechtsgebiete erstrecken, jedoch keine einheitlichen Maßstäbe für die Zurechnung von Wissen bieten. Die unterschiedlichen Schutzfunktionen dieser Normen, die primär auf das Vertrauen des Vertragspartners abzielen, werden ebenfalls beleuchtet. Die Arbeit analysiert den § 166 BGB als zentrale Zurechnungsnorm und grenzt ihn von der Verhaltens- und Erklärungszurechnung ab.
Wissensträger: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Wissensträger innerhalb eines Unternehmens und deren Rolle bei der Wissenszurechnung. Er beleuchtet die Verantwortlichkeiten von Organmitgliedern (einschließlich ausgeschiedener Mitglieder), Gesellschaftern, Geschäftsführern, Mitarbeitern, externen Hilfspersonen und konzernverbundenen Unternehmen. Der Fokus liegt darauf, wie das Wissen dieser verschiedenen Akteure dem Unternehmen zugerechnet werden kann und welche spezifischen Herausforderungen sich in den jeweiligen Konstellationen ergeben. Die Kapitel erörtert die rechtlichen Konsequenzen der Wissenszuordnung für die verschiedenen Akteure.
Anwendungsfelder aus Perspektive des Wissenden: In diesem Kapitel werden verschiedene Anwendungsfelder der Wissenszurechnung aus der Perspektive des Wissenden betrachtet. Konkret werden Sachkäufe, die Veräußerung von Unternehmensteilen, vorvertragliche Schuldverhältnisse, Anlageberatung und Versicherungsdienstleistungen analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung, wie Wissen in diesen verschiedenen Kontexten eine Rolle spielt und welche rechtlichen Implikationen sich daraus ergeben. Es wird analysiert, wie das Wissen des Einzelnen die rechtliche Beurteilung und die Haftung in den verschiedenen Szenarien beeinflusst.
Schlüsselwörter
Wissenszurechnung, § 166 BGB, Unternehmen, Wissensträger, Organmitglied, Gesellschafter, Geschäftsführer, Mitarbeiter, externe Hilfsperson, Konzern, Sachkauf, Veräußerung, vorvertragliche Schuldverhältnisse, Anlageberatung, Versicherungsdienstleistungen, Rechtsprechung, Literatur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wissenszurechnung im Unternehmenskontext
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Zurechnung von Wissen innerhalb von Unternehmen, insbesondere im Kontext des § 166 BGB. Der Fokus liegt auf der Zuordnung von Wissen natürlicher Personen zu juristischen Personen und der wechselseitigen Zurechnung von Wissen zwischen Unternehmen. Es werden die Wissensverlagerungen in arbeitsteiligen Gesellschaften analysiert und bestehende Lücken in der gesetzlichen Regelung beleuchtet.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Wissenszurechnung im deutschen Recht, mit besonderem Schwerpunkt auf § 166 BGB. Es werden verschiedene Wissensnormen und deren unterschiedliche Schutzfunktionen erläutert, sowie die Abgrenzung zur Verhaltens- und Erklärungszurechnung. Die Arbeit analysiert die Anwendung dieser Normen in verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts.
Welche Arten von Wissensträgern werden untersucht?
Die Arbeit untersucht eine Vielzahl von Wissensträgern, darunter Organmitglieder (einschließlich ausgeschiedener Mitglieder), Gesellschafter, Geschäftsführer, Mitarbeiter, externe Hilfspersonen und konzernverbundene Unternehmen. Es wird analysiert, wie deren Wissen dem Unternehmen zugerechnet werden kann und welche Herausforderungen sich in den jeweiligen Konstellationen ergeben.
Welche Anwendungsfelder der Wissenszurechnung werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Anwendungsfelder aus der Perspektive des Wissenden, beispielsweise Sachkäufe, die Veräußerung von Unternehmensteilen, vorvertragliche Schuldverhältnisse, Anlageberatung und Versicherungsdienstleistungen. Es wird untersucht, wie Wissen in diesen Kontexten die rechtliche Beurteilung und Haftung beeinflusst.
Welche zentralen Fragestellungen werden bearbeitet?
Die zentrale Fragestellung betrifft die Zuordnung von Wissen natürlicher Personen zu juristischen Personen, für die diese tätig sind, sowie die wechselseitige Zurechnung von Wissen zwischen Unternehmen. Die Arbeit beleuchtet die unzureichende gesetzliche Regelung der Wissenszurechnung im deutschen Recht und die daraus resultierenden Herausforderungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Wissenszurechnung, § 166 BGB, Unternehmen, Wissensträger, Organmitglied, Gesellschafter, Geschäftsführer, Mitarbeiter, externe Hilfsperson, Konzern, Sachkauf, Veräußerung, vorvertragliche Schuldverhältnisse, Anlageberatung, Versicherungsdienstleistungen, Rechtsprechung, Literatur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu den Grundlagen der Wissenszurechnung, den verschiedenen Wissensträgern und den Anwendungsfeldern aus der Perspektive des Wissenden. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der Wissenszurechnung und deren rechtliche Implikationen.
- Citar trabajo
- Tobias Weigt (Autor), 2012, Die Wissenszurechnung im Unternehmen nach § 166 BGB, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197285