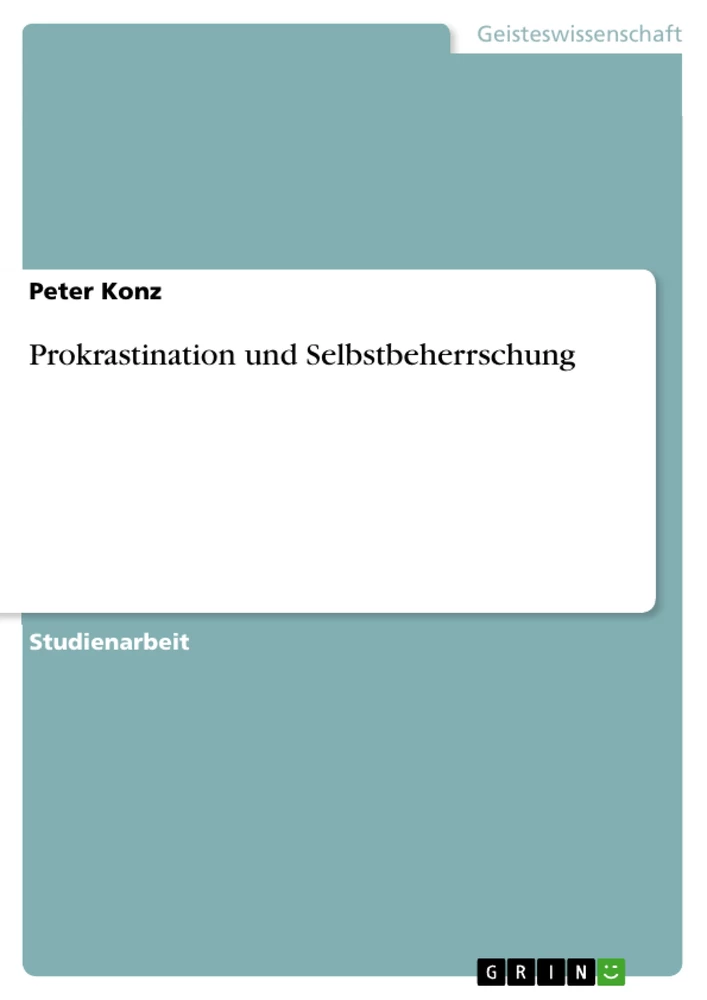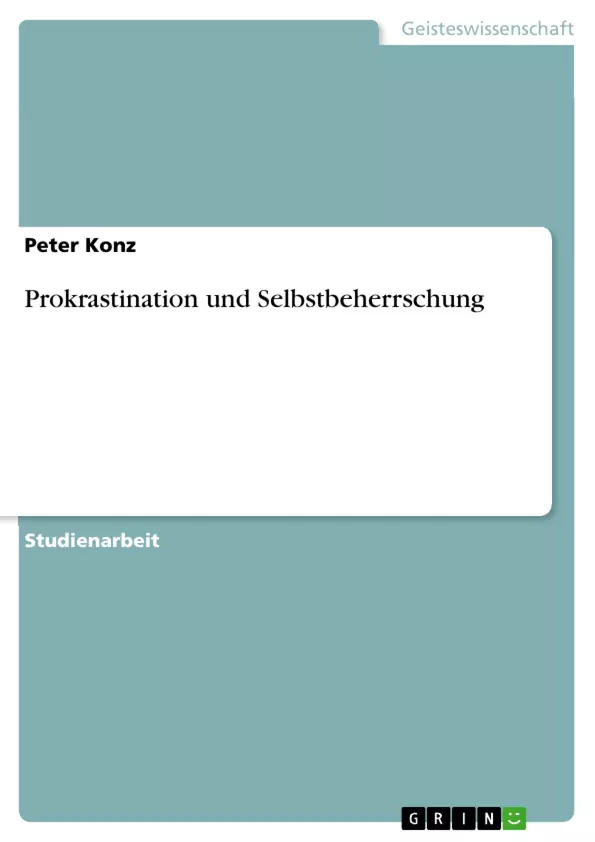Die Hausarbeit schreiben oder doch lieber an den See? Sonntagabends noch einmal den Vorlesungsstoff der letzten Woche wiederholen oder einfach nur einen guten Film im Fernsehen ansehen? Jeder kennt den inneren Zwiespalt, der sich auftut, wenn wir eigentlich eine unangenehme Sache erledigen müssten aber vielmehr den aktuellen Augenblick genießen möchten. Ein Großteil der Menschen umgeht diesen temporären Aufwand indem sie Dinge, die ihnen widerstreben, auf spätere Zeitpunkte aufschieben. Dieses Verhalten wird in der Fachsprache auch als Prokrastination bezeichnet. Eng damit verbunden ist die individuelle Fähigkeit, Selbstdisziplin zu üben und sich trotz kurzfristiger Anstrengungen immer seine langfristigen Ziele und Werte vor Augen zu halten. So konnte nachgewiesen werden, dass sich eine schon im Kindesalter ausgeprägte Selbstbeherrschung positiv auf die spätere Gesundheit oder den Erfolg der Menschen auswirken kann.1 Gerade die Zielgruppe der Studierenden ist sicherlich besonders von der umgangssprachlich „Aufschieberitis“ genannten Verhaltensweise betroffen. Jedoch stellt Prokrastination ein ernstzunehmendes Problem für einen nicht geringen Teil der Bevölkerung dar und bedarf oft auch professioneller Hilfe.2 In dieser Arbeit soll vorwiegend durch Analyse verschiedener Versuche gezeigt werden, dass sich die meisten Menschen durchaus über ihre „prokastinierenden“ Charakterzüge im Klaren sind. Anhand einiger Beispiele wird beschrieben, wie Menschen dieser Nachlässigkeit durch verschiedene Maßnahmen zur Selbstkontrolle versuchen entgegenzuwirken.
Im ersten Teil der Arbeit wird auf die Bereitschaft der Probanden, sich selbst in ihren Handlungsweisen einzuschränken, eingegangen. Es wird klar, dass sie sich zwar Richtlinien setzen, dies aber nicht in optimaler Art und Weise tun. Aus weiteren Versuchen geht hervor, dass Selbstbeherrschung als eine Funktion von der Gestalt einer umgedrehten U-Funktion in Abhängigkeit der kurzfristigen Kosten einer Tätigkeit aufgefasst werden kann.
In dem darauffolgenden Kapitel werden die Beobachtungen aus der Praxis in einem theoretischen Modell festgehalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Problem des Aufschiebens - Experimentelle Untersuchungen
- 2.1 Bereitschaft zur Selbstkontrolle und Effizienz
- 2.1.1 Die Versuchsanordnung
- 2.1.2 Ergebnisse und Diskussion
- 2.2 Bestrafung und Belohnung als Selbstkontrollmechanismen
- 2.2.1 Die Versuchsanordnung
- 2.2.2 Ergebnisse und Diskussion
- 2.3 Wertschätzung und emotionale Bindung
- 2.3.1 Die Versuchsanordnung
- 2.3.2 Ergebnisse und Diskussion
- 3. Prokrastination am Beispiel eines theoretischen Modells
- 4. Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Prokrastination, insbesondere im Kontext von Selbstkontrolle und der Fähigkeit, langfristige Ziele trotz kurzfristiger Versuchungen zu verfolgen. Es wird analysiert, wie Menschen mit dem Aufschieben von Aufgaben umgehen und welche Strategien sie zur Selbstkontrolle einsetzen. Die Arbeit basiert auf der Auswertung experimenteller Untersuchungen.
- Selbstkontrolle und Effizienz bei der Bewältigung von Aufgaben
- Die Rolle von Belohnung und Bestrafung als Selbstkontrollmechanismen
- Der Einfluss von Wertschätzung und emotionaler Bindung auf das Aufschieben von Aufgaben
- Modellierung von Prokrastination anhand eines theoretischen Ansatzes
- Analyse der Bereitschaft zur Selbstbeschränkung bei Prokrastination
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Prokrastination ein und beschreibt den alltäglichen Konflikt zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristigen Zielen. Sie betont die Relevanz des Themas, insbesondere für Studierende, und kündigt die Analyse experimenteller Untersuchungen an, die zeigen sollen, dass sich viele Menschen ihrer prokrastinierenden Tendenzen bewusst sind und Strategien zur Selbstkontrolle anwenden.
2. Das Problem des Aufschiebens - Experimentelle Untersuchungen: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse experimenteller Studien zum Thema Prokrastination. Es analysiert die Bereitschaft zur Selbstkontrolle und Effizienz, indem es ein Experiment am MIT beschreibt, bei dem Teilnehmer die Abgabetermine für Hausarbeiten selbst festlegen konnten. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer ihre Abgabetermine nicht optimal setzen, obwohl ihnen die Konsequenzen von Verspätungen bekannt waren. Weitere Unterkapitel befassen sich mit der Wirkung von Belohnung und Bestrafung sowie dem Einfluss von Wertschätzung und emotionaler Bindung auf das Aufschieben von Aufgaben. Die Studien liefern wichtige Einblicke in die Mechanismen der Prokrastination und die Strategien zur Selbstkontrolle.
Schlüsselwörter
Prokrastination, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Experimentelle Untersuchungen, Belohnung, Bestrafung, Wertschätzung, Emotionale Bindung, Theoretisches Modell, Effizienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Experimentelle Untersuchungen zur Prokrastination
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen der Prokrastination, insbesondere im Kontext von Selbstkontrolle und der Fähigkeit, langfristige Ziele trotz kurzfristiger Versuchungen zu verfolgen. Analysiert wird, wie Menschen mit dem Aufschieben von Aufgaben umgehen und welche Strategien sie zur Selbstkontrolle einsetzen. Die Arbeit basiert auf der Auswertung experimenteller Untersuchungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Selbstkontrolle und Effizienz bei der Bewältigung von Aufgaben; die Rolle von Belohnung und Bestrafung als Selbstkontrollmechanismen; der Einfluss von Wertschätzung und emotionaler Bindung auf das Aufschieben von Aufgaben; Modellierung von Prokrastination anhand eines theoretischen Ansatzes; und die Analyse der Bereitschaft zur Selbstbeschränkung bei Prokrastination.
Welche experimentellen Untersuchungen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse experimenteller Studien, die die Bereitschaft zur Selbstkontrolle und Effizienz analysieren. Ein Beispiel ist ein Experiment, bei dem Teilnehmer die Abgabetermine für Hausarbeiten selbst festlegen konnten. Weitere Experimente befassen sich mit der Wirkung von Belohnung und Bestrafung sowie dem Einfluss von Wertschätzung und emotionaler Bindung auf das Aufschieben von Aufgaben.
Welche Ergebnisse liefern die Experimente?
Die Experimente zeigen, dass Teilnehmer ihre Abgabetermine oft nicht optimal setzen, obwohl ihnen die Konsequenzen von Verspätungen bekannt waren. Die Studien liefern wichtige Einblicke in die Mechanismen der Prokrastination und die Strategien zur Selbstkontrolle.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu experimentellen Untersuchungen zur Prokrastination (mit Unterkapiteln zu Selbstkontrolle, Belohnung/Bestrafung und Wertschätzung/emotionaler Bindung), ein Kapitel zur Modellierung von Prokrastination anhand eines theoretischen Modells und abschließende Schlussbemerkungen. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prokrastination, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Experimentelle Untersuchungen, Belohnung, Bestrafung, Wertschätzung, Emotionale Bindung, Theoretisches Modell, Effizienz.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Die Arbeit ist insbesondere für Studierende relevant, da sie sich mit dem alltäglichen Konflikt zwischen kurzfristiger Befriedigung und langfristigen Zielen auseinandersetzt.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Experimenten?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Experimenten, inklusive der Versuchsanordnungen und der Diskussion der Ergebnisse, befinden sich im Kapitel "Das Problem des Aufschiebens - Experimentelle Untersuchungen" und seinen Unterkapiteln.
- Citation du texte
- Bachelor of Science Peter Konz (Auteur), 2012, Prokrastination und Selbstbeherrschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197596