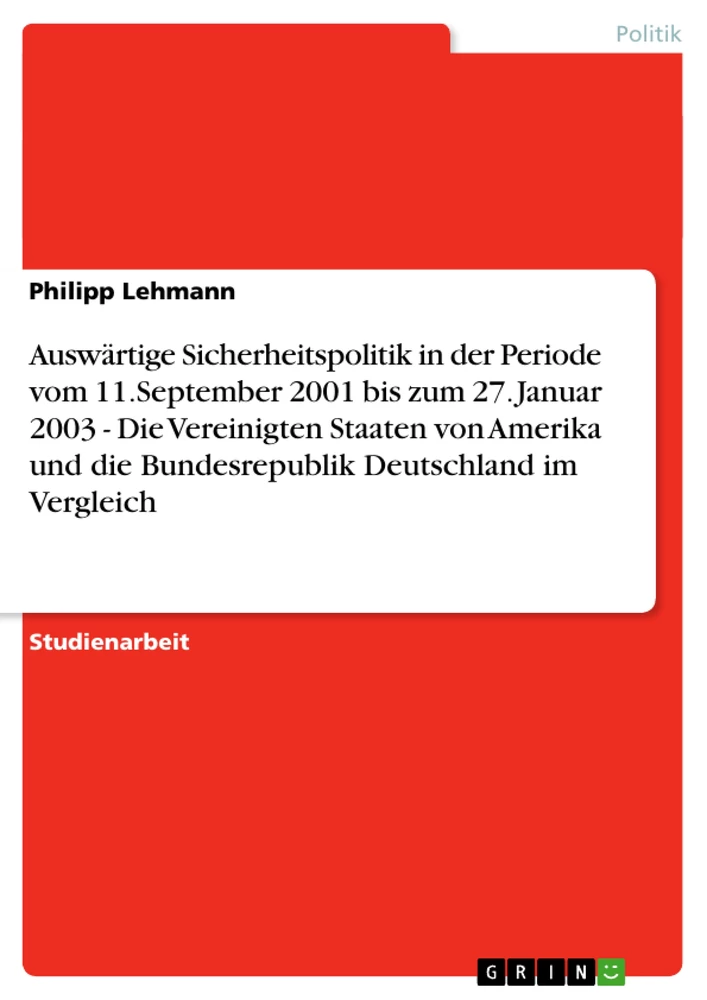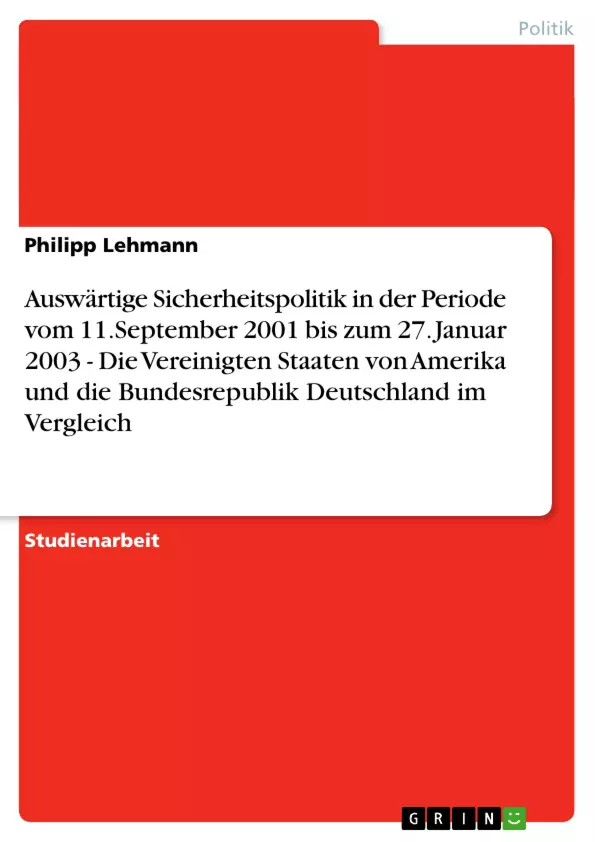Das Ende des Ost-West-Konfliktes repräsentiert eine drastische Wende in der
Ausgestaltung der internationalen Strukturen. Doch noch bevor eine Neue Weltordnung
deutliche Konturen annehmen kann, sieht sich die Welt am 11.September 2001 mit
einer erneuten historischen Zäsur konfrontiert. In der Folgezeit wird schnell offenbar,
dass die Staaten jenseits und diesseits des Atlantiks den neuen Herausforderungen mit
teils sehr unterschiedlichen Rezepten begegnen. Die vorliegende Arbeit vergleicht
exemplarisch die Entwicklung auswärtiger Sicherheitspolitik in den Vereinigten Staaten
und in der Bundesrepublik Deutschland. Den Zeitrahmen der Analyse bildet die Periode
vom 11.September 2001 bis zum 27.Januar 2003, dem Termin, an dem der Chef der
UN-Waffeninspektoren Hans Blix dem UN-Sicherheitsrat den Kontrollbericht über das
irakische Rüstungsniveau vorstellt.
Orientiert an einem chronologischen Gerüst, wird die untersuchte Phase
schwerpunktmäßig in drei Themenkomplexe untergliedert:
Das erste Kapitel skizziert die Entwicklungen vom 11.September 2001 bis zum
Afghanistankrieg. Rasch wird dabei deutlich, dass die USA in unmittelbarer Folge auf
die Anschläge die Handlungshoheit übernehmen und die entstandene Dynamik nutzen,
ihr Vorgehen national wie international in einem weitgehenden Konsens einzubetten.
Nach Meinung des Verfassers müssen die vermeintlichen Erfolge des
Afghanistanfeldzuges aus heutiger Sicht aber in Frage gestellt werden. Eine stabile
Nachkriegsordnung ist bis dato nicht abzusehen. Als loses Staatenkonstrukt ohne
institutionelle Ausprägung scheint auch die Anti-Terror-Koalition keiner
funktionsfähigen Zukunft entgegen zu sehen. Die Bundesrepublik Deutschland erklärt
sich zwar uneingeschränkt solidarisch zu den USA, kann aufgrund ihrer
eingeschränkten Kooperationsfähigkeit aber nur sehr begrenzten Einfluss auf den
Kriegsverlauf und die internationale Terrorbekämpfung ausüben.
Im folgenden Abschnitt wird dargestellt, welche sicherheitspolitischen Konsequenzen
die Vereinigten Staaten bzw. Deutschland aus der veränderten Bedrohungslage ziehen.
Basierend auf dem Konzept des Nuclear Posture Review verkünden die USA, sich den
Einsatz nuklearer Waffen generell als taktische Option offen zu halten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Afghanistankrieg und Anti-Terror-Koalition
- Der Afghanistankrieg
- Die Bewertung des Afghanistankrieges
- Die Anti-Terror-Koalition
- Die Bewertung der Anti-Terror-Koalition
- Strategische Ausrichtung in einer Neuen Weltordnung
- Der Umbruch der Internationalen Struktur
- Die strategischen Konzepte der USA
- Die strategischen Versäumnisse der BRD
- Die Implementierung der Strategischen Ansätze
- Irakkrise
- Die US-Strategien im Bezug auf die Irakkrise
- Der geradlinige Weg der USA
- Der Schlingerkurs der BRD
- Die Auswirkung der Strategien auf die Außenpolitiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Entwicklung der auswärtigen Sicherheitspolitik in den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum vom 11. September 2001 bis zum 27. Januar 2003. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Reaktionen beider Länder auf die veränderte Sicherheitslage nach den Anschlägen auf das World Trade Center in New York und dem Pentagon. Die Arbeit analysiert die strategischen Konzepte der USA und Deutschlands, sowie die Umsetzung dieser Konzepte in den Afghanistankrieg, die Bildung der Anti-Terror-Koalition und die Irakkrise.
- Die Reaktion auf den 11. September 2001 und die Entstehung der "War on Terror"
- Der Vergleich der amerikanischen und deutschen Sicherheitsstrategien in der "Neuen Weltordnung"
- Die Rolle des Afghanistankrieges und der Anti-Terror-Koalition in der Entwicklung der Sicherheitspolitik
- Die Analyse des Irakkonflikts als Schlüsselfaktor der internationalen Sicherheitspolitik
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik im Spannungsfeld zwischen amerikanischer Dominanz und europäischer Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die unmittelbare Reaktion der USA auf die Anschläge vom 11. September 2001 und die daraus resultierende Eskalation der internationalen Sicherheitspolitik. Die USA übernehmen die Handlungshoheit und nutzen die entstandene Dynamik, um ihr Vorgehen national und international zu legitimieren. Die Bundesrepublik Deutschland erklärt sich solidarisch mit den USA, kann jedoch aufgrund ihrer eingeschränkten Kooperationsfähigkeit nur begrenzt Einfluss auf den Kriegsverlauf und die internationale Terrorbekämpfung nehmen. Der vermeintliche Erfolg des Afghanistankrieges wird kritisch betrachtet, da eine stabile Nachkriegsordnung bis dato ausbleibt. Auch die Anti-Terror-Koalition als loses Staatenkonstrukt ohne institutionelle Ausprägung scheint keine funktionierende Zukunft zu haben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den sicherheitspolitischen Konsequenzen, die die USA und Deutschland aus der veränderten Bedrohungslage ziehen. Die USA verkünden unter dem Konzept des Nuclear Posture Review, den Einsatz nuklearer Waffen als taktische Option offen zu halten. Die Gegenüberstellung mit asymmetrischen Bedrohungen relativiert jedoch das Abschreckungs- bzw. Vergeltungspotential dieser Erwägungen. Die National Security Strategy betont die Effizienz und reduziert Multilateralismus auf eine instrumentelle Variable. Gefahrenpotentiale werden unilateral definiert und notfalls mit antizipatorischen Verteidigungsschlägen bekämpft. Deutschland kann den amerikanischen Strategiepapieren zunächst keine umfassenden Ergänzungs- oder Alternativkonzepte entgegensetzen. Stattdessen beharrt die BRD auf den althergebrachten Normen, selbst wenn diese der realpolitischen Funktionalität entbehren. Effiziente Strukturen multilateraler Entscheidungsfindung bilden jedoch eine essentielle Handlungsvoraussetzung für die Bundesrepublik, da ihre außenpolitische Machtstellung ein singuläres Vorgehen nicht zulässt. Innenpolitische Budgetrestriktionen begrenzen zudem die nötige Kostenbereitschaft, sicherheitspolitische Idealvorstellungen auch substanziell zu unterfüttern.
Das dritte Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Positionen der USA und Deutschlands im Irakkonflikt. Die USA deklarieren das irakische Regime wegen mutmaßlicher Verbindungen zum internationalen Terrorismus, dem vermuteten Besitz von Massenvernichtungswaffen und aufgrund geostrategischer Machtpotentiale zum Feindbild. Zwar halten sich die USA die Option offen, ihr Vorgehen über einen Beschluss der Uno zu legitimieren, doch ihr aktuelles Gebären scheint darauf hinzuweisen, dass eine gewaltsame Intervention auf unilateraler Ebene bereits entschieden worden ist. Sollte es zu einem weiteren Irakkrieg kommen, könnte sich die amerikanische Konzeptlosigkeit betreffend einer Nachkriegsordnung noch als folgenreiches Manko erweisen. Vor dem Hintergrund eines polarisierenden Bundestagswahlkampfes zeigt sich die deutsche Regierung jedoch nicht in der Lage, die Debatte auf die argumentativen Defizite der USA zu fokussieren. Kakophonie und undiplomatische Wahlkampfrhetorik ebnen stattdessen den Weg ins außenpolitische Abseits. Besonders deutlich wird dies bei den erfolglosen Bemühungen, eine europäische Position zu konstruieren. Betreffend der Frage, ob nach der Vorstellung des UN-Rüstungskontrollberichtes eine weitere Resolution von Nöten ist, manövriert sich die BRD in eine diplomatische Sackgasse. Ein schlüssiges Rezept, wie dem irakischen Regime international zu begegnen sei, bietet Deutschland nicht an.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: auswärtige Sicherheitspolitik, 11. September 2001, Afghanistan, Anti-Terror-Koalition, Irakkrise, neue Weltordnung, strategische Konzepte, USA, Bundesrepublik Deutschland, Multilateralismus, Unilateralismus, Krieg, Terrorismus, Massenvernichtungswaffen, geostrategische Machtpotentiale.
- Citar trabajo
- Philipp Lehmann (Autor), 2003, Auswärtige Sicherheitspolitik in der Periode vom 11.September 2001 bis zum 27. Januar 2003 - Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19780