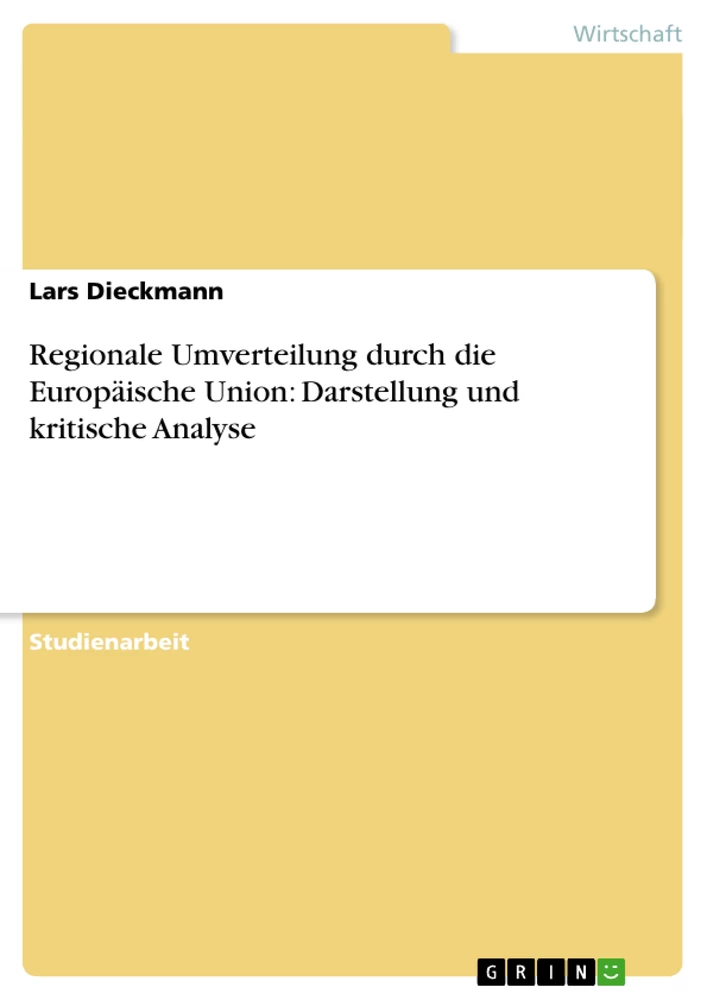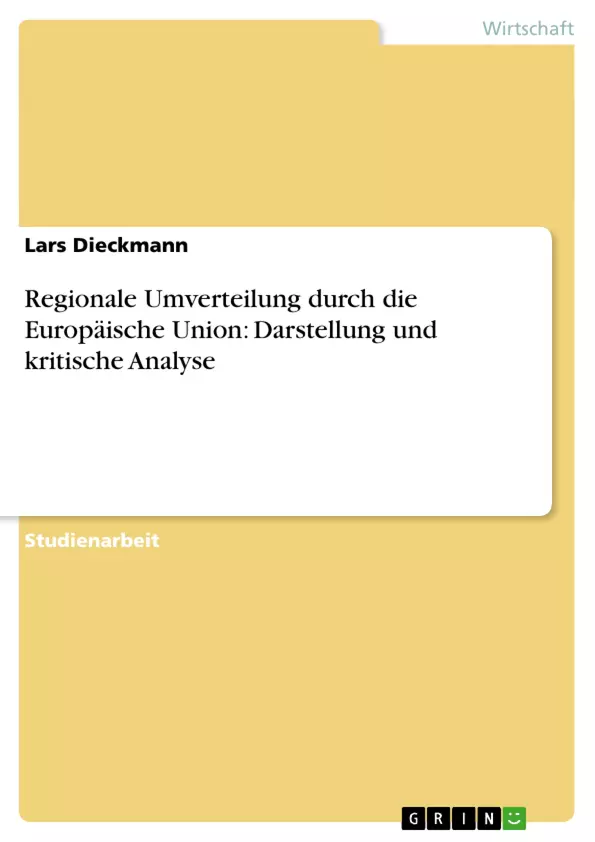Seit Anfang ihres Bestehens verpflichtet die Europäische Gemeinschaft ihre Mitglieder zur Solidarität. In der Präambel des EWG-Vertrages von 1957 brachten die damaligen Mitgliedsstaaten bereits das Bestreben zum Ausdruck, „ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Entwicklung zu fördern, indem sie den Abstand zwischen den einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Gebiete verringern“1. Im Rahmen der Einheitlichen Europäischen Akte, die 1987 in Kraft getreten ist, wurde diese Absicht noch einmal bekräftigt. Seitdem ist in Art.130a des EG-Vertrages das sogenannte Kohäsionsziel2 formuliert. Es besteht darin, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gemeinschaft zu stärken und „insbesondere (...) die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete (...) zu verringern.“3
Das grundsätzliche Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts findet in der finanzpolitischen Tätigkeit der Europäischen Union seine Umsetzung. Auf der Einnahmenseite orientiert sich die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten zu den Eigenmitteln des EU-Haushaltes am Leistungsfähigkeitsprinzip. 4 Dies wird bereits durch die Tatsache deutlich, daß die vom Europäischen Rat am 12. Dezember 1992 beschlossenen Veränderungen der Kriterien, anhand derer die Höhe der nationalen Beitragsanteile zum Haushalt der Europäischen Union bestimmt werden, zum Ziel haben, die Finanzlasten der Mitgliedsstaaten noch stärker an deren Wirtschaftskraft anzupassen. 5 Auf der Ausgabenseite verfügt der EUEtat über mehrere strukturpo-litische Fonds, die ausdrücklich dem Zweck dienen, den Entwicklungsstand wirtschafts-schwächerer Regionen in der Europäischen Union zu verbessern.6 Auf diese Weise verfolgt die EU mit ihrem Haushalt eine Umverteilungspolitik, die sich aus den oben genannten Grundsätzen des EG-Vertrages ableitet. Im folgenden sollen daher zunächst anhand empirischer Daten die fiskalischen Verteilungsmaßnahmen untersucht werden, die die Europäische Union zwischen ihren Mitgliedsländern vornimmt, bevor die Bestimmungskriterien und Einflußgrößen einer solchermaßen gearteten Finanzmittelverteilung aus theoretischer und praktischer Sicht kritisch hinterleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Verteilungspolitische Ziele der Europäischen Union
- Nettopositionen als Maßstab regionaler Umverteilung
- Definition und Berechnungsverfahren
- Haltung der EU-Kommission zu den Nettopositionen
- Normative Nettopositionen als Referenzsystem
- Differenzierung der Nettopositionen
- Nachteil der Nettopositionen und alternative Untersuchungsverfahren
- Formale Analyse der regionalen Umverteilung aus theoretischer und praktischer Sicht
- Charakterisierung der strukturpolitischen Ziele
- Mittelverteilung aus theoretischer Sicht
- Mittelverteilung aus praktischer Sicht
- Gründe für eine Zweckbindung der EU-Transfers
- Fondscharakter der EU-Ausgaben
- Umverteilungsentscheidungen als Ergebnis von „bargaining processes“
- Schlußfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der regionalen Umverteilung durch den Haushalt der Europäischen Union. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung und kritischen Analyse der Nettopositionen als Maßstab für die regionale Umverteilung. Ziel ist es, die Mechanismen und die Auswirkungen der Umverteilung auf die einzelnen Mitgliedsstaaten zu beleuchten.
- Verteilungspolitische Ziele der Europäischen Union
- Nettopositionen als Maßstab der regionalen Umverteilung
- Theoretische und praktische Aspekte der Mittelverteilung
- Kritik an den Nettopositionen als Messinstrument
- Alternative Ansätze zur Analyse der regionalen Umverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Verteilungspolitische Ziele der Europäischen Union
Das Kapitel skizziert die verteilungspolitischen Ziele der Europäischen Union, die sich aus der Erweiterung auf 15 Mitgliedsstaaten mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungsständen ergeben. Die Notwendigkeit einer regionalen Umverteilung wird herausgestellt, und die Nettopositionen als Maßstab für die Umverteilung werden vorgestellt.
Nettopositionen als Maßstab regionaler Umverteilung
Dieses Kapitel definiert die Nettopositionen, beschreibt ihre Berechnungsmethode und beleuchtet die Haltung der EU-Kommission zu diesem Instrument. Es werden normative Nettopositionen als Referenzsystem vorgestellt und die Differenzierung der Nettopositionen anhand verschiedener Faktoren erläutert. Zudem werden die Nachteile der Nettopositionen und alternative Untersuchungsverfahren diskutiert.
Formale Analyse der regionalen Umverteilung aus theoretischer und praktischer Sicht
Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Charakterisierung der strukturpolitischen Ziele der EU und der Analyse der Mittelverteilung aus theoretischer und praktischer Sicht. Es werden die Gründe für eine Zweckbindung der EU-Transfers, der Fondscharakter der EU-Ausgaben und der Einfluss von „bargaining processes“ auf Umverteilungsentscheidungen untersucht.
Schlüsselwörter
Regionale Umverteilung, Europäische Union, Nettopositionen, Finanztransfers, Strukturpolitik, „bargaining processes“, Mittelverteilung, Mitgliedsstaaten, EU-Haushalt, Kaufkraftparitäten, Mittelbindung, theoretische und praktische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kohäsionsziel der Europäischen Union?
Es zielt darauf ab, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu stärken und die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen der EU zu verringern.
Was versteht man unter den „Nettopositionen“ der Mitgliedsstaaten?
Es ist die Differenz zwischen den Zahlungen eines Landes in den EU-Haushalt und den Rückflüssen (z. B. Agrar- oder Strukturförderung), die es erhält.
Warum kritisiert die EU-Kommission die Fixierung auf Nettopositionen?
Weil sie nur fiskalische Ströme erfassen und indirekte Vorteile (wie den Zugang zum Binnenmarkt) und politische Gewinne ignorieren.
Nach welchem Prinzip richten sich die Beiträge zum EU-Haushalt?
Sie orientieren sich am Leistungsfähigkeitsprinzip, also an der Wirtschaftskraft (BNE) der jeweiligen Mitgliedsstaaten.
Was sind strukturpolitische Fonds?
Das sind Finanzinstrumente der EU, die gezielt Projekte in wirtschaftsschwächeren Regionen fördern, um dort Wachstum und Beschäftigung zu stimulieren.
- Citar trabajo
- Lars Dieckmann (Autor), 1996, Regionale Umverteilung durch die Europäische Union: Darstellung und kritische Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19786