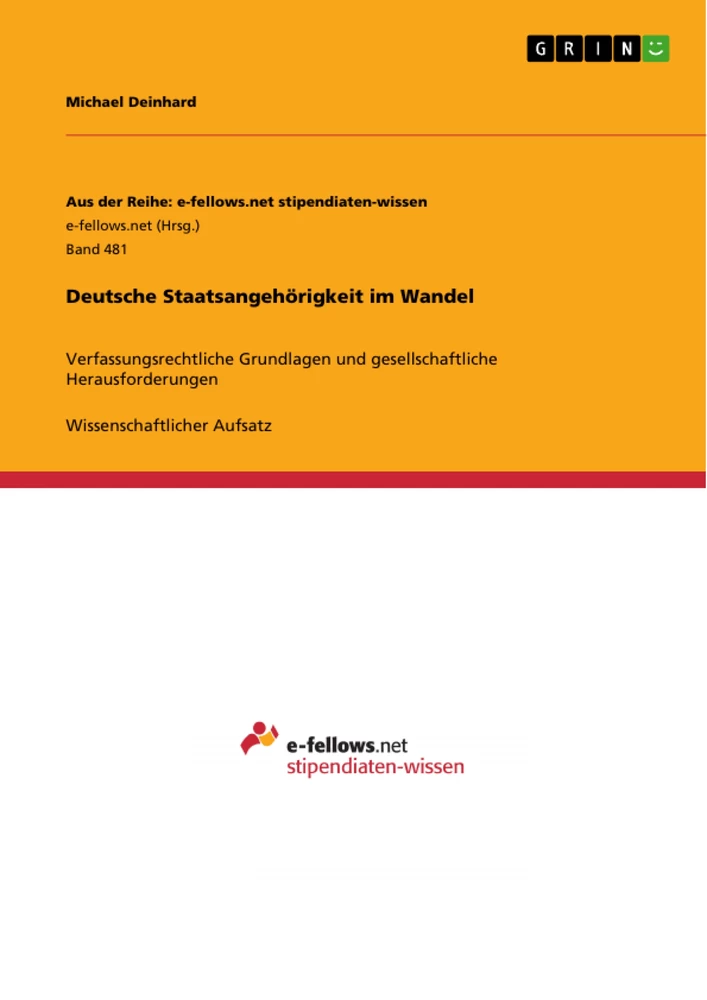„Niemand kann zwei Staatsangehörigkeiten besitzen, wie auch niemand zwei Mütter haben kann.” Dies betonte der französische Autor André Weiss im Jahre 1907 auf die Frage, ob die Zulässigkeit von Mehrstaatigkeit wünschenswert sei. Das Zitat hat einen hohen Aussagewert bezüglich Herkunft, Zeitgebundenheit und Sinngebung des Rechtsinstituts „Staatsangehörigkeit“ und schließt mit ein, dass der Staatsbürger Angehöriger eines souveränen, omnikompetenten Staates mit einer speziellen Bindung ist. Ein Band wechselseitiger Treue schweißt nach traditioneller Auffassung einen Staat und seinen Bürger zusammen. Staatsangehörigkeit als Rechtsinstitut ist ein Wesensmerkmal moderner Staatlichkeit, weil damit das Substrat der Personalhoheit des Staates (im Sinne der Drei-Elemente-Lehre von Georg Jellinek) definiert wird – manchmal weniger, manchmal mehr ideologisch, wie u.a. die nationalsozialistische Auslegung der Staatsangehörigkeit zeigt. Sie gehört zu den besonders sensiblen Elementen der traditionellen Staatlichkeit und erlaubt eine eindeutige Zuordnung jedes Menschen zu seinem politischen Verband. Die Staatsangehörigkeit ist die formale Voraussetzung der vollen Wahrnehmung seiner jeweiligen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Zunehmende (Arbeitnehmer-)Freizügigkeit, internationale Wanderungsbewegungen in global offenen Märkten (sei es durch Familiennachzug von Gastarbeitern, sei es durch Flüchtlingsströme wie aktuell von Afrika nach Europa) sowie die anhaltende Europäisierung setzen indes veränderte Bedingungen, mit denen die Starrheit klassischer Zuordnungsmodelle mit Blick auf tragende Verfassungsgrundsätze wie materielle Gleichheit, effektive Freiheit, Menschenwürde und Demokratie in Konflikt gerät. Das Gleichgewicht zwischen räumlicher Ausbreitung, Identitätsbildung und Nationalitätsverständnis wird damit in Mitleidenschaft gezogen.
Mit der Arbeit soll das traditionelle und aktuelle deutsche Rechtsverständnis hinsichtlich des Begriffs der Staatsangehörigkeit aufgezeigt, aber auch die Problemstellung dargestellt werden, inwiefern die gesellschaftlichen Veränderungen sowie die sozialwissenschaftlichen Theorien von der Entnationalisierung und der sog. „postnationale Bürgerbegriff“ das traditionelle Konzept bedrohen, das seinen Ursprung in den Nationalstaaten am Anfang des 19. Jahrhunderts findet.
Gliederungsübersicht
A. Einleitung und Fragestellungen
B. Die Problematik des globalen Bedeutungswandels von Staatsangehörigkeit im Überblick
C. Die historische Entwicklung in Deutschland
I. Die Anfänge zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Inkrafttreten des
RuStAG
II. Das Staatsangehörigkeitsrecht unter dem Grundgesetz
III. Die Neuausrichtung zur Jahrtausendwende: Einbürgerungsnovelle, Optionspflicht und Integrationsanforderungen
1. Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15.07.1999
2. Zuwanderungs- und Richtlinienumsetzungsgesetz
D. Funktionen und Strukturmerkmale der Staatsangehörigkeit
I. Die klassischen Funktionen
1. Zuordnungs- und Abgrenzungsfunktion
2. Staatskonstitutivum und Mittel der Legitimation von Staatsgewalt
3. Staatsangehörigkeit als Integrationsinstrument
II. Die Strukturmerkmale der Staatsangehörigkeit
E. Rechtsbegriff und Inhalt der Staatsangehörigkeit
I. Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht
1. Punktuelle Regelungen statt Legaldefinition
2. Zulässigkeit von Veränderungen im Staatsangehörigkeitsrecht
a) Allgemeine Entwicklungen
b) lus soli und ius sanguinis
c) Zulässigkeit von Mehrstaatigkeit und Optionsmodell
d) Der Volksbegriff in Art. 20 Abs. 2 GG
e) Reaktionen der Literatur
3. Die subjektiv-grundrechtliche Dimension der deutschen
Staatsangehörigkeit
a) Die Staatsangehörigkeit als Abwehr- und Leistungsrecht
b) Die Frage nach der institutionellen Garantie
4. Objektiv-rechtliche Grenzen und das „Band einer gemeinsamen Kultur"
a) Objektive Dimension der Staatsangehörigkeit
b) Die Deutschen als Kulturnation
II. Lehren und Theorien in der Literatur
1. Die Lehre vom tradierten Staatsangehörigkeitsbegriff
2. Der materielle Staatsangehörigkeitsbegriff auf Basis der Staatsgrundprinzipien
a) Allgemeines
b) Das Demokratieprinzip und der kulturell und ethnisch homogen definierte Staatsvolkbegriff
c) Demokratie und die Hinnahme von Mehrstaatigkeit
d) Staatsangehörigkeit als Kontinuitätsmodell und das Gleichheitsgebot
III. Der Staatsangehörigkeitsbegriff des deutschen Gesetzgebers
IV. Zwischenfazit
F. Neue Staatsangehörigkeitskonzepte: Das Nationalstaatsmodell im Umbruch
I. Staatsbürgerliche Entnationalisierung und der postnationale Bürgerbegriff
II. Die Renaissance der nationalen Staatsangehörigkeit
III. Zusammenfassung und Folgerungen für das Staatsangehörigkeitskonzept
G. Fazit und Stellungnahme
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen ius soli und ius sanguinis?
Das ius soli (Geburtsortsprinzip) und ius sanguinis (Abstammungsprinzip) sind die zwei grundlegenden Modelle zur Zuweisung der Staatsangehörigkeit.
Wie hat sich das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht gewandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung vom 19. Jahrhundert über das RuStAG bis hin zur Einbürgerungsnovelle 1999 und aktuellen Integrationsanforderungen.
Ist Mehrstaatigkeit (doppelte Staatsbürgerschaft) in Deutschland zulässig?
Die Arbeit untersucht die rechtliche Zulässigkeit von Mehrstaatigkeit und das damit verbundene Optionsmodell im deutschen Recht.
Was versteht man unter dem "postnationalen Bürgerbegriff"?
Es ist eine Theorie, die besagt, dass die strikte Bindung an einen Nationalstaat durch Globalisierung und Europäisierung an Bedeutung verliert.
Welche Funktionen hat die Staatsangehörigkeit?
Sie dient der Zuordnung, Abgrenzung, Legitimation von Staatsgewalt und fungiert als Instrument der gesellschaftlichen Integration.
- Quote paper
- Michael Deinhard (Author), 2012, Deutsche Staatsangehörigkeit im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198170