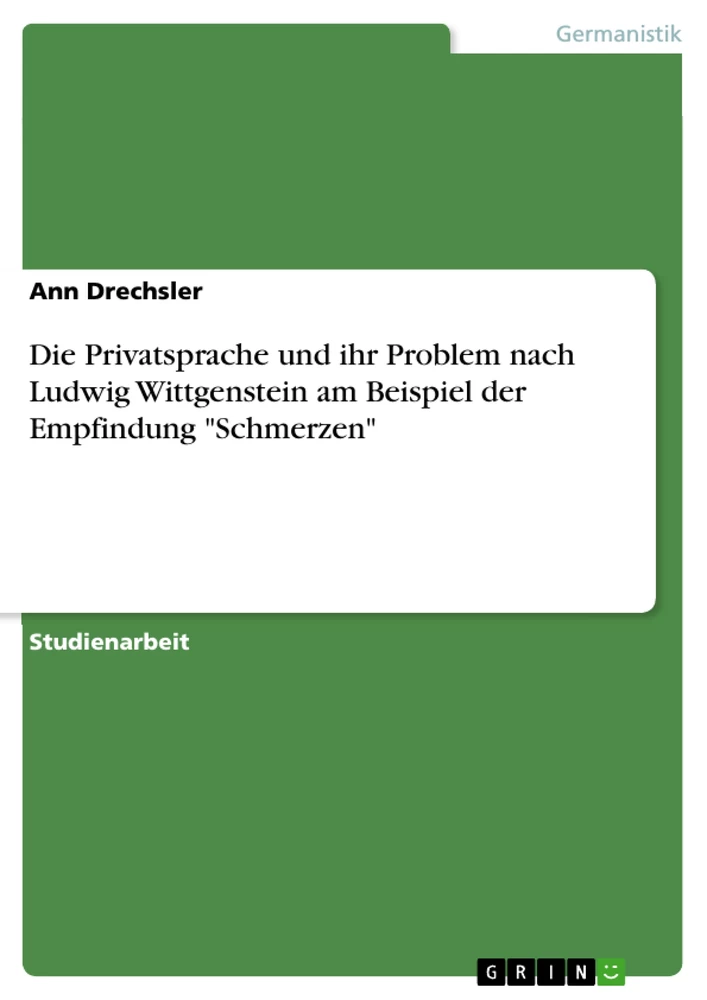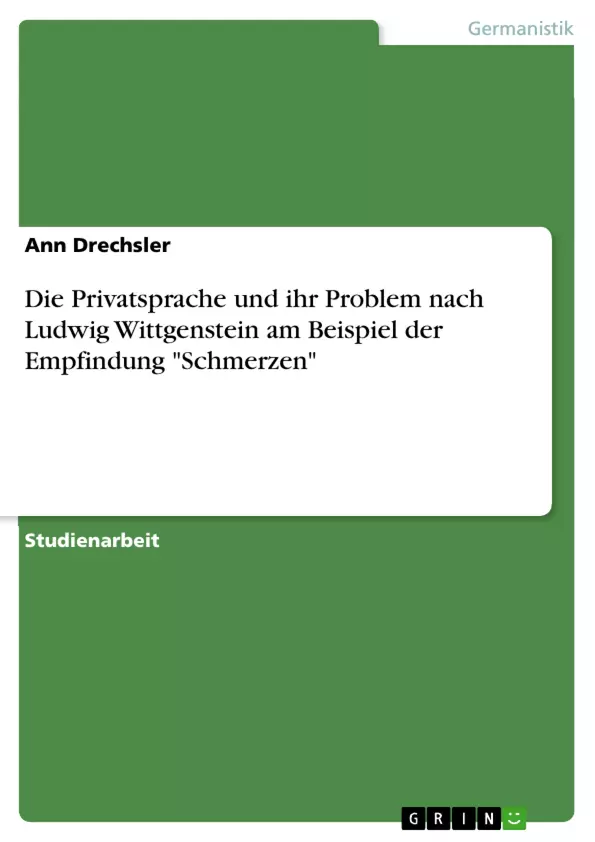Die vorliegende Ausarbeitung ist eine Verschriftlichung des von mir am 01.06.2011 im Seminar abgehaltenen Referates zum Thema ‚Privatsprache‘ aus den ‚Philosophischen Untersuchungen
(Abkürzung: PU)‘ (entstanden zwischen 1936 und 1947, veröffentlicht postum 1953), dem zweiten Hauptwerk/dem Spätwerk des Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951). Im Genauen wird es darum gehen, was Privatsprache ist, was unter dem sogenannten ‚Privatsprachen-Argument‘ zu verstehen ist und welche Probleme die Privatsprache mit sich bringt – dies wird aufgezeigt am Beispiel der Empfindung ‚Schmerzen‘. Speziell das Thema ‚Privatsprache‘ umfasst in den PU die
Abschnitte 243 bis 315; für das Referat sowie die jetzige Verschriftlichung davon wurden ganz bestimmte Abschnitte zur Beschreibung und Analyse ausgewählt. Die vorliegende kurze Abhandlung
soll also (noch einmal) einen Überblick zu den wichtigsten Aspekten der ‚Privatsprache‘ am Beispiel des Schmerzes geben.
Inhalt
1. Einleitung
2. Die ‚Privatsprache‘ und deren Problem nach Wittgenstein
3. Fazit
Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
1. Einleitung
Die vorliegende Ausarbeitung ist eine Verschriftlichung des von mir am 01.06.2011 im Seminar abgehaltenen Referates zum Thema ‚Privatsprache‘ aus den ‚Philosophischen Untersuchungen (Abkürzung: PU)‘ (entstanden zwischen 1936 und 1947, veröffentlicht postum 1953), dem zweiten Hauptwerk/dem Spätwerk des Philosophen Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951). Im Genauen wird es darum gehen, was Privatsprache ist, was unter dem sogenannten ‚Privatsprachen-Argument‘ zu verstehen ist und welche Probleme die Privatsprache mit sich bringt – dies wird aufgezeigt am Beispiel der Empfindung ‚Schmerzen‘. Speziell das Thema ‚Privatsprache‘ umfasst in den PU die Abschnitte 243 bis 315; für das Referat sowie die jetzige Verschriftlichung davon wurden ganz bestimmte Abschnitte zur Beschreibung und Analyse ausgewählt. Die vorliegende kurze Abhandlung soll also (noch einmal) einen Überblick zu den wichtigsten Aspekten der ‚Privatsprache‘ am Beispiel des Schmerzes geben.
2. Die ‚Privatsprache‘ und deren Problem nach Wittgenstein
Bevor es zur Thematik der ‚Privatsprache‘ kommt, soll geklärt werden, wie Wörter ihre Bedeutung erhalten. Wittgenstein greift dafür in seinen PU ein Zitat des christlichen Kirchenlehrers Augustinus von Hippo (354 – 430) aus dessen ‚Confessiones‘ (Bekenntnisse; autobiographische Betrachtungen) auf, das wie folgt lautet:
„Nannten die Erwachsenen irgend einen Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm zu, so nahm ich das wahr und ich begriff, daß der Gegenstand durch die Laute, die sie aussprachen, bezeichnet wurde, da sie auf ihn hinweisen wollten. Dies aber entnahm ich aus ihren Gebärden, der natürlichen Sprache aller Völker, der Sprache, die durch Mienen- und Augenspiel, durch Bewegungen der Glieder und den Klang der Stimme die Empfindungen der Seele anzeigt, wenn diese irgend etwas begehrt, oder festhält, oder zurückweist, oder flieht. So lernte ich nach und nach verstehen, welche Dinge die Wörter bezeichneten, die ich wieder und wieder, an ihren bestimmten Stellen in verschiedenen Sätzen, aussprechen hörte. Und ich brachte, als nun mein Mund sich an diese Zeichen gewöhnt hatte, durch sie meine Wünsche zum Ausdruck.“[1]
Wittgenstein zieht daraus den Schluss, dass das Wesen der menschlichen Sprache so verfährt, dass Wörter der Sprache Gegenstände benennen, d. h. jedes Wort hat eine Bedeutung und umgekehrt ist eine Bedeutung einem bestimmten Wort zugeordnet – die Bedeutung ist also der Gegenstand, für den das Wort steht.[2] Noch etwas vereinfachter heißt das, dass Wörter für Gegenstände stehen und diese Gegenstände sind folglich die Bedeutungen der Wörter.[3] Warum für die Privatsprache als Einstieg aus den PU Abschnitt 1 (Augustinus) gewählt wurde, soll gleich deutlich werden.
Was bedeutet Privatsprache ? Damit ist die „Möglichkeit einer privaten, nur vom Sprecher dieser Sprache verstehbaren Sprache“[4] gemeint. Das sogenannte Privatsprachen-Argument beginnt in den PU mit Abschnitt 243:
„[…] Wäre aber auch eine Sprache denkbar, in der Einer seine inneren Erlebnisse – seine Gefühle, Stimmungen. etc. – für den eigenen Gebrauch aufschreiben, oder aussprechen könnte? – Können wir denn das in unserer gewöhnlichen Sprache nicht tun? – Aber so meine ich’s nicht. Die Wörter dieser Sprache sollten sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann; auf seine unmittelbaren, privaten, Empfindungen. Ein Anderer kann diese Sprache also nicht verstehen.“[5]
Man darf aus der Benennung nicht schließen, dass es sich nur um ein Argument handelt – vielmehr ist es ein komplexes Gebilde von Argumenten und Beobachtungen. Vorrangig geht es in PU 243 nicht darum, ob eine private Sprache möglich sei, sondern das Hauptaugenmerk liegt auf unseren Wörtern für subjektive Empfindungen; ferner muss man also fragen, ob man hierbei von Namen von ‚inneren‘ Gegenständen, also von individuell in unserem Bewusstsein stattfindenden Geschehnissen sprechen kann?[6]
Hier nun wird noch einmal Augustinus herangezogen, bei dem Wörter die Bezeichnungen von Gegenständen sind – will man also wissen, was ein Wort bedeutet, so müsse nur gewusst werden, welchen Gegenstand es bezeichnet, was PU 264 zeigt: „Wenn du einmal weißt, was das Wort bezeichnet, verstehst du es, kennst seine ganze Anwendung.“[7] Überträgt man dies nun auf Wörter für Gefühle (a), Stimmungen (b) und Empfindungen (c), führt das zu der Auffassung, dass auch a, b und c Gegenstände sind, aber eben psychische, also Dinge, Ereignisse im menschlichen Geist (d. h. in der Innenwelt eines Bewusstseins) und nicht plastisch-räumliche wie z. B. Stühle oder Bäume (räumliche Außenwelt) – diese beiden Aspekte sind also voneinander zu unterscheiden. Wenn nun eine Empfindung ebenfalls ein Gegenstand ist, was man so verstehen kann, da sie ja mit einem Nomen/Gegenstandswort bezeichnet wird, dann ist sie natürlich kein räumlicher Gegenstand, sondern nur ein für ein jeweiliges Bewusstsein/für eine subjektive Innenwelt wahrnehmbarer.[8]
Nach Augustinus erhält ein Wort seine Bedeutung, indem es einen Gegenstand bezeichnet. Weiterführend heißt das im Falle von Empfindungswörtern, dass sich die Bedeutung von Empfindungswörtern aus der Bezeichnung von Empfindungen ergibt; dass eine Empfindung ein Gegenstand im individuellen Bewusstsein ist und dass Empfindungen nicht abhängig vom Ausdrucksverhalten sind.[9] Worin liegt nun genau das Problem bei Empfindungen/Empfindungswörtern? Das sagt schon das Ende des PU-Abschnittes 243 (siehe Textstelle mit Fußnote 5) aus: Nur der Sprecher könne die Sprache über seine privaten Empfindungen verstehen.
Bei Schroeder heißt es weiter, dass folglich mehrere Menschen über die Bedeutung von Empfindungswörtern im Grunde nicht kommunizieren können, da subjektive Empfindungen für andere nicht greifbar seien und sich deshalb jene Empfindungen auch nicht beschreiben ließen. Es werden drei Konsequenzen aufgestellt: I. ‚Ich nehme meine Empfindungen direkt wahr.‘; II. ‚Andere erfahren höchstens indirekt von meinen Empfindungen.‘; III. ‚Die Beschaffenheit meiner Empfindungen kann ich niemandem mitteilen.‘[10]
Aus I. folgt: Nur ich selbst kenne und erlebe meine Empfindungen.
Aus II. folgt, dass Mitmenschen nie absolut sicher sein können, welche Empfindungen in einem Gegenüber vorgehen; man kann zwar gewisse äußere Anzeichen am Verhalten erkennen, aber diese können ja auch täuschen, d. h. es besteht die Möglichkeit, nur so zu tun, als habe man Schmerzen, oder man hat Schmerzen, lässt sich das aber nicht anmerken.[11] Dies verdeutlicht der PU-Abschnitt 246:
„Inwiefern sind nun meine Empfindungen privat? – Nun, nur ich kann wissen, ob ich wirklich Schmerzen habe; der Andere kann es nur vermuten. – Das ist in einer Weise falsch, in einer andern unsinnig. Wenn wir das Wort ‚wissen‘ gebrauchen, wie es normalerweise gebraucht wird (und wie sollen wir es denn gebrauchen!), dann wissen es Andre sehr häufig, wenn ich Schmerzen habe. – Ja, aber doch nicht mit der Sicherheit, mit der ich selbst es weiß! – […]“[12]
Aus III. folgt dann gewissermaßen noch eine Zuspitzung: Auch wenn seitens des Gegenübers keine Täuschungsabsicht vorliegt, kann der andere nie wirklich wissen, was das Gegenüber fühlt/empfindet, da man Art und Zustand privater, individueller Empfindungen mit Worten anscheinend nicht wirklich beschreiben kann – lediglich die betreffende Person selbst wisse wirklich von ihren Gefühlen, d. h. wenn diese Person ihre Empfindungen mit bestimmten Wörtern bezeichnet, könne das Gegenüber diese Wortbedeutungen nicht gänzlich verstehen; es ist also zwischen der Kenntnis des eigenen und eines fremden Bewusstseins zu unterscheiden.[13] Dies verdeutlichen die PU-Abschnitte 272 und 293: „Das Wesentliche am privaten Erlebnis ist eigentlich nicht, daß Jeder sein eigenes Exemplar besitzt, sondern daß keiner weiß, ob der Andere auch dies hat, oder etwas anderes. […]“[14] ;
[...]
[1] Wittgenstein: PU, Abschnitt 1.
[2] Vgl. ebd.
[3] Vgl. Kienzler 2007, S. 21.
[4] Vgl. ebd., S. 104.
[5] Wittgenstein: PU, Abschnitt 243.
[6] Vgl. Schroeder 2009, S. 119.
[7] Wittgenstein: PU, Abschnitt 264.
[8] Vgl. Schroeder 2009, S. 119 f.
[9] Vgl. ebd., S. 121.
[10] Vgl. ebd.
[11] Vgl. Schroeder 2009, S. 122.
[12] Wittgenstein: PU, Abschnitt 246.
[13] Vgl. Schroeder 2009, S. 122.
[14] Wittgenstein: PU, Abschnitt 272.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Ludwig Wittgenstein unter einer Privatsprache?
Eine Privatsprache wäre eine Sprache, deren Wörter sich auf unmittelbare, private Empfindungen beziehen und die nur vom Sprecher selbst verstanden werden kann.
Was ist das zentrale Problem der Privatsprache?
Das Problem liegt darin, dass andere Menschen die Bedeutung von Wörtern für subjektive Empfindungen nicht prüfen können, was eine echte Kommunikation darüber erschwert.
Warum nutzt Wittgenstein das Beispiel "Schmerz"?
Schmerz ist eine klassische private Empfindung. Wittgenstein analysiert hier, ob das Wort "Schmerz" ein Name für ein inneres, nur mir zugängliches Objekt ist.
Welche Rolle spielt Augustinus in Wittgensteins Argumentation?
Wittgenstein kritisiert die Auffassung von Augustinus, dass Wörter ihre Bedeutung allein dadurch erhalten, dass sie auf (äußere oder innere) Gegenstände hinweisen.
Können andere sicher wissen, ob ich Schmerzen habe?
Wittgenstein diskutiert, dass andere es oft "wissen", wenn ich Schmerzen habe, aber eben nicht mit der Art von subjektiver Gewissheit, die ich selbst habe.
- Citation du texte
- B.A. Ann Drechsler (Auteur), 2011, Die Privatsprache und ihr Problem nach Ludwig Wittgenstein am Beispiel der Empfindung "Schmerzen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198468