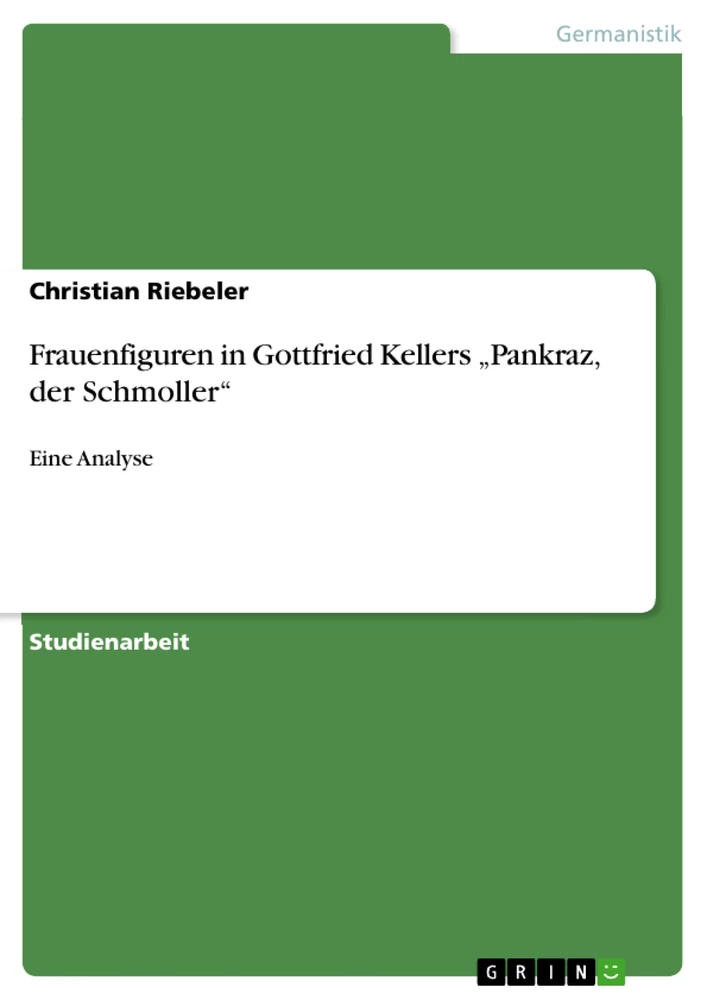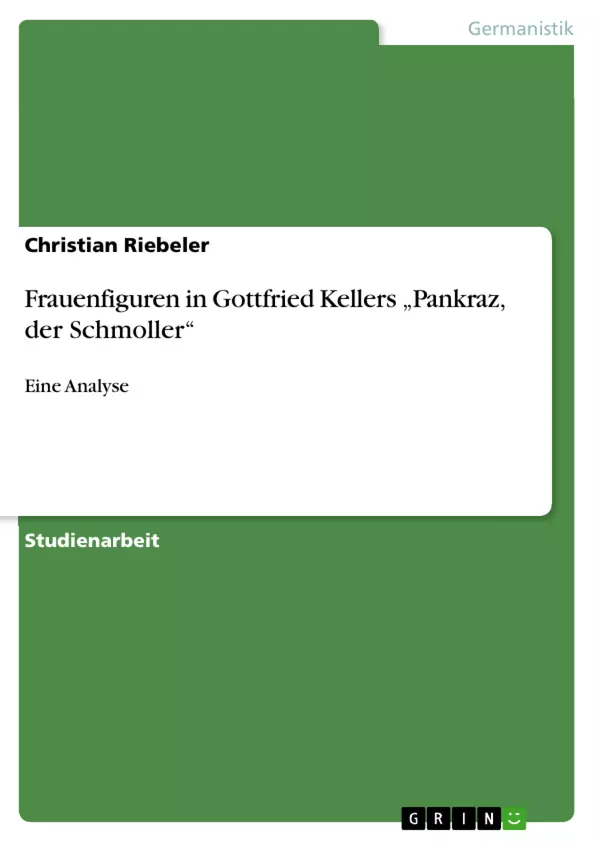Pankraz ist eine Figur, die nicht nur durch ihr Schmollen gekennzeichnet ist, sondern auch durch verschiedene andere psychologische Aspekte. Es ist jedoch festzuhalten, dass das Schmollen eines der interessanteren Phänomene ist. Was löst dieses Schmollen aus? Welche Grundlagen gibt es in der Natur Pankraz‘ und warum ist er, wie er ist?
Um diese Frage umfassend zu beantworten, bedarf es mehrerer Ansätze, die verein-zelt schon in der Literatur versucht wurden zu erklären. Bisher wurde jedoch noch kein verstärktes Augenmerk darauf gelegt, welche Rolle die Frauenfiguren in seinem Verhalten spielen. Gewiss wurde die Position der Lydia von vielen Seiten gedeutet – das wird in dieser Hausarbeit ebenfalls geschehen -, jedoch fehlt es oft an anderen Blickwinkeln. Welche Rolle spielt die Mutter und seine Schwester? Es gibt nur drei Frauen, die Pankraz‘ Leben beeinflusst haben, und diese drei gilt es, soweit es geht, zu beleuchten.
Neben der Rahmenhandlung wird in dieser Hausarbeit die Psychologie Pankraz‘ dargestellt. Es werden Erklärungsansätze gegeben, die das Schmollen verständli-cher machen sollen. Dies kann unter anderem mit den Schriften Freuds gelingen, die eine Analyse ermöglichen. Hier knüpfe ich an die Ergebnisse aus dem Seminar an und beziehe diese Ergebnisse auf Pankraz.
Inhaltsverzeichnis
1. Entwicklung der Fragestellung
2. Einleitung
3. Charakterisierung der Frauenfiguren
3.1. Mutter
3.2. Esther
3.3. Lydia
4. Pankraz
5. Schmollen in der Psychologie
6. Lust- und Realitätsprinzip
7. Fazit
Literaturverzeichnis
- Citation du texte
- Christian Riebeler (Auteur), 2012, Frauenfiguren in Gottfried Kellers „Pankraz, der Schmoller“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198680