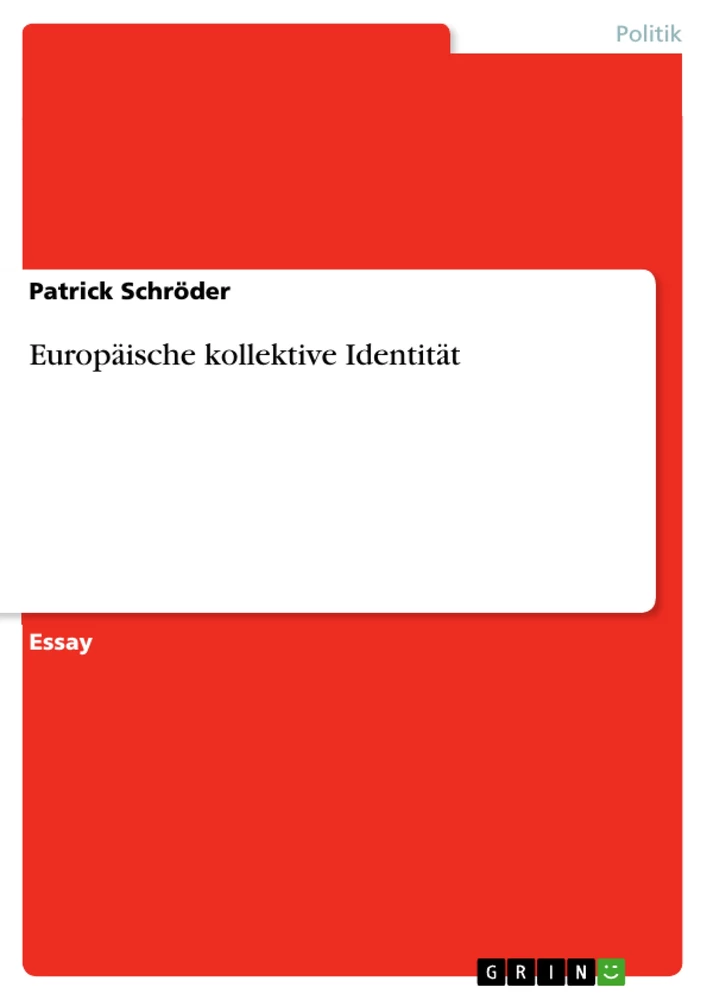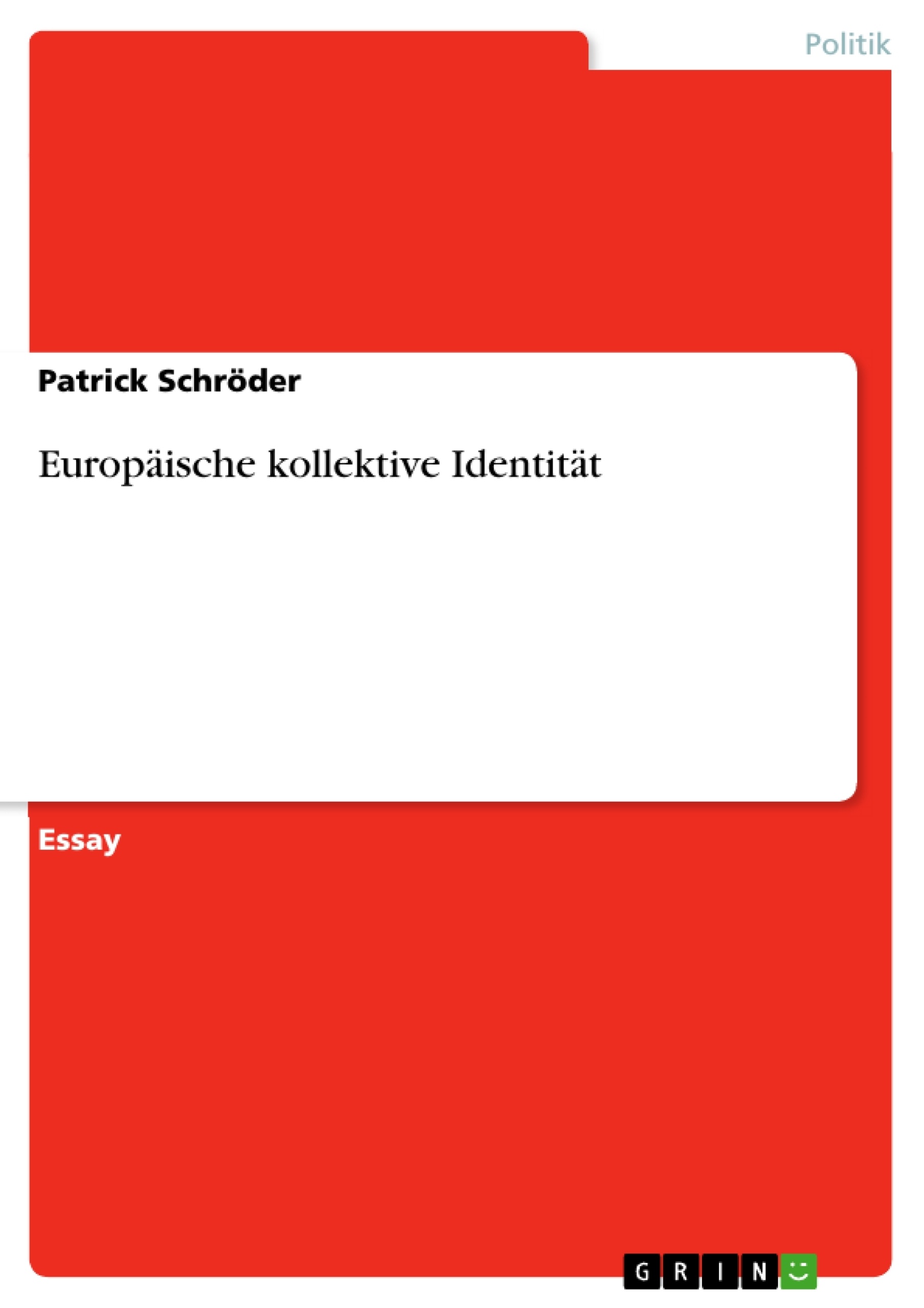Quo vadis Europäische Union? Die aktuelle Staatsschuldenkrise im Euroraum stellt sich als eine ernsthafte Herausforderung für die EU dar. Dabei belasten Haushaltskrisen einzelner Mitgliedstaaten die gesamte Union und gefährden somit das europäische Einigungswerk. In der medialen Öffentlichkeit um die Rettung der Europäischen Union klingen gelegentlich nationalen Identitätsbezüge an. Als exemplarisches Beispiel kann hierfür eine griechische Tageszeitung herangezogen werden, die die Deutschen als Euro-Nazis bezeichnete (vgl. Müller 2011: o.S.). Diese Beobachtung lässt erstens vermuten, dass die Identitätsbezüge der Unionsbürger weiterhin primär fokussierend auf den Nationalstaaten liegen und es daher kein ausgeprägtes europäisches Wir-Bewusstsein (unter den Unionsbürgern) gibt. Insbesondere forcieren zweitens die nationalen Bezüge eine Abgrenzung zwischen „uns“ und den „anderen“ europäischen Mitgliedsstaaten und erschweren zusätzlich die Herausbildung eines gemeinsamen Wir-Bewusstseins. Zu Recht stellt sich folglich die Frage, inwiefern überhaupt eine europäische Identität - also ein europäisches Wir-Bewusstsein - besteht.
Quo vadis Europäische Union? Die aktuelle Staatsschuldenkrise im Euroraum stellt sich als eine ernsthafte Herausforderung für die EU dar. Dabei belasten Haushaltskrisen einzelner Mitgliedstaaten die gesamte Union und gefährden somit das europäische Einigungswerk. In der medialen Öffentlichkeit um die Rettung der Europäischen Union klingen gelegentlich nationalen Identitätsbezüge an. Als exemplarisches Beispiel kann hierfür eine griechische Tageszeitung herangezogen werden, die die Deutschen als Euro-Nazis bezeichnete (vgl. Müller 2011: o.S.). Diese Beobachtung lässt erstens vermuten, dass die Identitätsbezüge der Unionsbürger weiterhin primär fokussierend auf den Nationalstaaten liegen und es daher kein ausgeprägtes europäisches Wir-Bewusstsein (unter den Unionsbürgern) gibt. Insbesondere forcieren zweitens die nationalen Bezüge eine Abgrenzung zwischen „uns“ und den „anderen“ europäischen Mitgliedsstaaten und erschweren zusätzlich die Herausbildung eines gemeinsamen Wir-Bewusstseins. Zu Recht stellt sich folglich die Frage, inwiefern überhaupt eine europäische Identität - also ein europäisches Wir-Bewusstsein - besteht.
Identifikation ist der Schlüssel
Um eine zufriedenstellende Antwort zu erlangen, hilft das soziologische Konzept der kollektiven Identität, das maßgeblich von George H. Mead geprägt wurde und sich fortwährender inhaltlicher Erweiterung erfreut (vgl. Kaina 2009: 40). Hierbei handelt es sich ganz grundlegend verstanden um eine soziologisch komplexe Konstruktion, die die Zugehörigkeitsgefühle eines Individuums zu einem sozialen Gebilde - dem Unionskollektiv - bezeichnen (vgl. Kaina 2009: 40). Als soziales Kollektiv wird eine Vielzahl von Personen verstanden, die nicht miteinander in Interaktion stehen, jedoch über ein gemeinsames Werte- und Normensystem verfügen und daher ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelt haben (vgl. Lange et al. 2007: 340). Die bisherigen Definitionen stellen vor allem die affektive Dimension in den Vordergrund, dies macht eine notwendige Korrektur nötig. Infolgedessen wird die Definition von Kaina zugrunde gelegt und festgestellt, dass eine „kollektive Identität auf individueller Ebene als Identifikation von Personen mit einem Kollektiv“ (Kaina 2009: 47; Hervorgehoben im Original) bezeichne. Dies unterstreicht einerseits den Prozesscharakter und eröffnet anderseits die Möglichkeit, dass neben einer emotionalen (affektiven) Komponente, ebenso kognitive sowie konative Elemente analytisch nutzbar gemacht werden (vgl. Kaina 2009: 83).
In Hinblick auf eine europäische Identität ist zu untersuchen, ob sich die Unionsbürger auf individueller Ebene tatsächlich mit der Europäischen Union identifizieren und wenn ja, in welchem Ausmaß dies stattfindet. Hierbei können diverse Stufen der Identifikation mit dem Unionskollektiv festgestellt werden. Zunächst gibt es eine kognitiv orientierte Identifikation, die ganz grundlegend das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur Union beschreibt. Dazu zählen sowohl bestehendes Wissen über die Union als auch Interesse an ihr. Auf der nächsthöheren Stufe folgt die affektiv orientierte Identifikation, die den Fokus auf die emotionale Verbindung wie Zugehörigkeitsgefühle des einzelnen Individuums zur Union legt. Die höchste Stufe ist die konativ orientierte Identifikation. Hierbei geht es um die intrinsische Absicht des Einzelnen sich solidarisch gegenüber seinen Mitbürgern zu verhalten (vgl. Kaina 2009: 52f.).
Warum bedarf es einer europäischen Identität?
Zum einen besteht aufgrund der Größe des europäischen Kollektivs die Annahme, dass sich die Unionsbürger in der Regel nicht kennen und sich somit untereinander fremd sind. Eine gemeinsam geteilte europäische Identität kann Solidarität zwischen den sich fremden Unionsbürgern über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg stiften. Solidarität meint im Kern, dass sich die Unionsbürger gegenseitig unterstützen und füreinander einstehen (vgl. Groser 2010: 960). Ließe sich ein derartiges Verhalten beobachten, würde die höchste Stufe der Identifikation erkennbar: Die intrinsisch motivierte Verhaltensabsicht andere Unionsbürger zu unterstützen. Grundlage hierfür ist ein gemeinsam geteiltes Zusammengehörigkeitsbewusstsein und -gefühl zum europäischen Kollektiv. Im Rahmen einer Meinungsumfrage wurde die Frage gestellt: Sollte Griechenland weiter auch mit deutschen Steuergeldern unterstützt werden? Von den 1.000 befragten Deutschen, antworteten 49% der Befragten mit „Ja“, wohingegen 47% mit „Nein“ votierten und sich 4% mit „Weiß nicht“ äußerten (vgl. Statista 2011: o.S.). Eine eindeutige Aussage, ob hierin ein Solidaritätsbekenntnis zu Griechenland zu erkennen ist, kann allein auf Basis dieser Meinungsumfrage nicht getroffen werden.
Zum anderen ist aus demokratietheoretischer Überlegung eine europäische Identität sinnvoll, weil sie dazu beiträgt, die Akzeptanz von europäischen Regelungen (Unionsgesetzen) unter den Unionsbürgern zu stärken (vgl. Schneider 2011: 146). Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn sich beschlossene Regelungen nachteilig (negativer Nutzen) für die Betroffenen auswirken. Was daher erreicht werden muss, ist eine möglichst große Übereinstimmung von allgemein verbindlichen europäischen Entscheidungen und den Interessen der Entscheidungsbetroffenen (vgl. Kaina 2009: 151).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer europäischen kollektiven Identität?
Es beschreibt ein Wir-Bewusstsein der Unionsbürger, das auf gemeinsamen Werten und einem Zugehörigkeitsgefühl zur Europäischen Union basiert.
Warum ist eine europäische Identität für die EU wichtig?
Sie stiftet Solidarität zwischen Bürgern über Grenzen hinweg und erhöht die Akzeptanz für europäische Regelungen und Gesetze.
Gibt es heute ein ausgeprägtes europäisches Wir-Bewusstsein?
Beobachtungen während der Staatsschuldenkrise deuten darauf hin, dass nationale Identitäten oft noch dominieren und Abgrenzungen zu anderen Mitgliedstaaten forcieren.
Was sind die Stufen der Identifikation mit der EU?
Man unterscheidet die kognitive Stufe (Wissen/Zugehörigkeitsbewusstsein), die affektive Stufe (Emotionen) und die konative Stufe (Handlungsbereitschaft/Solidarität).
Wie beeinflussen nationale Identitäten die europäische Einigung?
Starke nationale Bezüge können ein gemeinsames europäisches Bewusstsein erschweren, da sie oft eine Unterscheidung zwischen „uns“ und „den anderen“ betonen.
- Citar trabajo
- Patrick Schröder (Autor), 2011, Europäische kollektive Identität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/198792