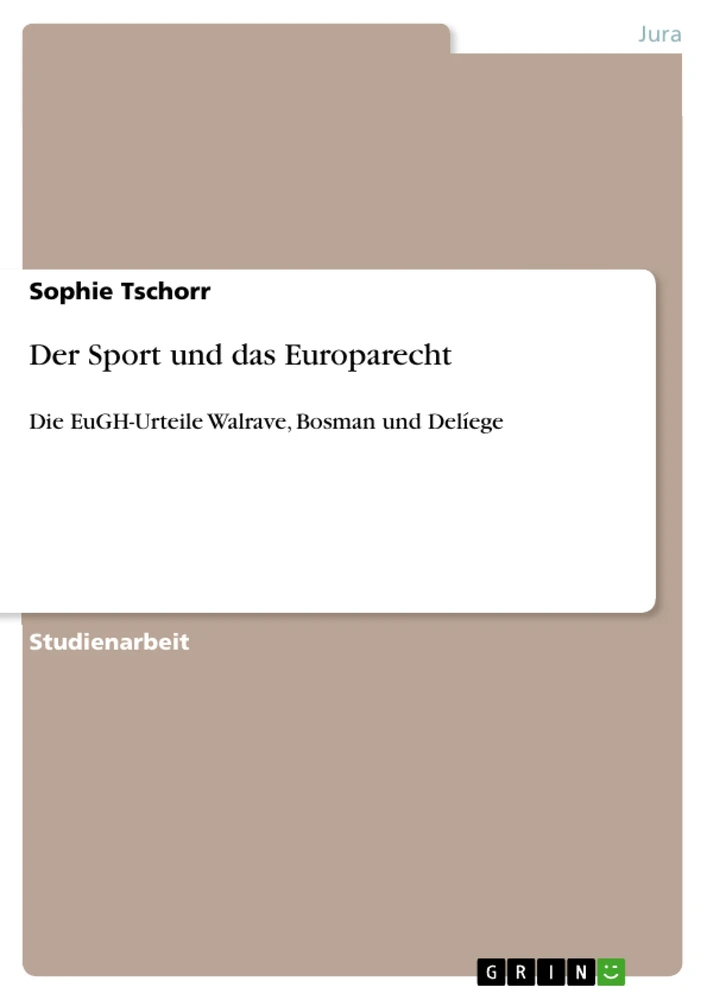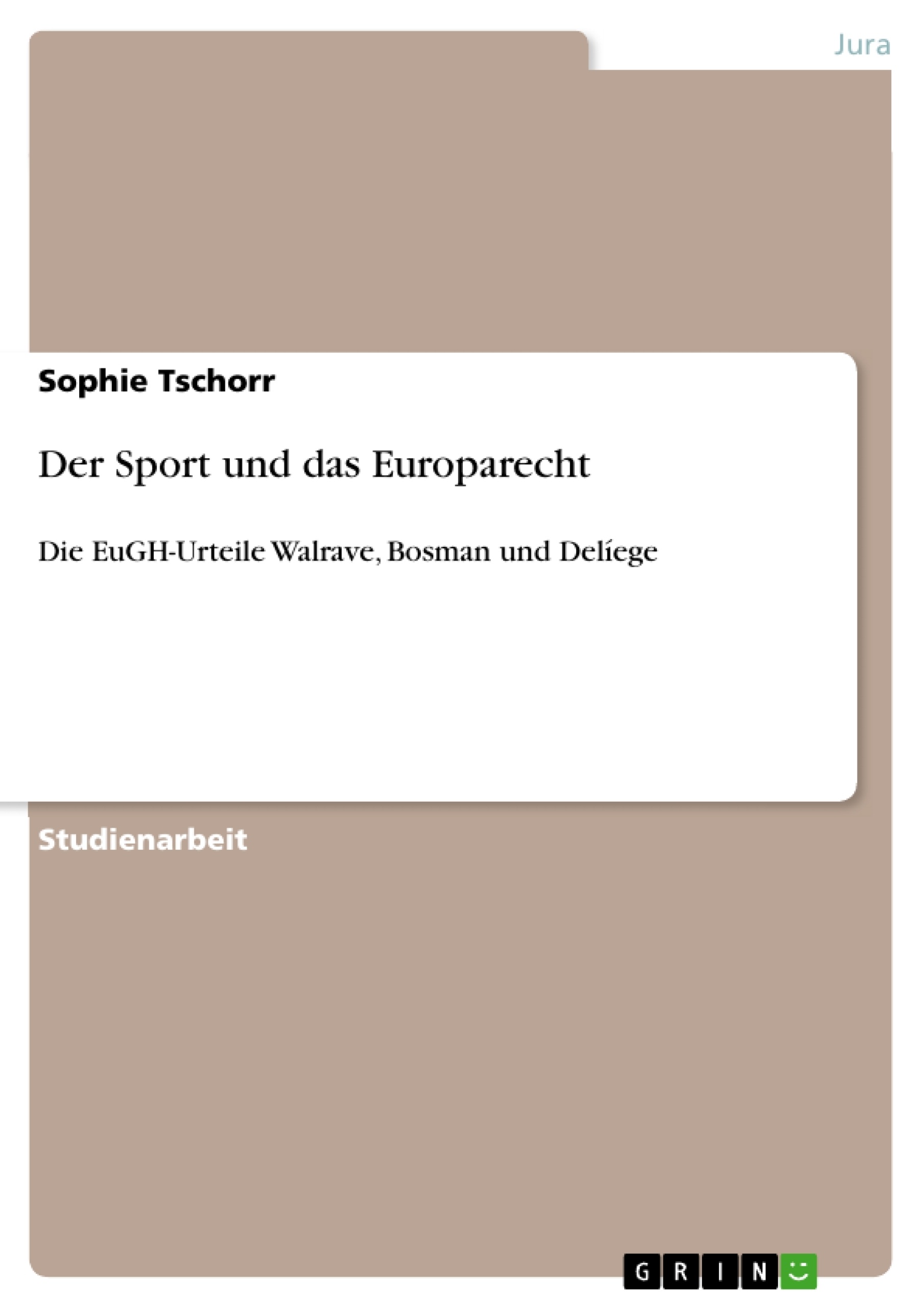Die vorliegende Arbeit wurde im ersten Fachsemester als Semesterarbeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin verfasst. Sie befasst sich mit dem Europarecht und der Frage, welche Rolle der Sport in der Wirtschaft und der Rechtswissenschaft innerhalb der Europäischen Union einnimmt und welche Entwicklung der Sportsektor hinter sich gebracht hat. Seit Beginn der 70er Jahre befasst sich nun schon der EuGH mit der Reichweite der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Dienstleistungsfreiheit in Bezug auf den Profi- und Amateursportler. Die vorliegende Arbeit stellt einen Überblick dar und befasst sich hierfür mit den Urteilen des EuGH „Walrave und Koch“, „Bosman“ und „Deliége“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Sport als Teil der Art. 45 und Art. 56 AEUV?
- 2.1. Der Wirtschaftsfaktor Sport
- 2.2. Anwendung der Verträge auf das Sportrecht
- 2.3. Die Grundfreiheiten im AEUV
- 2.3.1. Freizügigkeit von Arbeitnehmern
- 2.3.2. Der freie Dienstleistungsverkehr in Art. 56 AEUV
- 2.4. Drittwirkungsproblematik und der Kampf um (mehr) Autonomie
- 2.4.1. Drittwirkung
- 2.4.2. Das Prinzip des Art. 5 Abs. 2 EUV
- 3. Der EuGH und der Sport
- 3.1. Walrave und Koch (1974)
- 3.1.1. Sachverhalt
- 3.1.2. Anwendung des Rechts auf den Sachverhalt
- 3.2. Bosman (1995)
- 3.2.1. Grundlegendes
- 3.2.2. Stand und Praxis vor dem Bosman-Urteil
- 3.2.3. Sachverhalt
- 3.2.4. Transferregeln
- 3.2.5. Ausländerklausel
- 3.2.6. Auswirkungen auf den Sport in der EU
- 3.3. Deliége (2000)
- 3.3.1. Amateur oder Profi- der Status eines Sportlers
- 3.3.2. Auswahlkriterien für einen internationalen Wettkampf
- 4. Untersuchungsergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle des Sports im Kontext des Europarechts. Sie analysiert, wie der EuGH die Grundfreiheiten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auf den Sportbereich anwendet und welche Auswirkungen dies auf den Sportsektor hat. Die Arbeit konzentriert sich auf die Urteile Walrave und Koch, Bosman und Deliége, die richtungsweisend für die Entwicklung des Sportrechts in der EU waren.
- Die wirtschaftliche Bedeutung des Sports innerhalb der EU
- Die Anwendung der Grundfreiheiten (Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Dienstleistungsfreiheit) auf den Sportbereich
- Die Drittwirkung des AEUV auf das Sportrecht und die Autonomie des Sports
- Die Auswirkungen der EuGH-Urteile auf den Profi- und Amateursport
- Die Herausforderungen, die sich aus der Integration des Sports in den europäischen Binnenmarkt ergeben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit und die Bedeutung des Europarechts für den Sport vor. Kapitel 2 untersucht die Einordnung des Sports in den Geltungsbereich der Grundfreiheiten des AEUV. Dabei werden die Argumente für und gegen die Anwendung des AEUV auf den Sportbereich betrachtet. Kapitel 3 analysiert die Urteile Walrave und Koch, Bosman und Deliége. Für jedes Urteil wird der Sachverhalt und die Rechtsprechung des EuGH detailliert dargestellt. Schließlich werden die Auswirkungen der Urteile auf den Sportsektor in der EU beleuchtet.
Schlüsselwörter
Europarecht, Sportrecht, Grundfreiheiten, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, EuGH, Walrave und Koch, Bosman, Deliége, Drittwirkung, Autonomie, Profi- und Amateursport, Binnenmarkt, wirtschaftliche Bedeutung des Sports, Sport in der EU
- Quote paper
- Sophie Tschorr (Author), 2009, Der Sport und das Europarecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199137