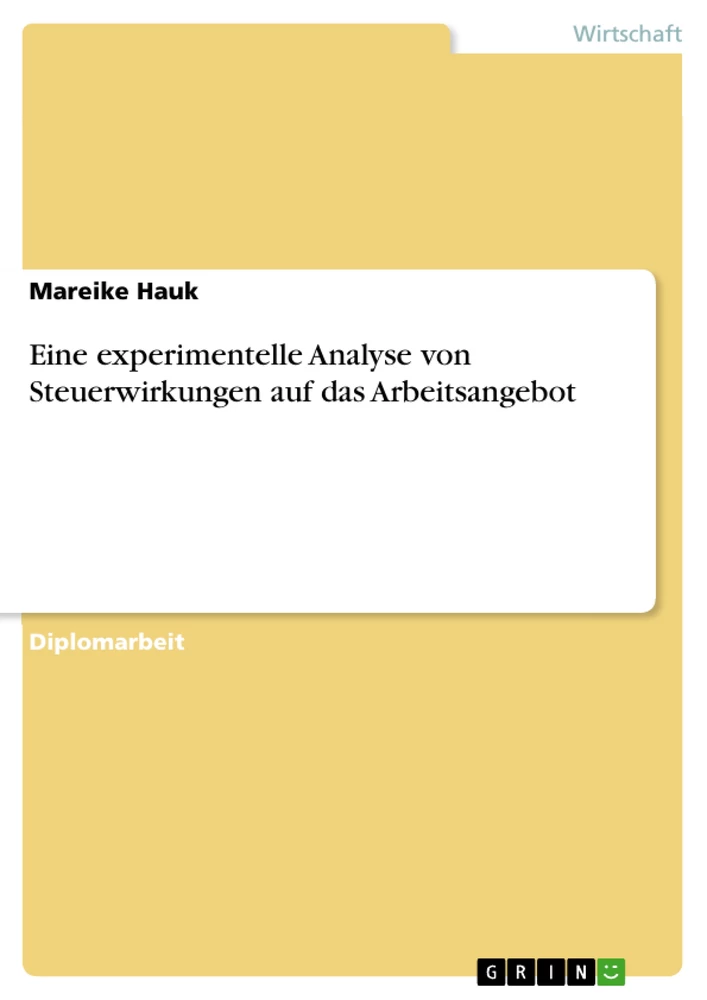Die Untersuchung ökonomischer Fragestellungen in Laborexperimenten nahm in den letzten zwei Jahrzehnten fortwährend zu. Die experimentelle Wirtschaftsforschung ermöglicht es, das Verhalten von Wirtschaftssubjekten in bestimmten ökonomischen Situationen zu beobachten, wobei Störgrößen im Labor relativ gut kontrolliert werden können.1 Bisherige Laborexperimente zu steuerlichen Themen beschäftigten sich hauptsächlich mit der Untersuchung der Steuermoral, der Wahrnehmung von verschieden komplexen Steuersystemen, der Bedeutung sozialer Interaktionen für das Verhalten der Teilnehmer, den Einflüssen von Steuerwirkungen auf das Arbeitsangebot unter Verwendung sogenannter real‑effort games und mit dem Liability Side Equivalence Principle (LSE-Theory). Die LSE‑Theory besagt, dass es für die Inzidenz einer Steuer irrelevant ist, ob diese auf der Nachfrage- oder der Angebotsseite erhoben wird. Es gibt bisher nur wenige experimentelle Untersuchungen, die sich mit den Auswirkungen von Steuern auf das Arbeitsangebot beschäftigten. Insbesondere wurde die LSE-Theory am Arbeitsmarkt bislang nur von Riedl und Tyran (2005) experimentell getestet. Hierbei mussten die Probanden jedoch keine reale Arbeitsanstrengung zur Erzielung ihrer Entlohnung erbringen. Daher konnte die Problematik eines unüblich riskanten Verhaltens nicht ausgeschlossen werden (house-money effect). In der vorliegenden Arbeit wird die LSE-Theory unter Einbindung eines real-effort games zur Simulation einer realen Arbeitsanstrengung untersucht. Ziel dieser Arbeit ist, die bestehende experimentelle Untersuchung von Riedl und Tyran um die Betrachtung einer realen Arbeitsanstrengung zu erweitern und damit einen Schritt in eine realitätsnähere Umgebung zu gehen. Da die Ökonomie auch eine Wissenschaft der sozialen und menschlichen Phänomene ist, kann dabei auf die Berücksichtigung psychologischer und sozialer Aspekte nicht verzichtet werden.2 So wird im Rahmen des house-money effects auf Gedanken von Fairness und Ungleichheitsaversion eingegangen. Weiterhin erfolgt analog zu Riedl und Tyran eine Untersuchung personalökonomischer Aspekte hinsichtlich einer anreizkompatiblen Entlohnung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Experimente in der Ökonomie
- Der house-money effect
- Begriffsklärung
- Experimentelle Untersuchungen des house-money effects
- Ultimatum- und Diktatorspiel
- Die Steuerinzidenz
- Liability Side Equivalence Principle (LSE-Theory)
- Die Steuerinzidenz im partiellen Gütermarktgleichgewicht
- Bestätigung der LSE-Theory am Gütermarkt in experimentellen Untersuchungen
- Die Äquivalenztheorie und deren Ablehnung
- Geldschillusion und die Äquivalenz allgemeiner Steuern
- Steuerillusion, Steuer-Salienz und die LSE-Theory
- Ablehnung der LSE-Theory am Gütermarkt in experimentellen Untersuchungen
- Die LSE-Theory und der Arbeitsmarkt
- Personalökonomische Aspekte
- Kritische Betrachtung der bisherigen experimentellen Studien zur LSE-Theory
- Real-effort games in Laborexperimenten
- Experimentelle Untersuchungen unter Verwendung von real-effort games
- Kriterienliste und Rahmenbedingungen für ein geeignetes real-effort game
- Zwischenfazit
- Eine experimentelle Untersuchung der LSE-Theory in einem Laborarbeitsmarkt unter Verwendung eines real-effort games
- Experimentelles Design und Vorgehensweise
- Grundlegendes experimentelles Design
- Vorgehensweise
- Erwartungen und zu prüfende Hypothesen
- Ergebnisse der Untersuchung und Interpretation
- Effizienzlohntheorie und gift-exchange Ansatz
- LSE-Theory und Nettolöhne
- LSE-Theory und Arbeitsanstrengungen
- Vergleich mit den Resultaten von RIEDL und TYRAN (2005)
- Fazit
- Experimentelles Design und Vorgehensweise
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht experimentell die Auswirkungen von Steuern auf das Arbeitsangebot. Ziel ist es, die Gültigkeit des Liability Side Equivalence Principle (LSE-Theory) im Kontext des Arbeitsmarktes zu überprüfen. Hierfür werden verschiedene experimentelle Ansätze und Methoden herangezogen und kritisch bewertet.
- Experimentelle Überprüfung der LSE-Theory
- Analyse von Steuerwirkungen auf Arbeitsangebot und -anstrengung
- Anwendung von Real-Effort Games in Laborexperimenten
- Vergleich mit bestehenden Studien und Theorien (z.B. Effizienzlohntheorie)
- Bewertung verschiedener experimenteller Designs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der experimentellen Analyse von Steuerwirkungen auf das Arbeitsangebot ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie begründet die Relevanz des Forschungsthemas und stellt die Forschungsfrage dar.
Experimente in der Ökonomie: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Methodologie von Experimenten in der Ökonomie und deren Anwendung im Kontext der Steuerinzidenzforschung. Es werden verschiedene experimentelle Designs und deren Vor- und Nachteile diskutiert.
Der house-money effect: Dieses Kapitel beleuchtet den „house-money effect“, ein psychologisches Phänomen, das die Entscheidungsfindung unter Risiko beeinflusst. Es werden verschiedene experimentelle Untersuchungen dieses Effekts vorgestellt und in den Kontext der Steuerinzidenzforschung eingeordnet.
Die Steuerinzidenz: Dieses Kapitel behandelt die Theorie der Steuerinzidenz, insbesondere das Liability Side Equivalence Principle (LSE-Theory). Es analysiert die Steuerinzidenz im partiellen Gütermarktgleichgewicht und beleuchtet kritisch die bestehenden experimentellen Untersuchungen zur Bestätigung und Ablehnung der LSE-Theory. Die Diskussion umfasst Aspekte wie Geld- und Steuerillusion.
Real-effort games in Laborexperimenten: Dieses Kapitel widmet sich der Methodik der Real-Effort Games und deren Eignung zur Untersuchung der LSE-Theory im Kontext des Arbeitsmarktes. Es werden Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Real-Effort Games definiert und diskutiert.
Eine experimentelle Untersuchung der LSE-Theory in einem Laborarbeitsmarkt unter Verwendung eines real-effort games: Dieses Kapitel beschreibt das experimentelle Design der eigenen Studie, inklusive Vorgehensweise und Hypothesen. Es präsentiert die Ergebnisse und interpretiert diese im Hinblick auf die LSE-Theory und im Kontext der Effizienzlohntheorie und des Gift-Exchange-Ansatzes. Ein Vergleich mit den Resultaten von Riedl und Tyran (2005) wird ebenfalls durchgeführt.
Schlüsselwörter
Steuerinzidenz, LSE-Theory, Arbeitsangebot, Laborexperimente, Real-Effort Games, Effizienzlohntheorie, Steuerillusion, Geldillusion, experimentelles Design, Verhaltensökonomie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Experimentelle Untersuchung der LSE-Theory im Arbeitsmarkt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht experimentell die Auswirkungen von Steuern auf das Arbeitsangebot und prüft die Gültigkeit des Liability Side Equivalence Principle (LSE-Theory) im Kontext des Arbeitsmarktes. Sie nutzt verschiedene experimentelle Ansätze und Methoden, die kritisch bewertet werden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die experimentelle Überprüfung der LSE-Theory, die Analyse von Steuerwirkungen auf Arbeitsangebot und -anstrengung, die Anwendung von Real-Effort Games in Laborexperimenten, einen Vergleich mit bestehenden Studien und Theorien (z.B. Effizienzlohntheorie) und die Bewertung verschiedener experimenteller Designs. Zusätzlich wird der "house-money effect" beleuchtet und in den Kontext der Steuerinzidenzforschung eingeordnet.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet Laborexperimente, insbesondere Real-Effort Games, um die Auswirkungen von Steuern auf das Arbeitsverhalten zu untersuchen. Es werden verschiedene experimentelle Designs diskutiert und ein eigenes experimentelles Design zur Überprüfung der LSE-Theory im Kontext eines Laborarbeitsmarktes vorgestellt und durchgeführt.
Was ist die LSE-Theory und wie wird sie in der Arbeit behandelt?
Die LSE-Theory (Liability Side Equivalence Principle) ist eine Theorie zur Steuerinzidenz. Die Arbeit analysiert die LSE-Theory im partiellen Gütermarktgleichgewicht und untersucht experimentell ihre Gültigkeit im Arbeitsmarkt. Dabei werden kritische Betrachtung bestehender experimenteller Studien sowie Aspekte wie Geld- und Steuerillusion einbezogen.
Welche Rolle spielen Real-Effort Games in der Arbeit?
Real-Effort Games sind eine Methode, um Anstrengung und Arbeitsleistung in Laborexperimenten zu messen. Die Arbeit beschreibt die Methodik der Real-Effort Games und deren Eignung zur Untersuchung der LSE-Theory im Kontext des Arbeitsmarktes. Ein geeignetes Real-Effort Game wird für die eigene experimentelle Untersuchung ausgewählt und angewendet.
Welche Ergebnisse liefert die experimentelle Untersuchung?
Die experimentelle Untersuchung präsentiert Ergebnisse zur Wirkung von Steuern auf Arbeitsangebot und -anstrengung im Kontext der LSE-Theory. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die LSE-Theory und im Kontext der Effizienzlohntheorie und des Gift-Exchange-Ansatzes interpretiert. Ein Vergleich mit den Resultaten von Riedl und Tyran (2005) wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Steuerinzidenz, LSE-Theory, Arbeitsangebot, Laborexperimente, Real-Effort Games, Effizienzlohntheorie, Steuerillusion, Geldillusion, experimentelles Design, Verhaltensökonomie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und einem Überblick über Experimente in der Ökonomie. Es folgen Kapitel zum house-money effect, der Steuerinzidenz, Real-Effort Games und der eigenen experimentellen Untersuchung der LSE-Theory im Arbeitsmarkt. Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung.
- Quote paper
- Mareike Hauk (Author), 2009, Eine experimentelle Analyse von Steuerwirkungen auf das Arbeitsangebot, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199367