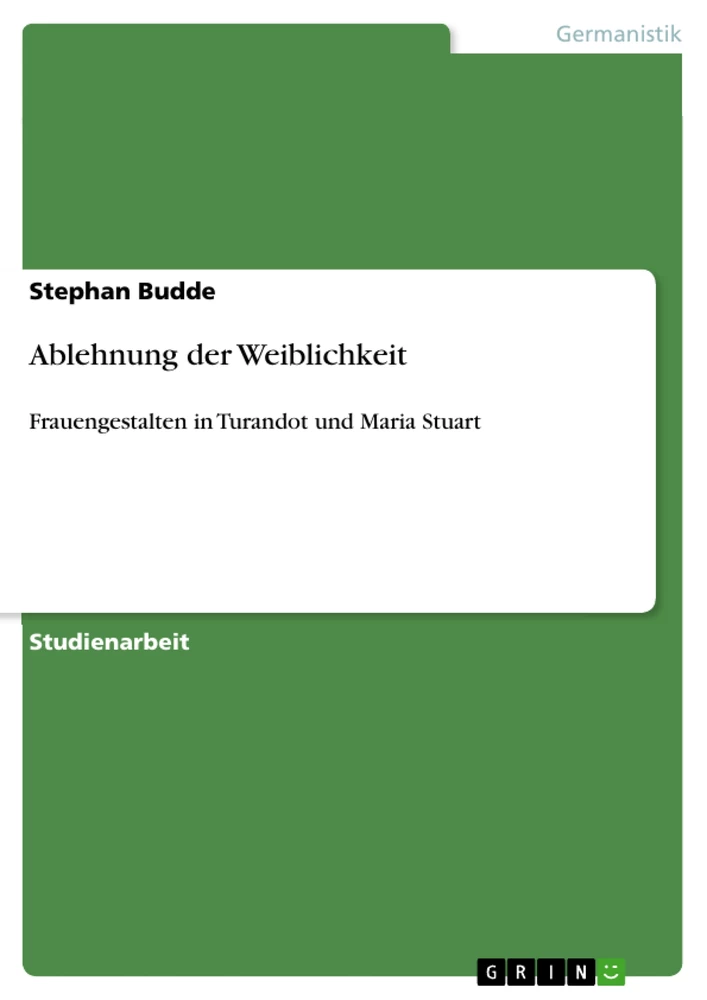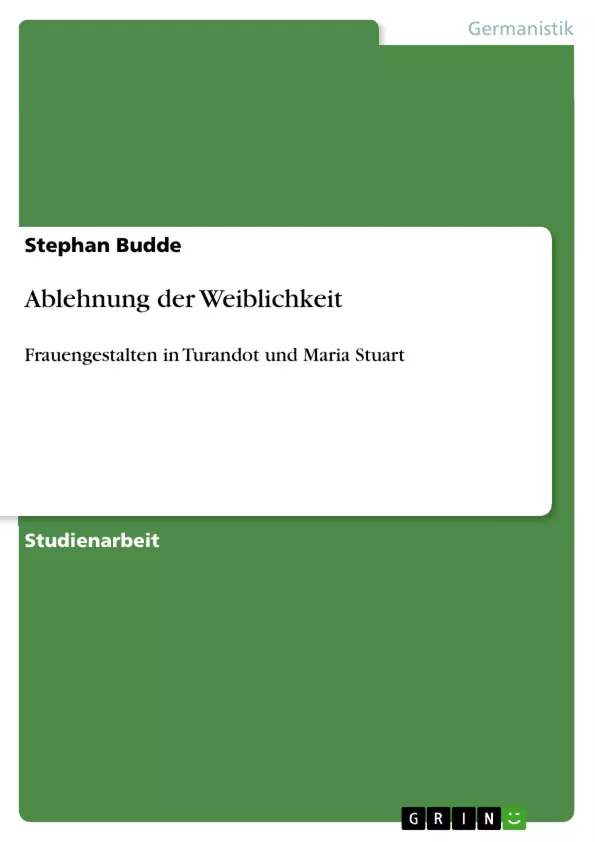Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den dramatischen Figuren Elisabeth in Maria Stuart und Turandot im gleichnamigen Werk. Die zentrale These der Haus-arbeit ist, dass beide versuchen ihre Weiblichkeit abzulegen und die traditionelle Rolle der Frau in der Gesellschaft verneinen, um ihre Macht zu sichern. Zunächst wird die Diskrepanz zwischen Frauenbild und Frauengestalt betrachtet. Diesen Abschnitt könnte man deutlich ausführlicher gestalten, was jedoch den Rahmen der Hausarbeit sprengen würde, daher werde ich an dieser Stelle nur skizzieren. Wichtig ist dieses Kapitel dennoch, da Schiller als Lyriker ein traditionelles Frauenbild zeichnet. In sei-nen Dramen vertreten seine Frauengestalten jedoch feministische Positionen, wofür er in der Vergangenheit oft kritisiert wurde. Danach werde ich auf den Kern der Arbeit eingehen, der sich mit der Ablehnung der Weiblichkeit zur Erhaltung der Macht in Schillers Turandot und Maria Stuart befasst, wobei ich meine These anhand von eini-gen Textbeispielen versuche zu untermauern. Die Frauengestalten in Maria Stuart sind in der Literatur sehr gut aufgearbeitet worden, wohingegen das Werk Turandot in der Forschung bisher eher wenig Beachtung fand. Die Literaturwissenschaft scheint sich eher mit Kabale und Liebe, der Jungfrau von Orleans und Maria Stuart auseinanderzusetzen, was wohl daran liegt, dass Turandot, als Bearbeitung des gleichnamigen Gozzi Stücks, eine geringere Stellung im Gesamtwerk Schillers einge-räumt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Diskrepanz zwischen Frauenbild und Frauengestalt
- Die Ablehung der Weiblichkeit zur Erhaltung der Macht in Turandot und Maria Stuart
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Figuren Elisabeth in Maria Stuart und Turandot, um die These zu belegen, dass beide ihre Weiblichkeit ablegen, um ihre Macht zu sichern. Die Arbeit betrachtet zunächst die Diskrepanz zwischen dem traditionellen Frauenbild und dem Auftreten der Figuren. Anschließend wird die Ablehnung der Weiblichkeit als Mittel zur Machterhaltung im Detail analysiert.
- Diskrepanz zwischen dem traditionellen Frauenbild und dem Auftreten der Figuren Elisabeth und Turandot
- Ablehnung der Weiblichkeit als Strategie zur Machtsicherung
- Analyse der Figuren Elisabeth und Turandot im Kontext der Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts
- Vergleich der beiden Figuren und ihrer Strategien
- Schillers Darstellung von starken, unabhängigen Frauenfiguren
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale These vor: Elisabeth in Maria Stuart und Turandot versuchen ihre Weiblichkeit abzulegen, um ihre Macht zu sichern. Es wird kurz die Diskrepanz zwischen dem traditionellen Frauenbild und dem Auftreten der Figuren skizziert und der Fokus der Arbeit auf die Ablehnung der Weiblichkeit zur Machterhaltung gelegt. Die unterschiedliche Rezeption der beiden Werke in der Literaturwissenschaft wird erwähnt, wobei Turandot im Vergleich zu Maria Stuart weniger Beachtung fand.
Die Diskrepanz zwischen Frauenbild und Frauengestalt: Dieses Kapitel beleuchtet den Widerspruch zwischen dem traditionellen Frauenbild Schillers und der Darstellung der Figuren Elisabeth und Turandot. Es wird der traditionelle Rollenbegriff der Frau im 18. Jahrhundert beschrieben, der sich durch ein statisches Leben im Heim und der Familie auszeichnet. Die relative Autonomie von Elisabeth und Turandot als Angehörige des hohen Adels wird angesprochen, aber als unzureichende Erklärung für ihr untypisches Verhalten dargestellt. Die Bedeutung der Figuren als Repräsentantinnen der gesamten Weiblichkeit, ihre aktive Rolle in geschlossenen Dramen und die Notwendigkeit starker, unabhängiger Figuren für die dramatische Handlung werden erörtert. Die Kritik an Schillers Darstellung weiblicher Figuren und die potenziellen antifeministischen Vorurteile in der Rezeption werden ebenfalls thematisiert.
Die Ablehung der Weiblichkeit zur Erhaltung der Macht in Turandot und Maria Stuart: Dieses Kapitel analysiert, wie Elisabeth und Turandot ihre Weiblichkeit ablegen, um ihre Macht zu erhalten. Es wird insbesondere Elisabeths Zwang, ihre Weiblichkeit zu verleugnen, um ihren Thron in einer von Männern dominierten Welt zu behaupten, betrachtet. Der Wettkampf um die Herrschaft und der erotische Wettstreit zwischen Elisabeth und Maria Stuart werden als wichtige Aspekte ihrer Beziehung hervorgehoben. Elisabeths innerer Konflikt zwischen dem Wunsch nach Liebe und der Notwendigkeit, die Erwartungen an ihre Regentschaft zu erfüllen, wird anhand von Textauszügen veranschaulicht. Ihre Weigerung, sich einem Mann zu unterordnen, wird als Ausdruck ihres Strebens nach Macht und Unabhängigkeit dargestellt.
Schlüsselwörter
Frauenbild, Frauengestalt, Macht, Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Maria Stuart, Turandot, Schiller, Patriarchat, Feminismus, Dramaturgie, Tragödie, Königin, Kaisertochter.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Elisabeth (Maria Stuart) und Turandot
Was ist das Thema dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Figuren Elisabeth in Schillers "Maria Stuart" und Turandot, um die These zu belegen, dass beide ihre Weiblichkeit ablegen, um ihre Macht zu sichern. Der Fokus liegt auf der Diskrepanz zwischen dem traditionellen Frauenbild und dem Auftreten der Figuren sowie der Ablehnung der Weiblichkeit als Mittel zur Machterhaltung.
Welche Aspekte werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert die Diskrepanz zwischen dem traditionellen Frauenbild und dem Auftreten der Figuren Elisabeth und Turandot. Sie untersucht die Ablehnung der Weiblichkeit als Strategie zur Machtsicherung, betrachtet die Figuren im Kontext der Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts, vergleicht ihre Strategien und beleuchtet Schillers Darstellung von starken, unabhängigen Frauenfiguren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Diskrepanz zwischen Frauenbild und Frauengestalt, ein Kapitel zur Ablehnung der Weiblichkeit als Mittel zur Machterhaltung in "Maria Stuart" und "Turandot" und ein Fazit. Die Einleitung stellt die These und den Fokus der Arbeit vor. Das zweite Kapitel beleuchtet den Widerspruch zwischen dem traditionellen Frauenbild und den Figuren. Das dritte Kapitel analysiert, wie Elisabeth und Turandot ihre Weiblichkeit ablegen, um ihre Macht zu erhalten.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Frauenbild, Frauengestalt, Macht, Weiblichkeit, Geschlechterrollen, Patriarchat, Feminismus, Dramaturgie, Tragödie, sowie die Figuren Elisabeth und Turandot selbst im Kontext von Schillers Werken.
Wie wird die These der Ablehnung der Weiblichkeit belegt?
Die These wird belegt durch eine detaillierte Analyse der Figuren Elisabeth und Turandot. Es wird untersucht, wie beide Figuren ihre Weiblichkeit verleugnen, um ihre Macht in einer von Männern dominierten Welt zu sichern. Der Fokus liegt auf den Handlungsweisen, den Beziehungen zu anderen Figuren und den inneren Konflikten der Protagonistinnen.
Welche Rolle spielt das 18. Jahrhundert?
Das 18. Jahrhundert ist relevant, da es den historischen und gesellschaftlichen Kontext für die Figuren und ihre Handlungen liefert. Der traditionelle Rollenbegriff der Frau im 18. Jahrhundert wird beschrieben und im Gegensatz zum Verhalten Elisabeths und Turandots gestellt. Die Analyse betrachtet auch, wie Schillers Darstellung von Frauen in diesem Kontext zu verstehen ist.
Wie werden die Figuren Elisabeth und Turandot verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Strategien Elisabeths und Turandots zur Machtsicherung und wie sie dabei ihre Weiblichkeit ablegen oder umgehen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in ihrem Verhalten und ihren Konflikten werden analysiert, um die These der Hausarbeit zu untermauern.
Welche Rezeption der Werke wird berücksichtigt?
Die Arbeit erwähnt die unterschiedliche Rezeption von "Maria Stuart" und "Turandot" in der Literaturwissenschaft und thematisiert potenzielle antifeministische Vorurteile in der Interpretation der weiblichen Figuren.
- Quote paper
- Stephan Budde (Author), 2011, Ablehnung der Weiblichkeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200418