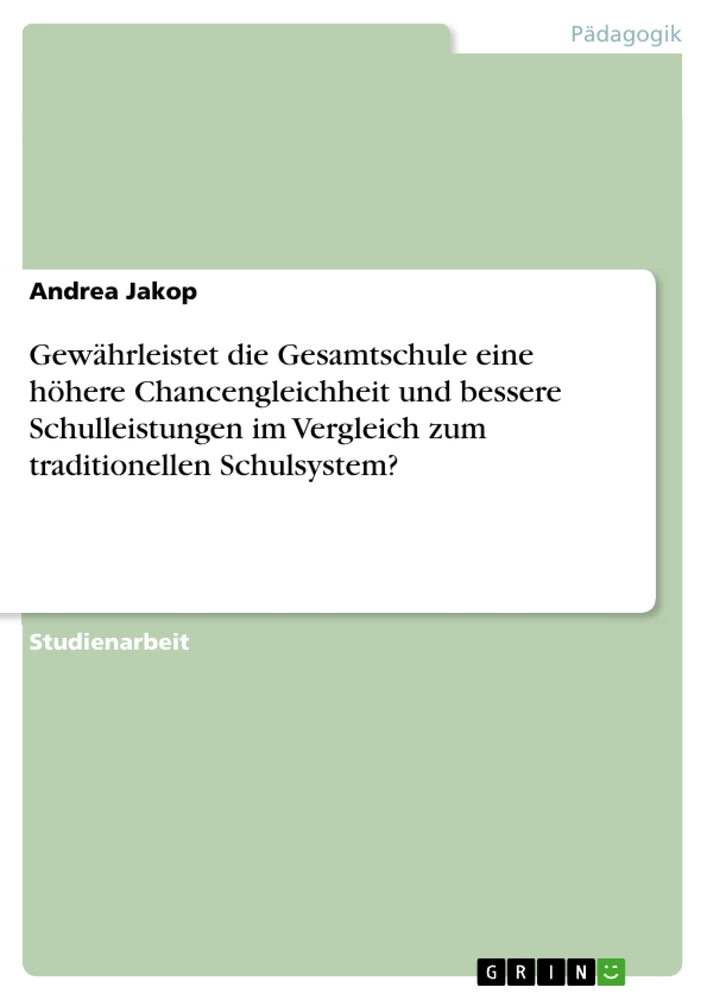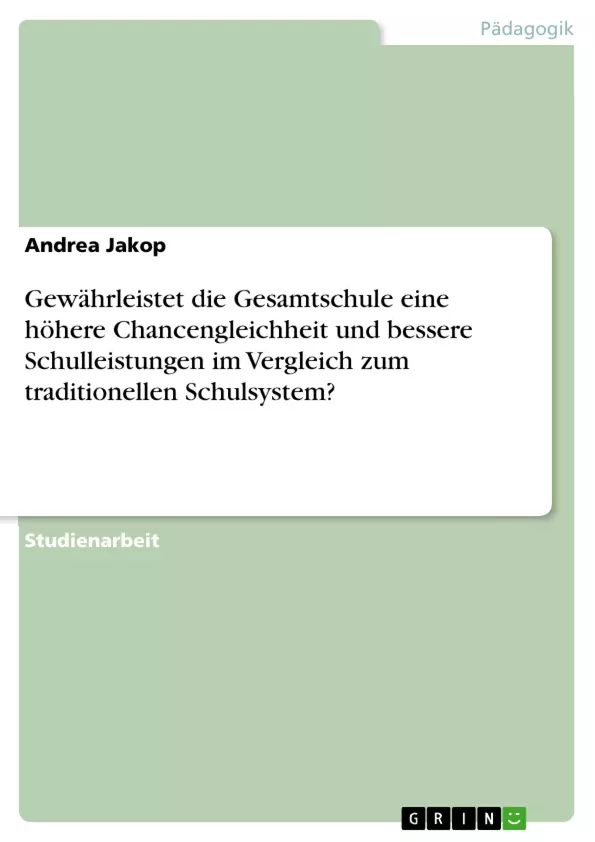A. Von der Gründungsphase bis zur Expansion
„Die Zahl der Benachteiligten aus den Unterschichten, insbesondere mit Migrationshin-tergrund, ist in keinem anderen OECD-Land so hoch wie bei uns. Der Zusammenhang mit der frühen Selektion nach Klasse 4 ist offensichtlich.“ (vgl. Wunder 2007, S. 25). Diese er-schreckende Tatsache ist das Ergebnis von international vergleichenden Studien wie PISA und TIMSSD. Der Bayerische Bildungsbericht 2009 spricht es erneut an: „das hochselektive bayerische Schulsystem kann nicht angemessen auf Herausforderungen der Zukunft reagie-ren“ (BLLV 2010, S. 1). Das schlechte Abschneiden Deutschlands führt derzeit in Politik und Gesellschaft zu heftigen Diskussionen über die Schulstrukturen in der Bundesrepublik. In diesem Zusammenhang tritt besonders die Gesamtschule in das Blickfeld, da Länder, die in PISA positiv herausstechen, ein solches Schulsystem führen (vgl. Wunder 2007, S. 24). Trotz mittlerweile über 30-jähriger Entwicklungsgeschichte, ist die Gesamtschule ein umstrit-tenes Thema geblieben. Im Unterschied zu den meisten Ländern der Welt, deren Schulsys-tem neu strukturiert wurde und fast alle Schüler bis zum Ende der Grundbildungsphase zu-sammenfasst, hielt Deutschland an seiner Vielgliedrigkeit fest (vgl. Wenzler 2003, S. 65). Die Frage, welche Schulart nun zu einer Verbesserung von sozialer Ungerechtigkeit, schlechten Leistungen und der hohen Quote an Sitzenbleibern führen kann, muss schnellstmöglich be-antwortet werden (vgl. ebd., S. 83). Identische Überlegungen zu denselben Problemen gab es schon in den 60er Jahren. Damals startete der Deutsche Bildungsrat als Antwort den Ge-samtschulversuch (vgl. Geißler 2004, S. 362). Was sind nun Ergebnisse dieses Versuches, in den Politiker wie auch Eltern große Hoffnungen setzten? Gewährleistet die Gesamtschule bessere Leistungen und eine höhere Chancengleichheit im Vergleich zum traditionellen Schulsystem?
Im Folgenden werden unter anderem Verlauf und Ergebnisse von Untersuchungen in zwei ausgewählten Bundesländern vorgestellt. Als Abschluss erfolgt eine Zusammenfassung zur Beantwortung der Themenfrage und ein Blick auf die derzeitige Gesamtschulsituation.
Inhaltsverzeichnis
- A. Von der Gründungsphase bis zur Expansion.
- B. Gewährleistet die Gesamtschule eine höhere Chancengleichheit und bessere Schulleistungen im Vergleich zum traditionellen Schulsystem?
- 1. Bildungspolitische Motive für die Entstehung der Gesamtschule
- 2. Charakteristiken des neuen Schulsystems im Vergleich zum traditionellen
- 3. Problematiken bei der Evaluation von Schulsystemen
- 4. Systemvergleichende Schulleistungsstudien in der Bundesrepublik
- 4.1 Die Gesamtschulstudie im Flächenversuch Wetzlar (Hessen)
- 4.1.1 Ausgangslage
- 4.1.2 Leistungsvergleich am Ende des 6. Schuljahres
- 4.1.3 Leistungsvergleich am Ende der Pflichtschulzeit.
- 4.2 Die Schulleistungsstudie in Nordrhein-Westfalen
- 4.2.1 Ausgangslage
- 4.2.2 Situation am Ende des 6. Schuljahres
- 4.2.3 Situation am Ende der Pflichtschulzeit.
- 5. Abschlüsse und Chancengleichheit
- C. Aktuelle Zahlen und die derzeitige Gesamtschulsituation.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Frage, ob die Gesamtschule im Vergleich zum traditionellen Schulsystem eine höhere Chancengleichheit und bessere Schulleistungen gewährleisten kann. Er beleuchtet die Entstehung der Gesamtschule, ihre pädagogischen und sozialen Ziele und analysiert deren Umsetzung anhand von empirischen Studien.
- Bildungspolitische Motive für die Einführung der Gesamtschule
- Vergleich der Charakteristiken der Gesamtschule mit dem traditionellen Schulsystem
- Methodische Herausforderungen bei der Evaluation von Schulsystemen
- Ergebnisse von vergleichenden Schulleistungsstudien in verschiedenen Bundesländern
- Zusammenhang zwischen Schulabschlüssen und Chancengleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Gesamtschule und die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu ihrer Einführung führten. Es werden die Bildungsziele und die Kritik am traditionellen Schulsystem dargestellt. Das zweite Kapitel vergleicht die Gesamtschule mit dem gegliederten Schulsystem und stellt die wichtigsten Unterschiede in Bezug auf Organisation, Unterricht und Selektion heraus. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der komplexen Frage der Evaluation von Schulsystemen. Die Kapitel 4.1 und 4.2 fokussieren auf die Ergebnisse von zwei Schulleistungsstudien in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Studien untersuchen die Leistungsentwicklung von Schülern an Gesamtschulen und traditionellen Schulen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Unterschieden in Bezug auf Chancengleichheit und Lernerfolg. Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Studien und die derzeitige Situation der Gesamtschulen in Deutschland zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Textes sind Gesamtschule, traditionelles Schulsystem, Chancengleichheit, Schulleistung, Bildungspolitik, Evaluation, Schulleistungsstudien, soziale Ungleichheit, Bildungszugang und Differenzierung im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel des Gesamtschulversuchs in Deutschland?
Ziel war es, soziale Ungerechtigkeit zu verringern, Schulleistungen zu verbessern und die hohe Quote an Sitzenbleibern zu senken.
Warum wird die frühe Selektion nach Klasse 4 kritisiert?
Studien wie PISA zeigen, dass die frühe Trennung der Schüler den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg verstärkt.
Welche Bundesländer wurden in der Studie verglichen?
Die Arbeit analysiert Ergebnisse von Schulleistungsstudien aus Hessen (Wetzlar) und Nordrhein-Westfalen.
Gewährleistet die Gesamtschule tatsächlich bessere Leistungen?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch anhand von Leistungsvergleichen am Ende des 6. Schuljahres und der Pflichtschulzeit.
Was sind die bildungspolitischen Motive hinter der Gesamtschule?
Motive sind vor allem die Demokratisierung der Bildung und die Herstellung von Chancengleichheit für Kinder aus allen sozialen Schichten.
- Quote paper
- Andrea Jakop (Author), 2010, Gewährleistet die Gesamtschule eine höhere Chancengleichheit und bessere Schulleistungen im Vergleich zum traditionellen Schulsystem?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200616